Am Ende werden es lauter kleine engagierte Verlage sein, die sich überhaupt noch darum kümmern, dass die Weltliteratur den Weg in den deutschen Sprachraum findet. Die Zeit, dass sich die namhaften großen Verlage diese Mühe machten, ist vorbei. Dort schaut man nur noch auf Verkaufszahlen. In Leipzig beim Leipziger Literaturverlag ist Franz Hodjak schon mit dem Band "Was wäre schon ein Unglück ohne Worte".
Mit dem Erzählungsband “Das Ende wird Nabucco heißen” hat er 2014 sein zweites Buch in dem kleinen Leipziger Verlag vorgelegt, in dessen Programm der 1944 in Hermannstadt (Rumänien) Geborene natürlich ideal passt. Denn mit feinem Gespür widmet sich der Literaturverlag seit Jahren auch der Literatur aus Ost- und Südosteuropa. Auch wenn Franz Hodjak, einst Lektor beim Dacia Verlag in Klausenburg, seit 1992 in Deutschland lebt. Mit seinen eigenwilligen Gedichten hat er auch schon vor der Übersiedlung das deutsche Publikum bezaubert. 1990 bekam er dafür auch den Georg-Maurer-Preis. Dann gab’s auch ein paar erfolgreiche Jahre im Programm des Suhrkamp Verlages. Aber mit der Jahrtausendwende hat sich auch dort so Manches geändert, ist die Pflege der kleinen, unangepassten Literaturen etwas aus dem Fokus geraten.
Ob das Publikum dafür verschwunden ist? Bestimmt nicht. Aber wer die Buchhandlungen besucht, weiß, wie sehr auch die modernen Verkaufsformate zugeschnitten sind auf Bestseller, auf schnellen Durchlauf, auf eiliges Wegstapeln. Wer in dieses Stakkato nicht mehr hineinpasst, der hat kaum noch Chancen, die Aufmerksamkeit suchender Leser zu finden. Der fliegt quasi vom maximal beschleunigten Band. Und landet dann eben nicht mehr in Frankfurt oder Berlin, sonden im etwas ruhigeren Schleußig. Oder auch mal in Dresden. Aber das war schon 2002.
Die 17 Geschichten, die er in diesem Band vorlegt, sind im Grunde keine Erzählungen im klassischen Sinn. Eher Kurzgeschichten, die er verwoben hat wie lauter bunte Wollreste, die zusammen so etwas wie ein Vlies ergeben, einen Wandteppich “im Sinne eines modernen Nomadentums”, wie es der Verlag im Klappentext betont. Denn es sind natürlich typische Hodjak-Geschichten, so lakonisch, trocken und störrisch wie seine Gedichte. Und im Grunde handeln sie auch von den selben Themen, die sich alle unter den großen Bogen fügen, der das komplette 20. Jahrhundert überschreibt: Heimatlosigkeit.
Wenn man den kleinen, engen Rahmen der deutschen Sucht auf die Welt verlässt, merkt man schnell, wie sehr die Kriege und Umwälzungen des 20. Jahrhunderts Millionen von Menschen und ganze Völker heimatlos gemacht haben, herausgerissen haben aus Gefügen, die über Jahrhunderte wie selbstverständlich gelebt wurden. Auch in der einstigen k.u.k.-Doppelmonarchie. Dass Hodjaks Buch genau 100 Jahre nach Ausbruch des 1. Weltkriegs erschien, ist kein Zufall. Der Untergang der Doppelmonarchie irrlichtert in einigen Geschichten noch herum. Und die Perspektive, die Hodjak wählt, macht deutlich, wie fremd die entfesselten Nationalismen in die Lebenswelt der Völker einbrachen und jahrhundertelang gelebtes zumeist friedliches Miteinander zerstörten.
Auch in Rumänien, das ab 1945 auch die Verwerfungen der sozialistischen Ära erlebte.
Hodjak spannt den Bogen seiner Erzählungen über das ganze Jahrhundert, doch es sind keine politischen Geschichten, die er erzählt. Er holt seine Helden aus dem Alltag ab, lässt sie einfach aufbrechen in die Abenteuer ihres Alltags und mitten im Aufbruch noch drehen sich die Geschichten, füllen sich mit Reflexionen, Erinnerungen, den freudigen Abschweifungen eines Autors, der einfach aus Freude am Erzählen erzählt. Und der es auch jedes Mal wieder schafft, zum Ausgangspunkt seiner Geschichte zurückzukehren. Doch zwischendrin ist etwas Seltsames passiert: Wo man eben noch gespannt wie ein Flitzebogen war, in welches Malheur sich Hodjaks Helden da fröhlichen Mutes stürzen werden und ob sie da überhaupt wieder heil herauskommen, ist diese Neugier auf einmal wie weggeblasen. Die Geschichte ist zwar noch nicht passiert, wie man das von klassischen (Kurz-)Geschichten so gewohnt ist. Aber der Autor hat schon so viel erzählt, dass man keine Bange mehr hat um die teils dem Schelmenroman entsprungenen Helden, die alle ein wenig mit Eulenspiegel, Schwejk und Sancho Pansa verwandt sind.
Über zehn Ecken auf jeden Fall. Das Wörtchen Taugenichts taucht im Klappentext noch auf. Aber in diesem Fall trift es nicht. Denn Hodjaks Helden stehen mitten im Leben. Sie haben nur eines gelernt: Dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Dinge ihren geregelten Gang gehen. Erst recht nicht, wenn Politiker, Staatsmänner, Verwalter und Bürokraten das Sagen haben. Dann drehen die Erlebnisse schnell ins Kafkaeske ab. Und Hodjak hat ja zwei Gesellschaften erlebt, die er bestens vergleichen kann: den rumänischen Sozialismus, der am Ende genauso federfuchsig und überwachungsstaatlich wurde wie der in der DDR, samt Mangelwirtschaft und Bevormundung auch und gerade den Minderheiten gegenüber, zu denen auch die Siebenbürger Sachsen gehören. Und auf der anderen Seite der ausgewachsene Bürokratismus der Bundesrepublik, den Hodjak mehrfach mit bissiger Freude aufspießt. In “Die Agentur” etwa, wo er seinen Helden Mathias Kronberg auf eine Audienz beim Chef der Agentur (für Arbeit) schickt in der Hoffnung, hier einem Mann zu begegnen, der tatsächlich persönlich dirigiert, wie die arbeitslos gewordenen Schützlinge in seinem Haus wieder eifrg in Stellung gebracht werden. Doch der Mann, dem er begegnet, ist nichts als ein kleiner Schauspieler, der sichtlich eine völlig sinnfreie Rolle ausfüllt. Die Maschine mahlt längst völlig ohne menschliche Korrekturen. Ganz ähnlich passiert es in der folgenden “Silvester”-Geschichte, die einen ganzen Zug voller Passagiere auf einer völlig von menschlicher Betreuung entblößten Bahnstation im Nirgendwo landen lässt – der Anschlusszug kommt nicht. Aber es gibt auch keine Möglichkeit, irgendwo Auskunft über den im Schneesturm ausgebliebenen Zug zu bekommen. Schauplatz scheint diesmal eher nicht die deutsche, sondern die rumänische Provinz zu sein. Was die Lage rettet. Denn wenn rumänische Zugpassagiere auf so eine Art stranden, dann wissen sie trotzdem Silvester zu feiern.
Es geht auch durchaus kafkaesk im vollen Sinn des Wortes zu – in “Die Pension” etwa, eine Geschichte, die man auf das fremdbestimmte Leben des modernen Wohlstandsbürgers lesen kann, der sich alles, aber auch alles gefallen lässt, so lange ihm die Pensionsleitung nur erzählt, er könne in ein paar Tagen wieder in sein schönes Luxuszimmer im Erdgeschoss zurückkehren. Natürlich gibt es bei Hodjak auch die Aufbegehrer, die sich die vormundschaftlichen Vorgaben nicht gefallen lassen – wie Jeremias (in “Jeremias, mein Freund”), der es einfach nicht mehr aushält, in einer festen Wohnung zu leben und lieber mit Dauerticket in den schönen Regionalzügen der Deutschen Bahn lebt. Oder wie “Der sture Herr Beckermann”, die sich einfach nicht in den frommen Einheitsbrei des Städtchens Dreipfeifen einfügen will – übrigens eine hübsche Parabel über die Frage, wie schnell ein Mensch in einer bornierten Provinzgemeinschaft zum Außenseiter gestempelt wird, wenn er die vor Ort gültigen Normen in Frage stellt.
Was ja zusammen gehört mit dem gelebten Nationalismus des 20. Jahrhunderts, der immer nur ein auf strenge Bügelfalte getrimmter Provinzialismus war. Und das mit “Nabucco” ist eine der erwähnten Schelmengeschichten, an denen die Literaturen des Ostblocks eigentlich reich sind, nur merkt das heute keiner mehr, weil die großen Verlage ihre Kassenschlager lieber auf angelsächsischen Märkten suchen. Da geht eine Menge verloren. Auch eine Menge Wissen um die Art, wie die Völker des Ostens mit den verordneten Regimen umgingen und welche Strategien sie entwickelten, um der herrschenden Gleichrichterei zu entgehen. Dazu gehörte – nicht nur in Rumänien – auch der herrliche Gefangenenchor in “Nabucco”, der sich noch ganz anders anhört, wenn das Publikum im Sall aufsteht und ihn lauthals mitsingt.
Das soll auch in der DDR da und dort passiert sein. Und wenn nicht, dann ist es wenigstens gut ausgedacht und man glaubt es dem Helden, dass er zur Beerdigung nichts anderes gespielt haben möchte. Bitte zum Mitsingen für alle Teilnehmer der Beerdigung.
Natürlich sind es eher 17 humorvoll und poetisch erzählte Parabeln als Kurzgeschichten. Parabeln über ein Leben zwischen zwei Ländern, zwei Gesellschaften, zwei Welten, das dem gelernten DDR-Bürger, der den Band in die Hand bekommt, recht vertraut vorkommen könnte – samt dem Gefühl, zwischen allen Stühlen, Grenzen und Sicherheiten verloren gegangen zu sein, auf gewisse Weise doppelt heimatlos, erst recht dann, wenn man den Hodjakschen Erfahrungen mit der deutschen Bürokratie aus vollem Herzen zustimmen kann.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
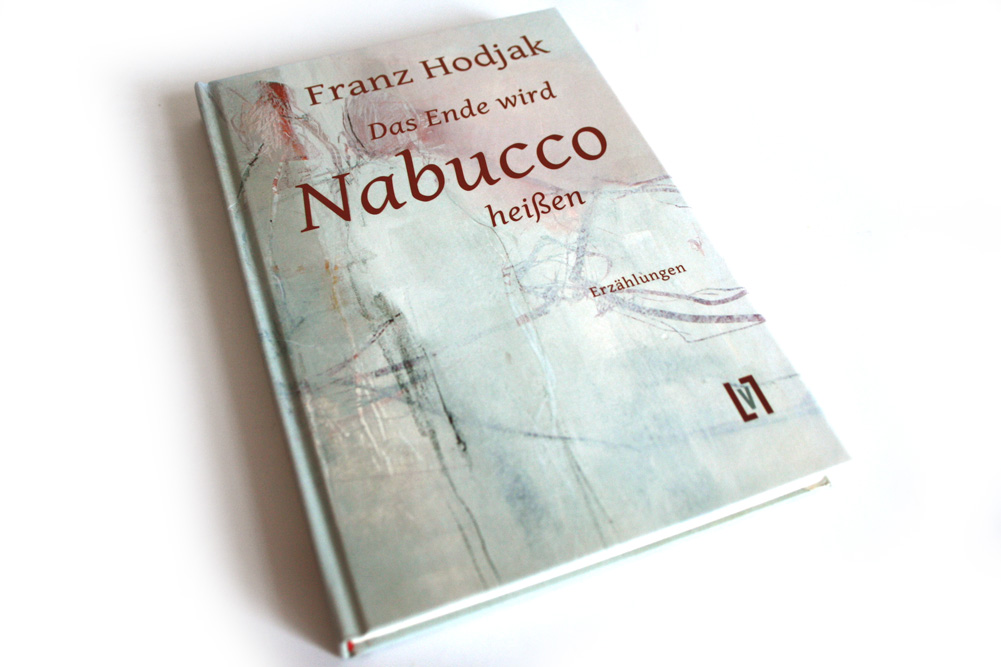








Keine Kommentare bisher