Franz Werfel im St. Benno Verlag, das ist mal was Neues. Immerhin gehört Werfel zu den wichtigsten Romanautoren der deutschen Sprache im 20. Jahrhundert. Mit „Verdi“ hat er in den 1920er Jahren eine regelrechte Verdi-Renaissance ausgelöst. Die Armenier haben ihm posthum 2006 die Staatsbürgerschaft verliehen. Denn wenn er sich ein Thema vornahm, dann tat er das mit Leidenschaft. Das gilt auch für „Das Lied von Bernadette“.
Dass die Armenier ihn ehrten, hat mit seinem 1933 erschienenen Roman „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ zu tun, in dem er den Genozid an den Armeniern durch die Türken in den Jahren 1915 /1916 thematisierte. Ein Buch nicht nur voller Empathie, sondern auch mit umfassendem Wissen um das Schicksal der Armenier, das sich Werfel 1929 anzueignen begann. Für den in Prag geborenen Autor, der auch einer der frühen Wegbereiter der expressionistischen Lyrik in Deutschland war, gehörte zum Arbeiten an einem Roman immer auch die akribische Recherche. Da war er Zeitgenossen wie Stefan Zweig und Heinrich Mann verwandt. Beide genauso unvergessen und genauso beliebt bei heutigen Lesern, denn ihre historischen Romane setzen sich deutlich ab von einer heute gepflegten Romanliteratur, die sich mit Recherche und historischer Nähe eher schwer tut und lieber über das Leiden an sich und der Welt philosophiert.
Ein Buch wie „Das Lied der Bernadette“ hätte man freilich im Werk Werfels gar nicht vermutet, immerhin stammt er aus einer Familie mit jüdischen Wurzeln und ging ins Exil, als die Nazis sein Heimatland Österreich „anschlossen“ ans Reich. Wie viele andere namhafte deutsche Autoren wählte er das französische Sanary-sur-Mer zum Exil, doch 1940 besetzten die Deutschen auch den Norden Frankreichs und bekamen durch das kollaborierende Vichy-Regime auch Zugriff auf den Süden. Die Geflohenen mussten weiterfliehen und konnten nur noch auf ein Ticket in die USA rechnen. An den Pyrenäen kreuzten sich ihre Schicksale, hier mussten sie alle hinüber, um drüben in Spanien weiterzureisen bis zur Atlantikküste.
Doch hier hingen sie oft auch über Wochen und Monate fest, weil sie noch kein Visum hatten. Entsprechend überfüllt waren die Unterkünfte und die Werfels – Franz und Alma Mahler-Werfel – verschlug es in das damals schon berühmte Lourdes, wo er sich augenscheinlich sehr intensiv mit allem beschäftigte, was er über das Leben der Müllerstochter Bernadette Soubirous erfahren konnte. In gewisser Weise verflochten sich hier ihre Schicksale, denn für Werfel stand sein Leben ja auf Messers Schneide: Ohne das erlösende Visum würde er den Fängen der Nazis nicht entkommen. Und so schwor er, wenn er der Mausefalle doch noch entkommen würde, als erstes einen Roman über Bernadette Soubirous zu schreiben. Darüber schreibt er übrigens selbst im Vorwort zu seinem Buch, das tatsächlich schon kurz nach seiner Ankunft in den USA 1941 erschien und sofort zu einem Bestseller wurde. Singen wollte er das Lied der Bernadette, „so gut ich kann.“
Und er hat es getan. Er hat nicht nur das kleine Pyrenäen-Städtchen Lourdes wieder zum Leben erweckt, wie es war, bevor die großen Wallfahrten begannen, er hat auch die Zeit mit satten Farben gemalt – mit ihrer Armut, mit ihren politischen Verwerfungen. Napoleon III. war auf dem Gipfelpunkt seiner Macht. Intellektuelle und Staatsbeamte empfanden sich als Vertreter einer rationalen, aufgeklärten Zeit. Auch in Lourdes. Und dann das: ein 14-jähriges Mädchen, das vor einer Grotte am Flüsschen Gave auf einmal Erscheinungen hat, darüber eigentlich nicht reden will, doch die Kunde verbreitet sich wie ein Lauffeuer, erst recht, als in der Grotte auf einmal eine Quelle zu sprudeln beginnt, die sich auf einmal als heilsam erweist.
Aber Werfel schwärmt nicht, auch wenn er sich für dieses Mädchen erwärmt, sich einfühlt in dieses arme Leben und die aufklaffenden Widersprüche. Selbst die Vertreter der Kirche reagieren anfangs skeptisch bis herablassend. Noch ist nicht zu ahnen, was für ein Rummel das mal werden würde, wenn Bischof und Papst erst ihre Urteile gefällt haben würden. Wie irre das Ganze ist, zeigen auch heute noch die heftigen Parteierklärungen bis ins Online-Lexikon hinein: Steif und fest wird da behauptet, das ungebildete Mädchen könnte den Begriff „Immaculada Councepciou“ nie und nimmer schon gekannt haben.
Klar hat sie, muss sie sogar, schrieb schon Tucholsky weit vor Werfel. Er hatte Lourdes zehn Jahre vorher auf seiner Pyrenäenreise besucht. Dabei hatte Papst Pius IX. das Dogma von der unbefleckten Empfängnis erst vier Jahre vor Bernadettes Erscheinungen verkündet. Und in der katholischen Welt machte diese Verkündung genauso Furore wie Jahre später das verkündete Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes.
Werfel lässt diese Spiegelfechtereien anklingen, lässt sie sich spiegeln im Leben seiner Heldin, die nie von Maria spricht, sondern immer nur von der Dame. Und es sind vor allem die Armen, die bald zur Grotte strömen. Ihnen sind die Selbstherrlichkeiten der Mächtigen egal. Es ist fast dieselbe Zeit, in der Karl Marx seinen Satz schrieb von der Religion, die Opium für das Volk sei. Immer wieder missverstanden – in der Regel von solchen Typen, wie sie Werfel hier aufmarschieren lässt: subalterne Beamten, Richtern, Staatsdienern, die irgendwie zu enträtseln suchen, was der Kaiser eigentlich gern vollzogen hätte. Doch der ist wankelmütig und auf seine Art selber abergläubisch, lässt sich in solchen Fragen auch von seiner Frau gängeln. Es ist ein erstaunlich lebendiges Panorama, das Werfel hier aufstellt. Er kennt seine Pappenheimer, diese ganze Bigotterie, die sich als Aufgeklärtheit verkaufen will, die Typen hat er auch in Deutschland und Österreich kennengelernt.
Und man merkt es im Buch, mit wem er sich als Autor identifiziert. Gar nicht mal mit Bernadette selbst, für die hat er im Grunde ein großes, allumfassendes Mitfühlen. Indem er ihr Leben so detailgenau wie möglich rekonstruiert, macht er sie lebendig. Möglich, dass er auch ein gut Teil seiner eigenen Zweifel und Hoffnungen in das Mädchen legt. In ihrem Herumgeworfensein und ihrem klaren Ton, der immer wieder für Verwirrung sorgt, wird ein Stück Zagen dieses Autors stecken, sein eigenes, lebenslanges Ringen um Wahrheit und Richtigsein. Ganz fremd war ihm ja die katholische Welt nicht, denn in seiner Jugend hatte er ja eine von Piaristen geleitete Volksschule besucht.
Aber noch viel mehr identifiziert sich der Autor mit den großen Zweiflern in der Geschichte – mit dem Pfarrer Peyramale, der die Erscheinungen der kleinen Soubirous geradezu als Herausforderung empfindet, und noch viel stärker mit Hyacinthe de Lafite, dem verkrachten Dichter aus Paris, der sich anfangs geradezu überbietet in Zynismus und Abgeklärtheit diesen lächerlichen Vorgängen in Lourdes gegenüber, denn eigentlich zählt er sich ja zu den auserwählten Literaten des Landes, erfolgreichen Leuten wie Victor Hugo.
Doch am Ende der Geschichte ist von seinem Stolz nicht mehr viel übrig. Das große, die Welt beeindruckende Werk hat er nie geschrieben. Stattdessen lastet die Einsamkeit und die Angst vor dem Tod auf ihm. Womit Werfel wieder Motive aufnimmt, die er früh schon anklingen ließ. Denn alle Rationalität, alle Macht und aller Klassendünkel nützen ja nichts, wenn man sein eigenes Leben nicht lebt und den falschen, weil unerreichbaren Idealen nachjagt. Tatsächlich macht es Werfel nicht anders als in seinem Armenien-Roman: Er konfrontiert seine Helden mit ihrem Verständnis von Menschlichkeit. An diesem irritierenden Mädchen Bernadette müssen sie sich reiben. Sie passt nicht ins Schema. Sie irritiert alle. Und gleichzeitig spricht sie Sehnsüchte an, die gerade die Mühseligen und Beladenen immer mit sich tragen – nach Heilung, Trost, Vergebung.
Selbst Lafite und Peyramale plagen sich ja mit einem ganzen Berg von Vorwürfen und Selbstzweifeln. Das ist so menschlich: Reine, ungebrochene Charaktere gibt es in Werfels Büchern nicht. Darin ist er ein großer Realist. Deswegen wettert er auch nicht über dieses Lourdes, das ihm eigentlich fremd sein müsste. Und erschüttert haben muss es ihn. Dafür sprechen die anschaulichen Szenen, in denen er Lafite am Ende in die Hölle von Lourdes hinuntersteigen lässt, um ihn am Ende sich selbst und seiner Einsamkeit begegnen zu lassen.
Aber den kleinen Seitenhieb auf die lächerliche Gegenwart legt er nicht Lafite in den Mund, sondern einem mit Zahlen prahlenden Franzosen, der 1933 der Heiligsprechung von Bernadette Soubirous in Rom beiwohnt. „Was ist ein Herrscher, ein Präsident, ein Diktator daneben? Das wird heraufgespült und verschwindet in einem tiefen Loch. Was bleibt? Ein Name in vergilbten Geschichtsbüchern! Denken Sie an unsern Napoleon den Dritten, Monsieur! Nichts auf der Welt ist verwester, ja lächerlicher als ein Mächtiger, der keine Macht mehr hat und niemandem schaden kann. Der Tod eines Mächtigen ist eine endgültige Niederlage.“
So kann man wenigstens versuchen, die Gespenster seiner eigenen Zeit zu verdammen. Irgendwie musste es wohl noch untergebracht werden. Denn die Hauptmelodie des Liedes von Bernadette ist eigentlich eine andere, eine vom Verständnis vom Menschen in seiner Verletzlichkeit, seiner Suche nach Trost, die eben auch solche Formen annimmt. Selbst Skeptiker wie dieser mit Worten wütende Lafite wissen es ja, wie einsam man sich fühlen kann in einer heillosen Welt. Und wie einsam man erst recht wird, wenn man mit Verachtung (egal, aus welchem Grund) auf Andere herabschaut.
Deswegen wird der Abspann wie eine Art Schau der Besiegten, auch wenn einige schon das Zeitliche gesegnet haben, als Bernadette im Kloster in Nervers mit gerade 35 Jahren im Sterben liegt. „Abgeschoben“, hat Tucholsky geschrieben, der dem Treiben der Kirche mit allerhöchster Skepsis begegnete. Werfel zeichnet Bernadettes Leben im Kloster wie eine lange Reise zum Einklang mit sich selbst, knüpft damit an eine ganze Bibliothek von Kloster- und Heiligengeschichten an, die es im 19. Jahrhundert immer wieder gab. Man denke nur an Flauberts „Die Versuchung des heiligen Antonius“. Ein ganzes Zeitalter haderte mit dem Widerspruch zwischen Rationalität und dem Wunsch nach einem wirklich erfüllten Leben. Und dass die Jagd nach Ruhm und Geld dafür kein Ersatz war, das wussten sie alle schon. Auch dieser Lafite weiß es und lernt am Ende, dass Hochmut vor allem eines verhindert: Die Menschen um sich zu verstehen – und damit auch sich selbst.
Franz Werfel Das Lied von Bernadette, St. Benno Verlag, Leipzig 2016, 12,95 Euro.
In eigener Sache
Jetzt bis 13. Mai (23:59 Uhr) für 49,50 Euro im Jahr die L-IZ.de & die LEIPZIGER ZEITUNG zusammen abonnieren, Prämien, wie zB. T-Shirts von den „Hooligans Gegen Satzbau“, Schwarwels neues Karikaturenbuch & den Film „Leipzig von oben“ oder den Krimi „Trauma“ aus dem fhl Verlag abstauben. Einige Argumente, um Unterstützer von lokalem Journalismus zu werden, gibt es hier.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
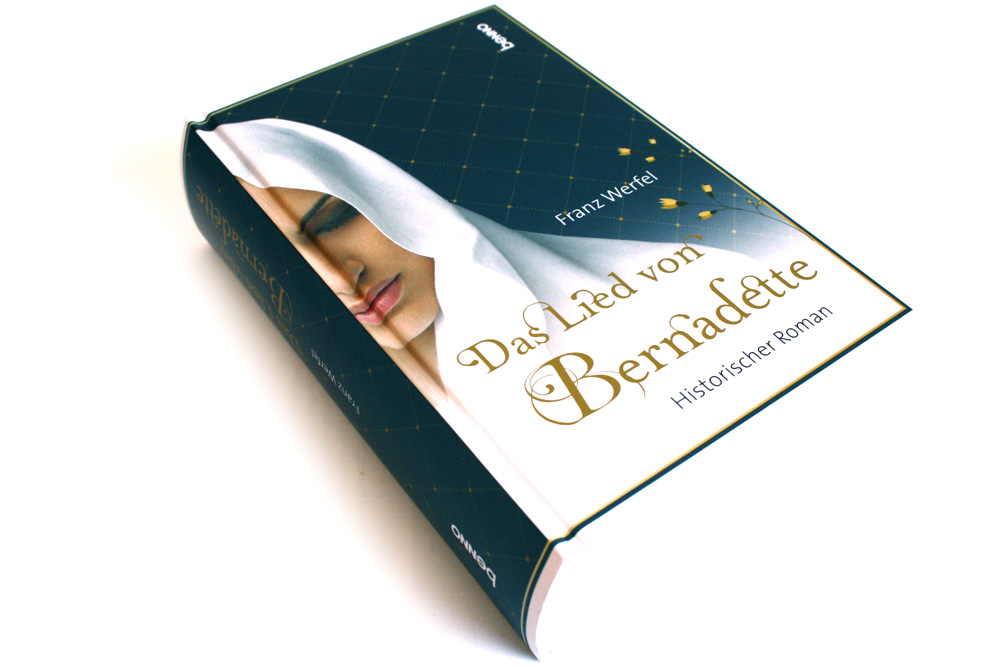








Keine Kommentare bisher