Es gibt sie noch, die Autoren im Land, die sich nachdenklich mit unserer jüngeren Geschichte beschäftigen. Vielleicht ein bisschen viel mit dem Osten, viel zu wenig mit dem Westen, wo man gern professoral vor sich hinphilosophiert. Aber wahrscheinlich ist es derzeit wirklich so: Die DDR bietet den spannenderen Stoff. Oder mal so gesagt: Die Bewohner des so gern verachteten Ostens haben gelebt und haben richtig Weltgeschichte zu spüren bekommen. Das ist Stoff für richtig dicke Romane.
War es schon immer. Gerade jener historische Moment, den Titus Müller sich für diesen Roman herausgesucht hat, war auch schon mehrfach Thema in den Arbeiten älterer namhafter Autoren – von Stefan Heym bis Erich Loest. Sie hatten ja den Eingriff der Geschichte in ihr Leben noch selbst erlebt und erlitten. Kann man zu diesem 17. Juni 1953 noch etwas Neues schreiben?
Kann man und muss man. Denn die Betroffenen konnten zwar zeitnah und sehr authentisch schreiben. Aber sie wussten nicht alles. Zeitgenossen wissen niemals alles über die Geschichte, die ihnen passiert. Zeitzeugen auch nicht. Deswegen darf man den meisten historischen Dokumentationen im deutschen Fernsehen zutiefst misstrauen, erst recht, wenn ein Zeitzeuge nach dem anderen seine Version der Geschichte präsentiert. Es ist fast immer die falsche. Filmisches Erzählen hat Probleme mit der Komplexität. Oder vielleicht sind es auch nur die Regisseure, die diese bedeutungsschwangeren Geschichtsepen drehen – wem der historische Hintergrund fehlt, der bekommt nur die üblichen Oberflächlichkeiten zustande.
Deswegen ist das Stichwort Robert Harris nicht falsch, das der Verlag aus der Westdeutschen Zeitung zitiert. Es ist zwar nicht auf diesen neuen Müller-Roman gemünzt, aber auf seine Arbeitsweise: Er macht es wie der begnadete britische Autor Robert Harris. Er besorgt sich so viel wie möglich Literatur zu seinem Thema, Bücher von Historikern, die sich wirklich mit dem Stoff auskennen, neue Dokumente erschließen, authentische Berichte bringen. Das, was eben nicht jeden Tag in der Zeitung steht und über die Bildschirme flimmert.
Zum Beispiel über den 17. Juni 1953, auf den dieser Roman zurollt. Nur die Daten über den Kapiteln weisen den Leser darauf hin, wohin das Ganze laufen wird, wenn sich die Schicksale der Heldinnen und Helden entfalten. Was schon verblüfft, denn Müller hat ja, als 1977 Geborener, diese Zeit gar nicht miterlebt. Es ist das Jahr, in dem seine Großeltern jung waren. Der Krieg lag gerade einmal acht Jahre zurück. Und während der Westen schon mitten im wirtschaftlichen Aufschwung steckte, gab es im Osten noch immer Lebensmittelmarken und die Versorgungslage war katastrophal – erst recht verschärft durch den drakonischen Wirtschaftskurs der SED, die nun auch kleine Unternehmer enteignete, Handwerker an den Rand drückte und Bauern in Genossenschaften zu pressen versuchte, während alle Kraft in den Aufbau der Schwerindustrie gesteckt wurde.
Logisch, dass es rumorte im Land, erst recht, nachdem auch noch die zehnprozentige Normerhöhung verkündet wurde. Wer über den 17. Juni berichtet, erzählt meist nur diesen Teilaspekt. Aber schon das Heldenensemble, das Titus Müller erschaffen hat, zeigt, dass viel mehr passierte – gleichzeitig. So wurde ab 1952 auch der Druck auf Kirche und Junge Gemeinde erhöht. Was das Leben der Abiturientin Nelly aus den Gleisen zu werfen droht. Aber selbst ihr Schicksal ist wesentlich komplexer, denn ihr Vater gehört zu den Wissenschaftlern und Technikern, die 1946 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in die Sowjetunion verschleppt worden waren, um dort die in Deutschland begonnene militärische Forschung fortzusetzen. Der Agent Ilja bringt das Thema später, als Nelly ihn fragt, auf den Punkt: Ohne die deutschen Forscher hätte es weder die sowjetische Raketentechnik so gegeben noch moderne Düsenjäger-, U-Boot- und Panzer-Technologie. Gerade im sowjetisch besetzten Teil Deutschland waren mehrere wichtige Rüstungsunternehmen ansässig. Im Anhang des Buches gibt Müller die wichtigsten Grundinformationen zu den Themensträngen, die seinen Roman durchziehen, der – auf der Ilja-Linie – zum großen Spionage-Roman tendiert, der auch die Politik der Großmächte sichtbar macht.
Dabei wird auch jenes kurze Kapitel gezeigt, in dem der einstige stalinsche Geheimdienstchef Beria zum neuen starken Mann in der UdSSR wird und versucht, das stalinsche System zu reformieren. In der Regel wird Beria als der Finsterling dargestellt und Chrustschow als der weiße Ritter. Aber Protokolle belegen, dass es Beria war, der schon gleich nach Stalins Tod begann, das finstere System zu lockern. Zu schnell für die alten Funktionäre. Mit tragischen Auswirkungen auch auf den Osten Deutschlands, denn dass das Ulbrichtsche Zentralkomitee sich derart öffentlich entschuldigte für seine Fehler, war nur auf Druck Moskaus zustande gekommen.
Als dann am 17. Juni russische Panzer rollten, war auch dem Letzten wieder klar, wer im Osten eigentlich das Sagen hatte und wie begrenzt die Macht der Ostberliner Regierung war. Aber Titus Müller hat ja nicht umsonst Literatur, Mittelalterliche Geschichte, Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Er weiß um die Vielgesichtgkeit und Doppelbödigkeit von Geschichte. Und er zeigt diese Gleichzeitigkeiten und macht damit erlebbar, wie seine Helden und Heldinnen hineingeworfen sind in diese Zeit, um die Rahmenbedingungen ihres Lebens wissen, die Vorgänge in ihrem Umfeld zumindest zum Teil durchschauen und trotzdem nur einen kleinen Ausschnitt des Ganzen wahrnehmen. Groß genug, um mit aller Tragik ausgefüllt zu sein – für Lotte zum Beispiel, die sich in Halle als Putzfrau durchschlägt, weil ihr als Tochter eines SPD-Funktionärs der Weg zu einem richtigen Studium verwehrt ist, Mutter dreier Kinder – der Vater hat sich irgendwann in den Westen abgesetzt.
Im Schicksal ihres Schwagers Marc spiegelt sich die ganze Tragik des 17. Juni – von einem verirrten Geschoss wird er tödlich verwundet. Und abgeschossen hat es ausgerechnet Lottes Geliebter. Gerade weil Titus Müller immer wieder den Schauplatz wechselt, wird die Vielschichtigkeit der Zeit deutlich, mal wenn der Autor das Leben von Nelly und ihrem Verehrer Wolf Uhlitz in Berlin begleitet (und auch noch Wolfs Beziehung zu seinem Vater, einen Parteisekretär, mit ins Bild nimmt), dann wieder zu Lotte und ihrer Suche nach einem ausgefüllten Leben nach Halle blendet, dann wieder die Spur Iljas verfolgt und auch nach Moskau, London und Bonn schaut. So entsteht ein Zeitpanorama, das mehr zeigt, als es die meisten Romane zu dieser Zeit zeigen können. Auch mehr, als es die meisten Erinnerungen von Zeitzeugen bieten, die ihr Leben stets nur aus der Sicht des Betroffenseins schildern – und mit den stark eingefärbten Interpretationen der Zeit.
Die stark sind und tiefsitzen. Denn die Ostdeutschen erlebten damals selbst, mit welcher Brutalität die Besatzungsmacht über Schicksale entschied, wie sehr auch der ostdeutsche Machtapparat nach dem sowjetischen Vorbild arbeitete. Die Ängste, die Lotte, Wolf und Nelly haben, sind real. Und der Zwiespalt des kasernierten Polizisten Heimeran ebenso. Kann man einer guten Sache dienen, wenn man dann doch auf die eigenen Landsleute schießen muss?
Müller hat sehr intensiv mit Zeitzeugen gesprochen und schildert die Zeit, ihre Armut, die Lebensumstände seiner Protagonisten sehr anschaulich. Man kann es fast riechen und spüren, dieses Leben unter kargen Bedingungen, noch immer von Hunger begleitet, voller Hoffnung, dass es mal besser wird. Nur ein bisschen. Es ist ja nicht der goldene Glanz des Westens, der diese Menschen lockt. Es ist kein Ensemble von eh schon Abgeklärten, die mit diesem halben Land abgeschlossen haben und mit Verachtung auf die herabschauen, die dableiben und ihr Leben in der DDR leben wollen. Und trotzdem stürzen sie alle in diese Konflikte, geraten mit der Staatsmacht und ihrer engstirnigen Brutalität aneinander, bekommen es regelrecht ins Gesicht gesagt, dass von ihnen Anpassung, Unterwerfung und Zuträgerei erwartet wird.
Eigentlich ein Roman, den man unseren Brüdern und Schwestern im Westen auf den Ostertisch legen sollte, damit sie wenigstens mal ein Gefühl dafür bekommen, durch welche Wringmaschine der Osten damals gedreht wurde – wie gerade das Menschlichste immer wieder unter Verdacht genommen wurde und ein eisiger Machtapparat jeden Bereich durchherrschte, observierte und am Ende in Lethargie versetzte. Denn die Nellys und Lottes in diesem Buch sind noch voller Lebensdrang, sie möchten ihre Träume in diesem Land noch verwirklichen. Und sie ahnen nicht mal, dass die Hinrichtung Berias in Moskau ihre Zukunft verändern wird. So, wie auch die Niederschlagung des 17. Juni ihr Leben überschatten wird. Denn nach diesem Tag wird sich das Überwachungssystem in der DDR noch verstärken, werden die gerade noch einmal geretteten Genossen um Ulbricht alles dafür tun, dass ihnen so ein unkontrollierter Moment nie wieder geschieht.
Erst die Enkel jener Menschen, die Müller hier so lebendig zeichnet, werden wieder die Chance bekommen, das Unerträgliche abzuwerfen.
Aber Müller zeigt eben auch, dass man diese ostdeutsche Geschichte auch ohne die ewigen Vorwürfe und Vorurteile erzählen kann – aus der zurückhaltenden Position des Historikers, der aus seiner Arbeit weiß, dass es die eine, einfache Erzählung über die Ereignisse nicht gibt. Nicht mal nur die widersprüchlichen Erzählungen West gegen Ost. Und er macht deutlich, dass in dieser DDR noch viele starke Geschichten stecken, die sich lohnen, erzählt zu werden, gerade weil das Land die ganze Zeit immer Teil und Spielball des Ost-West-Konfliktes war. Was im DDR-Alltag wie nervendes Pappmaché und ewige Leier wirkte, war ja nur die Folie für permanente Zerreißproben, in denen der deutsche Osten mal Verhandlungsmasse war, oft genug Pufferzone und Aufmarschgebiet, selten so souverän, wie sich die regierenden Funktionäre gern gaben – und gerade deshalb ein gut dokumentiertes Spielfeld von Geschichte.
Ein Stoff, um den die meisten deutschen Romanciers einen weiten Bogen ziehen und sich ins fein ziselierte Spirituelle schlagen. Titus Müller aber gehört zu denen, die die riesige Stoffmasse sehen und ihre Romanhelden historisch genau platzieren, mitten hinein in so ein rumorendes Jahr 1953, das bis heute als so entscheidend gilt für die deutsch-deutsche Geschichte. Aber gerade deshalb oft genug verklärt wird und selten so vielseitig erzählt wurde, wie es Titus Müller hier tut. Am Ende ist nicht alles gut. Für ihre Beinahe-Niederlage am „Tag X“ werden die Funktionäre ihre Rechnung noch präsentieren. Und das Leben wird seinen Gang gehen, zugedeckt von einem großen Schweigen.
Darüber reden Heimeran und Lotte am Ende, weil sie nun wissen, dass Mut und Ehrlichkeit in diesem Land einen hohen Preis haben. Geschichte ist – wenn man sie als Rädchen im Getriebe selbst erlebt – meist gar nichts Heroisches oder Erhabenes, sondern etwas zutiefst Bedrückendes und oft genug Schäbiges. Und das ist das Eigentliche, was die Heldinnen und Helden von Titus Müller so vertraut macht: Sie versuchen trotzdem, ihre Menschenwürde, ihren Stolz und ihren Lebensmut zu bewahren und nicht selber schäbig zu werden unter schäbigen Bedingungen. Damit werden sie erstaunlich vertraut. Und es erinnert einen daran, wie lebendig, jung und voller Erwartungen auch unsere Großeltern einmal waren. Unter kärglichen Bedingungen in einer säbelrasselnden Zeit.
Titus Müller Der Tag X, Blessing Verlag, München 2017, 19,99 Euro.
In eigener Sache: Lokaler Journalismus in Leipzig sucht Unterstützer
https://www.l-iz.de/bildung/medien/2017/03/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
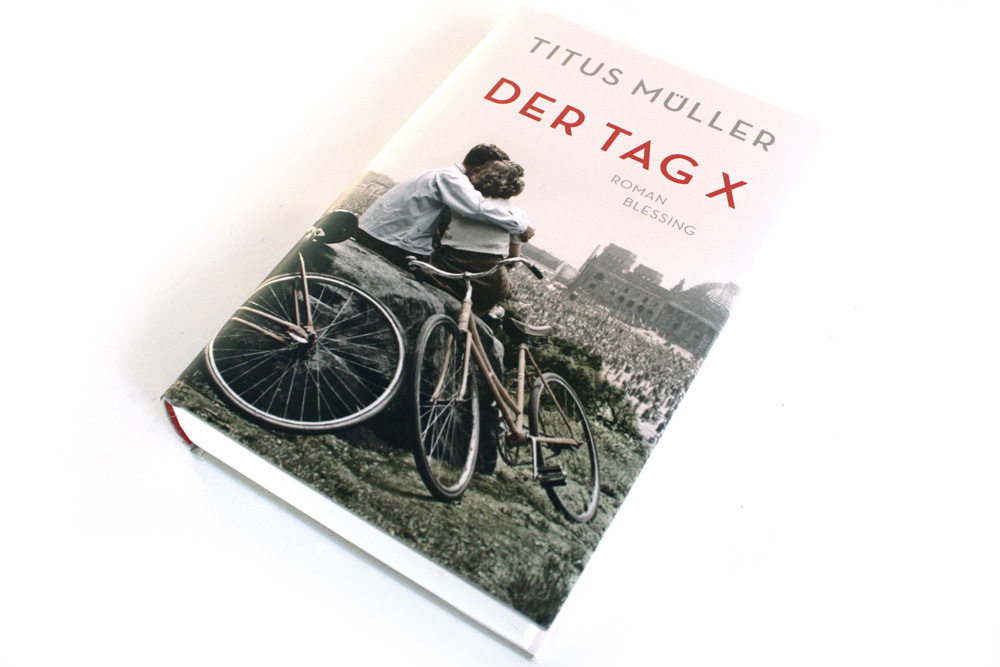








Keine Kommentare bisher