Das Thema liegt so rum in der Weltgeschichte. Man stolpert drüber. Manchmal steckt es die Reinemachefrau hinter den Vorhang, damit es keiner sieht. Denn die Herren im Nobelkabinett sind ja wieder damit beschäftigt, die Religion als Glücksbringer für eine heilsame Zukunft anzupreisen. Glaube siegt, oder so ähnlich. Aber selbst Dichter wissen es besser.
Sie leben zwar in derselben Welt der ungesiebten Informationen, Skandalmeldungen, Katastrophen und sonstiger Wohlgerüche aus schlecht gelüfteten Stuben – aber: Sie denken drüber nach.
Das ist ja der Wesenskern von Dichtung: Sich konzentrieren, ausklinken aus dem Tagesgeschwätz, die Dinge sacken lassen, sich besinnen und dem Denkapparat, den man da zwischen den Ohren trägt, die Zeit zum Arbeiten und Verdauen geben. Dichtung ist ohne Stille und Besinnung und Konzentration unmöglich. Deswegen überfordert sie so viele Zeitgenossen, die schon seit Kindesbeinen eine gewachsene Unfähigkeit haben, das Geklingel auszuschalten, das Zappeln sein zu lassen und – sich zu konzentrieren. Was auch heißt: sich einzulassen auf sich selbst und die Dinge, die passieren.
Da kommt man dann ins – Denken. Da packt das Gehirn von ganz allein Assoziationen, Worte, Bilder, Beziehungsmuster zueinander, bis etwas Ganzes und Neues draus wird. Wenn der so Nachdenkende auch noch seine eigene Sprache beherrscht, wird ein Gedicht draus. Das kommt nämlich von: gedacht. Nachgedacht. Neugedacht. Zusammengedacht. Das ist manchmal beklemmend, weil sich ja die Ängste nicht einfach auflösen, wenn man über die Dinge nachdenkt, die einem heute beim Stichwort Wissenschaft meistens zuerst einfallen (was auch schon eine Menge sagt): Atombomben, Genmanipulation, Militärforschung, Unterhaltungselektronik, Nano-Technologie, Hightech …
Wir leben in einer hochtechnisierten Welt. Und die ist ohne Wissenschaft nicht denkbar. Da steckt überall Wissen drin, menschlicher Erfindergeist. Das Ausprobieren des Möglichen und Unmöglichen, Grenzüberschreitungen. Die auch zu Vielem Nützlichen führen. Das Thema der modernen Medizin kommt immer wieder vor in den Gedichten. Mitsamt dem Stutzen, das Dichtern im Blut steckt. Denn alle Dinge, die unser Leben besser machen, haben eine Kehrseite. Die Dinge, die wir erfinden, sind allesamt auch anders verwendbar – und damit missbrauchbar.
Das Thema ist nicht neu. Es begleitet die Wissenschaft und das dichterische Nachdenken über die Grenzen der Wissenschaft von Anfang an. Deswegen kommt der Herr Dr. Faust mehrfach vor in diesem Band. Und nicht nur der. Dichter lesen noch. Anders als viele andere Menschen. Und sie wissen mit den Namen Giordano Bruno und Galileo Galilei noch etwas anzufangen. Die Fragen von heute sind ja so neu nicht. Sie sehen nur anders aus. Und entsetzt stellen Dichter immer wieder fest, dass die besten Erfindungen immer wieder in die Hände von Dummköpfen, Verbrechern und Diktatoren geraten.
Vielleicht ist es genau dieses Moment, das diesen neuen Band „Poesiealbum neu“ bedingt hat und die versammelten Autorinnen und Autoren bewegt: Dass wir eigentlich nach 500 Jahren von Immer-mehr-Wissen und Immer-mehr-Können ein Problem nicht in den Griff bekommen haben: Wie bewahren wir die gigantische Macht, die uns dieses Wissen und die daraus resultierenden Technologien geben, davor, missbraucht zu werden?
Denn das Problem sind wir selbst. Wir Menschen, die wir eben nicht immerfort logisch denken, wissenschaftlich schon gar nicht. Das beherrschen die Allerwenigsten. Aber wir konsumieren die Wohltaten, schreien nach immer mehr. Und: Wir können den Zugriff der Rücksichtlosen, Gnadenlosen und Verantwortungslosen auf das bedrohliche Arsenal nicht verhindern.
Aber wir können den Allmachtsglauben hinterfragen, der mit Wissenschaft ja auch nichts zu tun hat. Und die Dichter in diesem Band hinterfragen ihn – mal sehr emotional, mal trocken, mal ironisch. Auch weil sie sichtlich ein bisschen mehr über wissenschaftliches Denken wissen als all die technikgläubigen Großmäuler, die so gern behaupten, sie könnten alles berechnen, regelrecht besessen sind sie vom Faustschen Machbarkeitswahn, den sie den Käufern dann auch noch als ewigen Lebensborn und Lösung aller Probleme verkaufen. Nur wer dann nachfragt, bekommt dann mit, dass alle diese Aufgeblasenen glauben, ihr kleiner Technikplanet sei die Antwort auf alles. Und dabei haben sie nicht mal den zweiten Marcuse gelesen, wie Reiner Kunze zu Recht feststellt. Sie wollen alles immer einfach, kurz und schnell. Nur ja nicht nachdenken über die Abgründe menschlichen Daseins.
So wie Faust, dieses Vorbild aller Knalltüten, die immer noch glauben, es gehe um des Pudels Kern und nicht um Käthchens Kummer. Aber Käthchen ist ja nicht die einzige, mit der er kein Mitleid hat, die er eher distanziert wie ein Insektenkundler betrachtet – Lichtjahre weit von seinen eigenen Emotionen entfernt.
Nein, das ist nicht die Krankheit der Aufklärer, auch wenn das die Nimmerklaren immer wieder behaupten. Das ist die Krankheit der Technokraten, für die ihr technisches Meisterwerk immer wichtiger war als die Menschen. Diese sehr verständliche Furcht der Dichter vor den faustischen Gestalten der Gegenwart mischt sich in diesem Bändchen mit einer anderen Furcht, die eher eine Atemlosigkeit ist, ein großes Schaudern nämlich vor der Unfassbarkeit der Welt. Eine Unfassbarkeit, die uns ja gerade die Forscher an den Grenzen unserer Wahrnehmung erst richtig deutlich gemacht haben, weil sich dort alles scheinbar aufzulösen scheint in reine, oszillierende Energie. Gerade die großen Forscher und die sensiblen Dichter wissen, was auch Mascha Kaleko schon wusste: Dass Wissen oft genug eine Belastung sein kann, der Zustand der Ahnungslosigkeit aber nicht wiederzugewinnen ist, wenn man weiß.
Auch so ein faustscher Nebengedanke, den Goethe nicht zu Ende fabuliert hat: Wie viel Verantwortung Wissen mit sich bringt. Alle Welt schaut nur auf diesen Zausebart mit seinem Teufelspakt und sieht nicht, dass er schon im ersten Teil der Tragödie menschlich versagt hat. Im Zweiten interessiert dieser Allesfresser schon nicht mehr wirklich.
Und das ist so schrecklich, dass auch bei manchem Dichter schon der Fatalismus um sich greift. Denn – wie Dieter Höss schreibt: „Die Natur selbst übt Rache.“
An denen nämlich, die in ihrem Machbarkeitswahn leugnen, dass sie Teil von etwas sind, das auch ohne sie weitergehen wird. Oder mit Martina Ernst: „Ein Forscher steht und fällt mit seinem Gewissen.“ Wir wissen mehr als unsere Vorfahren in magischeren Zeiten. Aber das ist auch eine Verpflichtung. Und: Es ist nicht die Antwort auf alle Fragen, wie uns die Großmäuler immer wieder einreden. Die Fragen werden immer bleiben. Es sei denn, der vom faustschen Geist besessene Mensch schafft es am Ende doch noch: „ausrottet sich selber mit großem Erfolg“, wie Kurt Fricke schreibt. Nu ja. Übrig bleiben dann die lichtscheuen Begleiter aus unseren Küchen: „Einfach nicht totzukriegen.“
Auch eine Art Demut: So langsam zu begreifen, dass wir als Menschen diese Welt ganz dringend brauchen. Die Welt aber braucht uns nicht. Wenn wir es vergeigen, findet sie andere Wege, ihrer selbst bewusst zu werden.
Auch so ein Halbsatz für die Narren, die ohne ihre ganzen Götter nicht können: Mit uns ist es der Welt gelungen, ein Bewusstsein ihrer selbst zu entwickeln, sich selbst zu sehen, wahrzunehmen, zu staunen, zu dichten.
Na ja, und dann kommt möglicherweise ein Obertrottel und drückt einfach auf den Knopf. Man merkt hinter dem poetischen Sarkasmus da und dort auch die stille Wut auf jene, die blindlings jeder technischen Neuerung nachjagen, „statt / nach dem Warum und dem Wohin zu fragen“, wie Christoph Kuhn formuliert. Beides ja bekanntlich keine faustschen Fragen. Goethes Doppeldrama ist so aktuell wie je – vielleicht noch viel aktueller.
Aber das wissen derzeit augenscheinlich erst nur die Dichter.
Ralph Grüneberger (Hrsg.) „Poesiealbum neu: Resonanzen. Lyrik & Wissenschaft“, edition kunst & dichtung, Leipzig 2017, 6 Euro.
In eigener Sache: Lokaler Journalismus in Leipzig sucht Unterstützer
https://www.l-iz.de/bildung/medien/2017/03/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
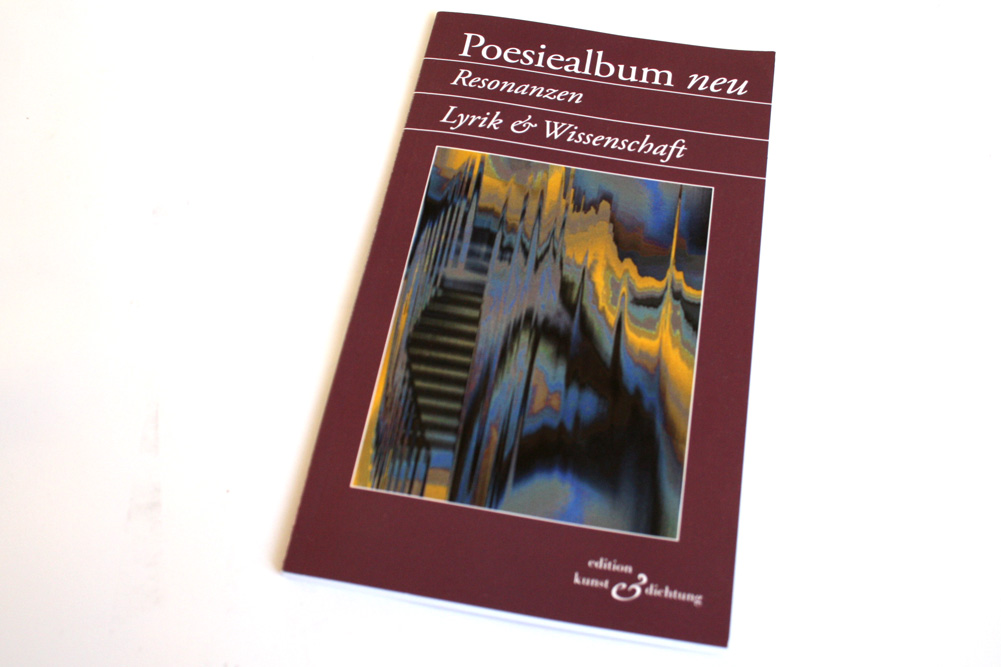








Keine Kommentare bisher