„Übersichtlich. Wissenschaftlich. Neu. Das Wörterbuch der Journalistik ist jetzt online“, meldete der Herbert von Halem Verlag kurz vorm Weihnachtsfest. Es gab also gleich mal ein schönes Online-Geschenk für „Wissenschaftler und Studierende der entsprechenden Fachrichtungen und (...) alle, die sich für Journalistik und praktischen Journalismus interessieren“. Gibt es die tatsächlich? Hat Herr Trump das alles nicht gerade für überflüssig erklärt?
Kann er doch alles selber: twittern, Youtube-Clips erstellen, auf Facebook rummosern. Wer braucht denn noch Journalisten? Eitle alte Männer, die keine Kritik vertragen und eine kritische Berichterstattung für eine Zumutung halten, natürlich nicht.
Dass unsere westlichen Gesellschaften derzeit so ins Rutschen geraten, hat auch damit zu tun, dass auch immer mehr Politiker der kritischen Auseinandersetzung in den journalistischen Medien ausweichen und ohne Beißhemmung in sogenannten „sozialen Medien“ herumtoben. Dafür brauchen sie wirklich keine Journalisten.
Aber wer hat den Journalismus eigentlich erfunden? Und wofür? Kann denn nicht jeder Mann und jede Frau einfach alles veröffentlichen, was sie wollen?
Können sie. Das war sogar vor Erfindung des Internets schon so. Journalist ist kein Beruf, den man zwingend mit Diplom, Master oder Doktortitel absolviert haben muss. Zeitungen aufmachen darf jeder. Das haben auch immer schon Leute gemacht, denen an einer seriösen Berichterstattung nie gelegen war.
Aber worum geht es?
Das ist eine Frage, der sogar Journalisten und Kommunikationswissenschaftler immer gern aus dem Weg gegangen sind.
Es gibt zwar Journalismus seit über 300 Jahren. Erfunden in einer Zeit, als sich die westlichen Gesellschaften spürbar veränderten: Immer weitere Kreise der Gesellschaft konnten lesen, Handel, Wissenschaft und Kultur überschritten Länder- und Sprachgrenzen. Und eine wachsende Schar von Menschen war regelrecht daran interessiert, verlässliche Nachrichten und Berichte aus aller Welt zu bekommen. So interessiert, dass sie auch bereit waren, dafür Geld zu bezahlen: für Zeitungen.
Vieles, was sich an den frühen Zeitungen und Zeitschriften in den Archiven erhalten hat, würde heutzutage nicht mehr als journalistisches Medium durchgehen. Journalisten mussten lernen. Sie mussten Erzählformen finden, die in der neuen, zunehmend beschleunigten Welt, funktionierten. Die Zeitungen, wie wir sie kennen, haben ihre Wurzeln im Wesentlichen im 19. Jahrhundert, wo die wichtigsten journalistischen Erzählformen entwickelt wurden. Für einen Markt. Das vergisst man gern. Für Menschen, die zwar neugierig waren, die aber selber gerade lernten, dass Zeit Geld ist und man für langweilige Texte keine Zeit verschwenden musste – zumindest, wenn spannendere Alternativen da waren.
Wer sich ein bisschen beschäftigt mit dem Metier, merkt, dass kaum eine Branche über 150 Jahre unter so klarem Konkurrenzdruck gearbeitet hat wie der Journalismus. Spannung, Geschwindigkeit und Unterhaltungswert bestimmten darüber, ob ein Medium gekauft und gelesen (später auch geguckt und gehört) wurde – oder nicht. Und Abwechslung natürlich und guter Stil und Tiefe und Professionalität und …
Im späten 19. Jahrhundert bekamen die klügeren Köpfe in dieser Branche durchaus mit, dass es nicht reichte, die langen Episteln von schreibenden Pfarrern und Lehrern zu veröffentlichen. Das lasen dann auch Lehrer und Pfarrer nicht mehr. Journalisten taten gut daran, sich zu professionalisieren und journalistische Standards zu entwickeln.
Oder zu lernen. Dass man Zeitung machen ausbilden konnte, das war dann eine Idee des Leipziger Ökonomie-Professors Karl Bücher. Ein Mann, der durchaus begriff, das Medienmachen auch etwas mit Wirtschaft und Ökonomie zu tun hat, Journalisten aber auch etwas wissen sollten über die Ökonomie ihres Tuns. Und über das Tun selbst.
Wer einmal in einer alten ehrwürdigen Printzeitungsredaktion gearbeitet hat, weiß, dass das ein Arbeiten unter Zeitdruck ist, dass man platz- und ressourcensparend schreiben musste, termingerecht und trotzdem so, dass die Leute am nächsten Tag die Zeitung lasen mit einer Gier aufs Neue, die heute scheinbar ins Fernsehen und ins Internet abgewandert ist. Scheinbar.
Dabei vergisst man oft, dass Geschwindigkeit an sich kein Wert ist (außer bei Katastrophenwarnungen), dass Berichterstattung ein komplexer Vorgang ist, der immer auch mit Überprüfung der Fakten und des Wahrheitsgehalts zu tun hat. Das war auch schon zu Büchers Zeit so. Und deshalb war es ein Quantensprung, als er 1916 an der Universität Leipzig das erste Institut für Zeitungswissenschaft aus der Taufe hob. Mit dem glasklaren Anspruch, das Niveau des Journalismus in Deutschland deutlich zu heben.
Wer die Publikationen von vor 1914 und nach 1920 in Deutschland vergleicht, spürt den Quantensprung. Nicht überall. Aber in den besten Blättern der jungen Republik. Der liberale Journalismus der Weimarer Republik hat Maßstäbe gesetzt. Und Leute geärgert. Die Prozesse gegen Journalisten wegen „Staats- und Geheimnisverrat“ waren spektakulär. Und sie gingen in der Regel gegen die Journalisten und Redakteure aus, die so mutig waren, den Mächtigen hinter die Schleier zu schauen. Auch Leipziger Zeitungen profitierten von diesem Qualitätssprung.
Das Institut gibt es noch immer, auch wenn es heute anders heißt und mit einem Studienfeld zusammengeschmissen wurde, das mit Journalismus nichts zu tun hat: Public Relations.
Der Journalistiklehrstuhl wurde dafür ein Stück weit eingedampft. Gefeiert hat man das 100-jährige trotzdem. Und man ist sich seiner Geschichte auch sehr bewusst. Selbst im Lexikon des Herbert von Halem Verlags wird das gespiegelt. Gerade in der Zeit, als das Institut als Ausbildungsstätte knallroter Parteijournalisten verschrien war, beschäftigte man sich um so intensiver mit den Arbeitsweisen und Genres des Journalismus, schuf also ein theoretisches Repertoire, das weite Teile dieses Berufsfelds erst einmal übersehbar und fassbar machte. Wer gelernt hat, wie eine Glosse, eine Reportage, ein Porträt zu schreiben sind, der rätselt an seiner Schreibmaschine oder Computertastatur nicht mehr darüber nach, wie er nun anfängt, den ganzen Stoff organisiert, was er erzählt, komprimiert oder weglässt. Der beherrscht sein Handwerk – vom Recherchieren über das Abgleichen, Absichern und Verdichten bis hin zum Stil.
Was ja die Tragik des Instituts in DDR-Zeiten war: Man durfte zwar forschen, wie das alles geht. Nur in der Praxis war es höchst unerwünscht. Außer in ein paar Nischenprodukten, nach denen die DDR-Bürger Schlange standen – der „Wochenpost“ zum Beispiel.
Das Wissen ist nicht weg, auch wenn die Autoren des Lexikons bedauern, dass Journalistik-Lehrstühle im Westen sich eher ungern mit den ganzen Feinheiten der Genres beschäftigen. „Im deutschen Sprachgebiet sind journalistische Genres am intensivsten in der DDR von Wissenschaftlern der Sektion Journalistik der Karl-Marx-Universität Leipzig erforscht und in der Journalistenausbildung gelehrt worden“, kann man nun im Online-Lexikon nachlesen. „Der dortige Wissenschaftsbereich Sprache und Journalismus hat eine reichhaltige Literatur über stilistische Merkmale von Genres hervorgebracht, wobei man durchaus ihre kommunikative Funktion im Auge hatte. Nach 1989 versiegte die Leipziger Genrelehre. In der Kommunikationswissenschaft des vereinten Deutschlands ist es nur vereinzelt zu Anknüpfungsversuchen gekommen. Ähnlich unproduktiv war schon die wissenschaftliche Literatur über journalistische Textgattungen in der Bundesrepublik Deutschland vor 1990.“
Das ist schon schöner derber Tobak. Aber wer sich durch die jetzt schon online nachlesbaren Stichworte des Lexikons klickt, der merkt, dass Journalismus, wenn man ihn erst mal in Stichworte fassen will, tatsächlich eine Wissenschaft ist. Eine sehr umfangreiche mittlerweile, in der oft genug (leider auch in Sachsen) das technische Spielzeug über die Erzählqualität und die Robustheit des Inhalts triumphiert. Oft auch der ökonomische Faktor dafür sorgt, dass am Ende gar keine journalistischen Tugenden mehr sichtbar sind.
Aber darüber verzagen auch Journalisten nicht, die ausführliche Artikel für ein Journalistik-Lexikon schreiben. Denn sie wissen, dass der Grundantrieb eines guten Wissenschaftlers eigentlich genau derselbe ist, der auch Journalisten umtreibt. Man stellt sich Fragen, von denen man weiß, dass die Antwort spannend sein könnte. Und dann legt man los.
So ungefähr, wie es der Verlag jetzt zum online gestellten Lexikon formuliert: „Welche Veränderungen erfuhr der Journalismus in den über 300 Jahren seiner Existenz? Was bedeutet es, einen Artikel kalt zu schreiben? Wie weit geht Satirefreiheit? Was hat ein Küchenzuruf mit Journalismus zu tun? Ist die klassische Zeitung aus Papier bald passé? Nicht auf alle Fragen finden sich leichte Antworten, aber sie zu stellen, ist dennoch Pflicht. So lautet die Maxime: Das Journalistikon kann vielleicht nicht die Welt erklären, aber zumindest den Journalismus, der das Verständnis von Welt prägt.“
Deswegen findet man zwar Vieles und auch Etliches, was erst einmal verwundert, weil es Aspekte an diesem Beruf zeigt, die im Alltag selten bedacht werden – wie das Mediensystem (ja, wir haben eins, ein sehr komplexes und fast unübersichtliches), Berufsethik oder Jargon. Anderes ist noch Baustelle. So findet man zwar die Genres Nachricht, Reportage und Interview. Dafür fehlen solche Späße wie Glossen, Kommentar, Porträt, Rezension oder Feuilleton noch.
Aber es ist nun einmal ein Lexikon, an dem weitergearbeitet wird, wie der Verlag betont: „Besonderen Wert wird auf den wissenschaftlichen Charakter der Beiträge sowie die stetige Aktualisierung der Website gelegt. Diverse Suchmöglichkeiten erleichtern außerdem den Zugang zu den wissenschaftlichen Kurzartikeln, die in 19 Kategorien wie Arbeitstechnik, Redaktionsorganisation und Jargon unterteilt sind. Ausführliche und aktuell gehaltene Informationen zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Biografien journalistischer Persönlichkeiten komplettieren das Angebot. Auch bietet das digitale Journalistikon, anders als ein Print-Wörterbuch, die Möglichkeit, die Kurztexte in Zukunft mit Darstellungen, Videos und Kommentaren zu veranschaulichen.“
Das ist dann quasi eine Art Geburtstagsgeschenk zum 100-jährigen der universitären Journalistenausbildung.
Ob es wirklich praxisnah ist, kann nur einschätzen, wer selbst im Metier steckt und mal schauen will, was die Wissenschaftler dazu zu sagen haben. Denn andererseits ist der ganze Laden ja im Fluss, verändern sich Arbeitsmethoden und Veröffentlichungsplattformen. Und ein paar Großmäuler laufen draußen rum und wettern über die Medien mit aller Leidenschaft, weil gute Medien immer auch ärgern – vor allem Leute, die sich nicht ins Geschäft und die Karten gucken lassen wollen.
Denn das ist der stille Kern von Journalismus – immer noch: die akribische Suche nach Fakten, Hintergründen, Motiven und Heimlichkeiten. Denn es war nicht nur der Markt (wie im Lexikon zu lesen), der Journalisten dazu brachte, spannende Erzählformate zu entwickeln. Es war auch das knisternde Zusammenspiel von Macht und Bürgerschaft, von mächtigen Eigeninteressen und dem (für Journalisten selbstverständlichen) Recht aller Bürger, über alles, was sie angeht und angehen sollte, auch jederzeit so genau und treffend wie möglich informiert zu werden. Manchmal trifft man dabei nicht nur ins Schwarze, sondern auch dahin, wo es wehtut. Und das hat nichts mit den Kraftmeiereien der Blondierten auf Twitter & Co. zu tun, sondern mit akribischer, ernsthafter Arbeit. Und – ein bekannter Herausgeber hat das ja so gern gesagt: Fakten, Fakten, Fakten.
In eigener Sache: Für freien Journalismus aus und in Leipzig suchen wir Freikäufer
https://www.l-iz.de/bildung/medien/2016/11/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
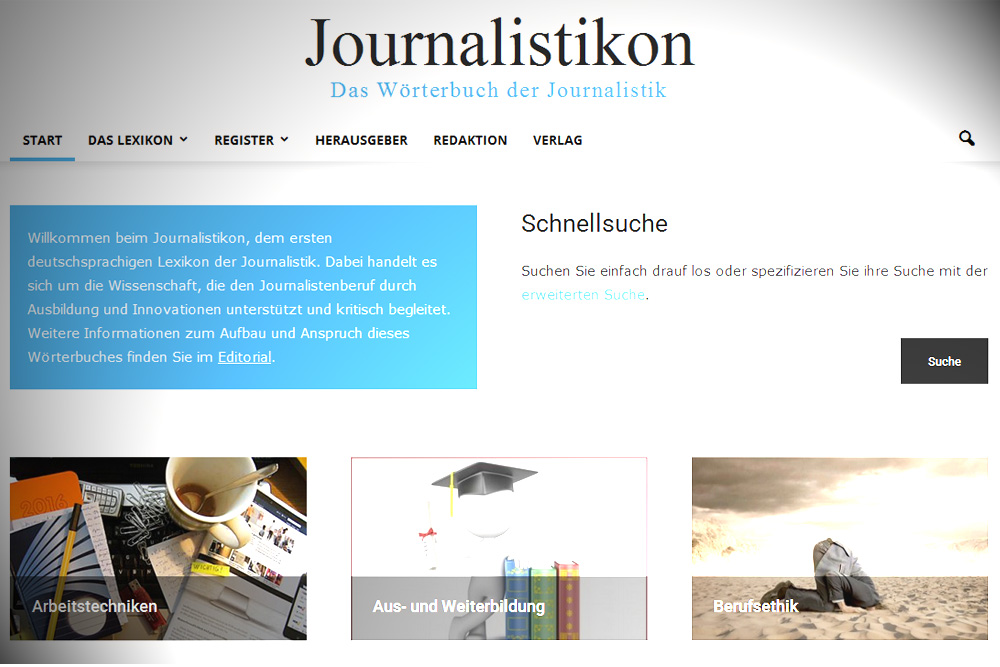








Keine Kommentare bisher