Wenn Michael Hametner so ein Buch über einen Leipziger Maler schreibt, dann geht er immer wieder um das Objekt seiner Neugier herum, grübelt, wägt ab, versucht zu verstehen. Man merkt die ganze Zeit, dass hier einer aus einem anderen journalistischen Metier (der Literatur) kommt und dass er auf Kunst mit den seltsamen Augen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schaut. Die Schubladen sind allgegenwärtig.
Ohne scheint es nicht zu gehen. Ist Gert Pötzschig, der mittlerweile 85-jährige Meister der prächtigen Stadt, wie ich ihn mal gar nicht vorsichtig nenne, nun ein Traditionalist? Einer, der mit der Moderne hadert? Ist er Vertreter einer Generation, die von jüngeren Generationen nicht mehr wahrgenommen wird? Reden die Generationen wirklich nicht miteinander? Und wie ist es mit der Kunstwahrnehmung in Leipzig, wo augenscheinlich nur noch wahrgenommen wird, was international für Sensation sorgt?
Es sind nicht die einzigen Fragen, die sich Hametner stellt. Aber sie lassen ahnen, wie man auch im Öffentlich-Rechtlichen die ganze Zeit tickt. Da erlangt nur Aufmerksamkeit, was (scheinbar) Erfolg hat. Da muss man nicht mit „der Zeitung in dieser Stadt“ anfangen. Wenn die nicht berichtet, bleibt die Kunstausstellung leer. Und wenn der Sender nicht berichtet …
Berichtet der Sender überhaupt? Wäre mir neu, dass der MDR wirklich eine kluge, umfassende Berichterstattung über das Kunstgeschehen und die Künstler im Dreiland hätte. Derlei entsorgt man gern in Spartenkanäle. Im Hauptprogramm findet man es nicht. Was mit der redaktionellen Sicht solcher Sender auf Kunst und Kultur zu tun hat: Man nimmt einfach an, das interessiere das breite Publikum nicht.
Obwohl das Problem nur ist: Man interessiert das Publikum nicht dafür. Man tut gern so, als sei das schwere Kost, hochgeistig, nur einem elitären Mitternachtspublikum zuzumuten. Da sendet man lieber Fußball aus der Kreisliga … weil man das nicht erklären muss. Keine neuen erzählerischen Formen finden muss. Man bleibt im Trott.
Und so müht sich Michael Hametner auch in diesem Buch ab an den schweren Brocken, an der Einordnung eines Malers, der eigentlich so unverstellt vor uns steht wie kaum ein anderer Leipziger Maler. Der 1955 beschlossen hat, dass er sich in keinen Funktionärsbetrieb einpassen will, dass er frei sein will und unabhängig. Freier auch als die großen Berühmten von Heisig bis Mattheuer.
Kein Unterordnen im Hochschulbetrieb – lieber das Risiko, sich mit Auftragsarbeiten und am Rand des staatlich reglementierten Kunstbetriebes durchschlagen zu müssen. Ein Risiko, auch gerade in der DDR. Ein Balanceakt, den viele talentierte Künstlerinnen und Künstler, die in Leipzig studiert und gearbeitet haben, unterschiedlich bewältigt haben.
Gert Pötzschig hat sich für den eigenen Weg entschieden, abseits der Hierarchien und guten Verdienstmöglichkeiten im offiziellen Kunstbetrieb. Schnell hat sich für ihn herausgestellt, dass die Landschaftsmalerei seine Stärke ist. Und wer seine eindrucksvollen Ausstellungen sah – 2008 im Stadtgeschichtlichen Museum oder aktuell in der Galerie Koenitz – der weiß auch, wie irreführend das Wort Landschaftsmalerei mittlerweile ist. Und wie kontaminiert.
Und zwar weit über Michael Hametners Versuch, die Abwertungen innerhalb der malerischen Genres zu beschreiben. Das kennt man auch aus der Literatur: ganz oben der gedankenträchtige Professorenroman, darunter das klassische Drama und ganz unten irgendwo die „armen Schweine“, die Gedichte und Kurzgeschichten schreiben.
Eine Wertung, die nicht nur der deutsche Bildungskanon immer wieder vermittelt, sondern die auch das Feuilleton pflegt, einfach weiterführt aus Zeiten, als näselnde Professoren selbst in der Kunst unbedingt hierarchische Wertungen einführen mussten. Seitdem rangiert der theatralische Historienschinken ganz oben. Landschaften gelten eher als Wohnzimmerschmuck und verschwinden im Fundus des Museums.
Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis aus diesem Buch, das eigentlich eine schöne Hommage ist: Es ist noch immer so. Und Museumsdirektoren ticken auch noch genauso. Große Ausstellungen macht man mit „anspruchsvoller Staatskunst“. Logisch, dass die Besucher auf diese Weise auch nicht wirklich sehen lernen.
Das, was Michael Hametner in seinem Buch mit einer sehr, sehr langen Erörterung um den Ausruf „Das ist einfach schön!“ versucht zu fassen.
Obwohl es gerade bei Pötzschig so offensichtlich ist – ohne dass man wieder die ganze Diskussion aufmachen muss um Farben und Gefühle oder die Wichtigkeit von Technik. Obwohl Pötzschig natürlich recht hat: Künstler sind gut beraten, technisch auf höchstem Niveau ausgebildet zu sein. Und diese Ausbildung war auch immer eines der Pfunde, mit denen die HGB wuchern konnte.
Wer die Technik aus dem Effeff beherrscht, ist frei. Der kann das tun, was dann erst zu Bildern wird, vor denen der Besucher steht, staunt und verblüfft ist. Oder zutiefst berührt. Weil gute Maler nämlich schaffen, dass die Betrachter ihrer Bilder tatsächlich mit ihren Augen sehen. Was vielen scheinbar nicht einmal bewusst ist, auch weil sie über das Sehen selbst nie nachdenken. Man guckt ja nur so in der Weltgeschichte herum.
Stimmt nicht, sagt jedes einzelne Bild von Pötzschig: Man schaut immer mit dem eigenen Sensorium für Raum, Stimmung, Farben und Dramatik. Und das tut man jeden Tag – aber augenscheinlich tun es die meisten nicht aufmerksam. Sie merken nicht auf, sondern sind nur im Strom. Und werden auch nicht munter, wenn Orte, Tageszeiten und Lichtverhältnisse sich zu etwas Besonderem verdichten.
So wie in Pötzschigs Leipzig-Bildern, die ja auch deshalb so beeindrucken, weil sie auf die üblichen Sehenswürdigkeiten verzichten und damit deutlich machen, dass anderes mindestens genauso des Sehens würdig ist. Und erkannt wird, wiedererkannt wird – egal, ob eine abgelegene S-Bahn-Station, eine verfallende Fabrik, ein Hinterhof, eine Straße im Randgebiet. Die Bilder entfalten ihre Wucht auch deshalb, weil die Orte gerade durch ihre scheinbare Abgelegenheit erstaunlich vertraut wirken.
Als wäre man schon öfter dagewesen – und manchmal war man es auch. Aber man erkennt den Ort nicht am Straßenschild oder einem der üblichen „markanten“ Gebäude, sondern am Licht, an Raumeindruck der Straße, an dieser Art Trost-Losigkeit, die auch keinen Trost braucht, weil das Leben hier nicht spektakulär sein muss. Dafür sichtbar.
Pötzschig liebt die „gebrauchten“ Orte, die ihr Alter und ihr Benutztwerden nicht verbergen. Und so sieht er auch die ganze Stadt, wenn er auf den Scherbelberg steigt oder von der Dachterrasse herabschaut auf das Dächermeer. Sein Leipzig hat mit dem Vorzeige-Leipzig der Hochglanzbroschüren nichts zu tun. Die Stadt ist das Spiegelbild ihrer Bewohner, eine arbeitende Stadt. Eine Stadt in gedeckten Farben unter zuweilen sehr dichten Himmeln. Und Pötzschigs Himmel sind dicht und haben Substanz. Er malt nie ein Himmelblau, das immer wirkt wie inszeniert. Keine Postkarten-Bilder.
Was Hametner gern betont. Es passiert etwas anderes. Und das wirkt auch deshalb vertraut, weil es dem Betrachter sein eigenes Sehen greifbar macht. Diese Landschaften wirken deshalb so stark, weil sie mit den Bildern korrespondieren, die wir selbst wahrgenommen haben. Oft nur beiläufig, beeindruckt von Ort und Stimmung, aber nicht sonderlich euphorisiert. Momente, die besonders dicht sind, frappieren, würde wohl ein französischer Impressionist dazu sagen.
Und deshalb ist natürlich Pötzschigs Nähe zum Impressionismus unübersehbar, diesen Stil zu malen, der eben keine Mode war, sondern eine Entdeckung. Die Entdeckung, dass mit Pinsel und Farbe etwas zu schaffen ist, was selbst Hightech-Kameras nicht hinbekommen: Uns die Welt bildhaft zu machen, wie wir sie tatsächlich – oft nur beiläufig und im Augenwinkel – erleben. Das, was man oberflächlich eben Eindruck nennen könnte. Sofern wir uns überhaupt noch von irgendetwas beeindrucken lassen. Wozu man sich Zeit nehmen muss und die Bereitschaft, nicht immer nur nach Sensationen zu jagen. Sondern stehen zu bleiben und die Welt auf uns wirken zu lassen.
Und das geht selbst in Leipzigs ramponiertesten Seitenstraßen. Das geht auch im sonnigeren Süden mit seinen beeindruckenden Stadt- und Landschaftsräumen, die Pötzschig ebenso emsig skizziert und gemalt hat. Mit dem unübersehbaren Talent des Malers, der spürt, wann ein Ort, eine Situation sehenswert sind. So dicht, dass man das im Bild festhalten muss. Und die Botschaft lautet eigentlich – auch das nicht zu übersehen: So dicht und greifbar ist unsere Welt. Und alles ist Farbe, unser Leben ist ein einziges Dasein in fetten, irdischen Farben. Man möchte zugreifen oder einfach hineingehen.
Selbst am Ende des Buches hadert Michael Hametner noch mit dem von ihm mitgebrachten Problem von Tradition und Moderne und der Kunst-Konsum-Mentalität von „Museumsdirektoren, Kuratoren, Galeristen, Kritikern und Käufern“, womit er in gewisser Weise recht hat. Aber gerade die Käufer von Pötzschigs Bildern kümmern sich sichtlich seit Jahren nicht um die Albernheiten des Kunstmarkts.
Sie wissen das dicht gemalte Dasein in Pötzschigs Bildern zu schätzen. Und wahrscheinlich haben sie auch nicht mal Probleme, ihr eigenes Weltanschauen darin wiederzufinden. Was wirklich fehlt, ist tatsächlich die mediale Wahrnehmung all dessen, was in Leipzig an Kunst geschaffen wird. Was nicht zur Sensation wird, findet kaum Widerhall.
Aber das ist ein eigenes Thema und geht weit über das nun deutlich auch als Lebenswerk wahrnehmbare Schaffen Gert Pötzschigs hinaus.
Valeurs: Valeur ist in der Malerei der Tonwert, die Abstufung von Licht und Schatten.
Michael Hametner Gert Pötzschig. Valeurs, Sax Verlag, Beucha und Markkleeberg 2018, 29,80 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
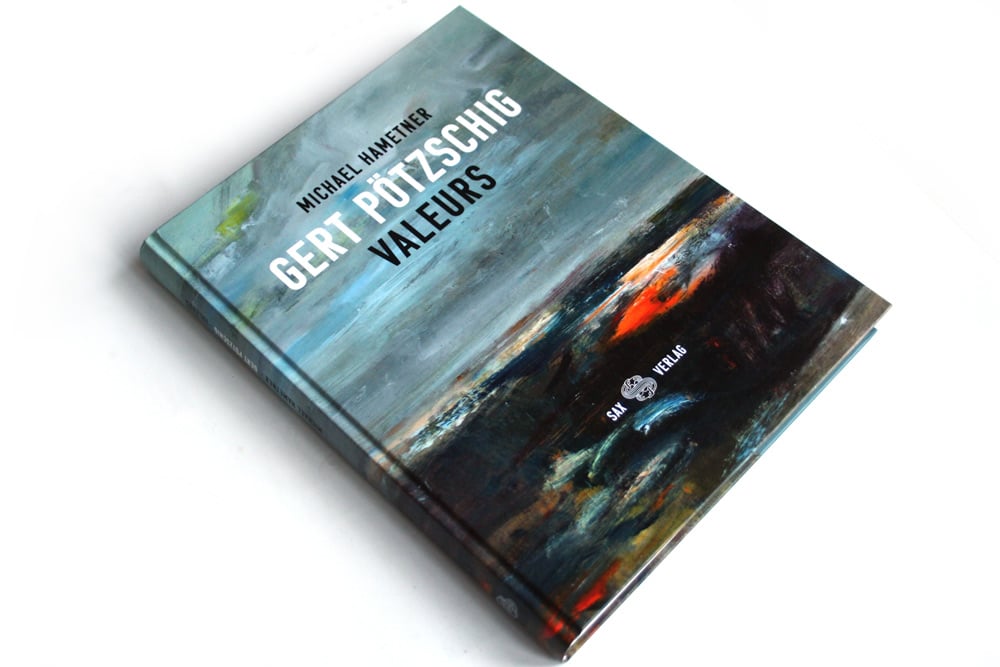


















Keine Kommentare bisher