Können Autoren aus Südosteuropa keine Romane schreiben? Oder liegt es doch eher an der besonderen Sicht des Leipziger Literaturverlages auf die Literaturen des Ostens, der vor allem das Besondere, Avantgardistische sucht? Und dabei auch auf Stoffe stößt, die eher in das große Reich der Novelle gehören. Wie auch diese Geschichte über Pista Petrovic, dessen Problem es tatsächlich nicht ist, dass er Hermaphrodit ist.
Dieser Fakt verstärkt nur seine Rolle als Außenseiter, die der Leser ganz aus der Perspektive des gescheiterten Studenten und Lebenskünstlers erlebt, dem es nie gelungen ist, sich wirklich von seinen Eltern abzunabeln und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dazu fehlt ihm irgendwie die Energie, das Selbstbewusstsein, der Wille. Das Bernardi-Zimmer, das im Titel steht und das am Ende der Geschichte noch seinen Besitzer wechselt, steht dabei nicht einmal ersatzweise für irgendeine Art Lebensinhalt. Als wäre der junge Mann völlig aus der Zeit gefallen und lebte seit seiner Jugend nur noch ein Leben als Zuschauer, der die Kraft nicht aufbringt, sich dem eigenen Leben zu widmen.
Und damit füllt er eigentlich eine Rolle aus, die wahrscheinlich viele junge Menschen im Europa der Gegenwart so erleben, nicht nur in Serbien, das Anfang der 1990 völlig aus der Zeit geschleudert wurde, als die lange Agonie des Vielvölkerstaates Jugoslawien in einen veritablen Bürgerkrieg ausartete, der nicht nur die Teilrepubliken auseinander riss, sondern auch ganze Familien. Auch Pistas Familie: Sein Vater, eben noch Offizier in der jugoslawischen Armee, landet auf einmal auf einem Posten in der Armee des verfeindeten Kroatiens. Pistas Mutter ist völlig aus dem bürgerlichen Leben ausgestiegen und lebt in einer Hippie-Kommune. Nur Pista verwaltet irgendwie noch die Reste der alten Existenz – die Armeewohnung des Vaters und das von den Eltern erworbene Designerzimmer, das Pista in seinen wilden Phantasien dem berühmten Designer Bernardo Bernardi zuschreibt und wie ein Heiligtum hütet, während Pistas Kumpel und Freunde die Wohnung in Beschlag nehmen und am Ende sogar Pista verdrängen, der sein Leben so hinnimmt, als müsse man nur die Anderen alle mache lassen.
Selbst das Erlebnis eines Wettrennens mit einer rothaarigen Schönheit auf der Küstenstraße, bei dem er zusah, wie sie mit dem Mercedes die Leitplanke durchbrach und ins Meer stürzte, reißt Pista nicht aus seiner Beobachterrolle. Als ginge ihn das alles nichts an, als wäre das nur eine Szene aus einem fremden Film, die nur vage vielleicht eine Beziehung zu seinem eigenen Leben hat. In diese Legende gehört auch das Wrack des hellblauen Mercedes, das eines Tages auf dem Parkplatz vor Pistas Wohnung steht und in dem er zu übernachten beginnt. Oder vielleicht besser: irgendwie die Zeit und die Nächte zu verbringen, nicht einmal wartend auf irgendetwas, nur immerfort neue Varianten seines Lebens erfindend und der möglichen Fingerzeige, die in solchen Dingen wie dem Mercedes-Wrack oder den eingepackten Bernardi-Möbeln stecken könnten.
Tatsächlich entfaltet sich nicht einmal eine greifbare Handlung, denn Pista lässt sich treiben. Und was die Seiten füllt, sind vor allem ausschweifende Reflexionen über sein Dasein, die Botschaften, die er in den Dingen vermutet, und die Unmöglichkeit, sich selbst zu begreifen. Zeitweilig kapriziert er sich sogar darauf, verrückt zu sein und macht das im inneren Monolog so überzeugend, dass man schon fast vermuten möchte, die Geschichte endet damit, dass der Junge von zwei kräftigen Burschen in eine Zwangsjacke gesteckt und in die geschlossene Anstalt verfrachtet wird.
Aber so weit kommt es nicht. Denn wirklich verrückt ist er ja nicht. Nur scheint nichts, wirklich nichts ihn aus seiner Lethargie reißen zu können, nicht die Kündigung der Wohnung, nicht die Begegnung mit der Polizei, nicht einmal die Nachricht, dass sein Vater tot ist. Als fände all das jenseits seiner eigenen Welt statt, jenes fast ausschweifenden Dialogs, den er mit sich selber führt. Oder über sich selbst. Denn auch wenn er mittenmang behauptet, ein innerer Monolog sei gar kein Monolog, sondern immer ein Dialog, zeigt die von Slobodan Tisma gewählte Erzählweise, dass ein Monolog auch dann noch ein Monolog bleibt, wenn ihn einer über sich selbst führt, um immer neue Erklärungsmuster für die eigenen Handlungsweisen zu finden.
Das beunruhigt beim Lesen schon. Denn da scheint es tatsächlich nichts zu geben, was diesen jungen Burschen irgendwie mit der Welt verbindet, was ihn interessiert oder auch nur zur Reaktion zwingt. Nicht-Handeln wird zum Treibstoff einer Spirale, die Pistas Leben immer mehr aus dem Rahmen rutschen lässt. Er benimmt sich wie Treibgut, das nicht weiß, wohin es sich treiben lassen soll. Nicht einmal die Geschlechtsumwandlung, die ihm abgeschlagen wird, scheint ihn wirklich zu interessieren, auch wenn er dem stockkonservativen Arzt gesagt hat, er wäre gern eine Frau. So gesehen steht sein Dasein als Hermaphrodit auch für das Unentschlossensein, das Nirgendwo-wirklich-Dazugehören.
und so steht Pista wohl auch stellvertretend für eine ganze zu Treibgut gewordene Jugendgeneration. Nicht nur in Serbien. Vielleicht sogar für eine ganze Reihe europäischer Generationen, die mit einer Welt konfrontiert sind, deren alte Erklärungsmuster nicht mehr tragen – und die aber auch keine neuen zu bieten hat. Wenn man denn nicht zu den neuen Karrieristen und Geschäftemachern gehören will, die aus den Strandgütern der Neuzeit auch noch Profit schlagen – wie der emsige Mitar Jovanic, der am Ende das Bernardi-Zimmer kauft. Wenn man das denn kaufen nennen will.
Der Klappentext verspricht zwar, dass es für Pista Petrovic sogar so etwas wie eine Erlösung aus der Sinnlosigkeit seines Daseins gibt. Aber so richtig nach einer Erlösung liest sich letztlich seine Ankunft in der Hippie-Kommune seiner Mutter auch nicht. Eher wie ein letzter Schachzug, mit der er das alte Spielfeld verlässt, auf dem er keine Rolle gefunden hat, die irgendwie zu seinem Befinden gepasst hätte.
Erlösung ist es eher in einem erzählerischen Sinne: Dass Tisma seinen Helden nicht völlig vor die Hunde gehen lässt, sondern am Ende zumindest noch eine Option offen lässt. Nicht genug, für einen richtig dichten Roman, aber genug für eine novellistische Lösung, ein bisschen symbolisch, aber kein Happyend.
Slobodan Tisma “Das Bernardi-Zimmer”, Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2015, 16,95 Euro
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
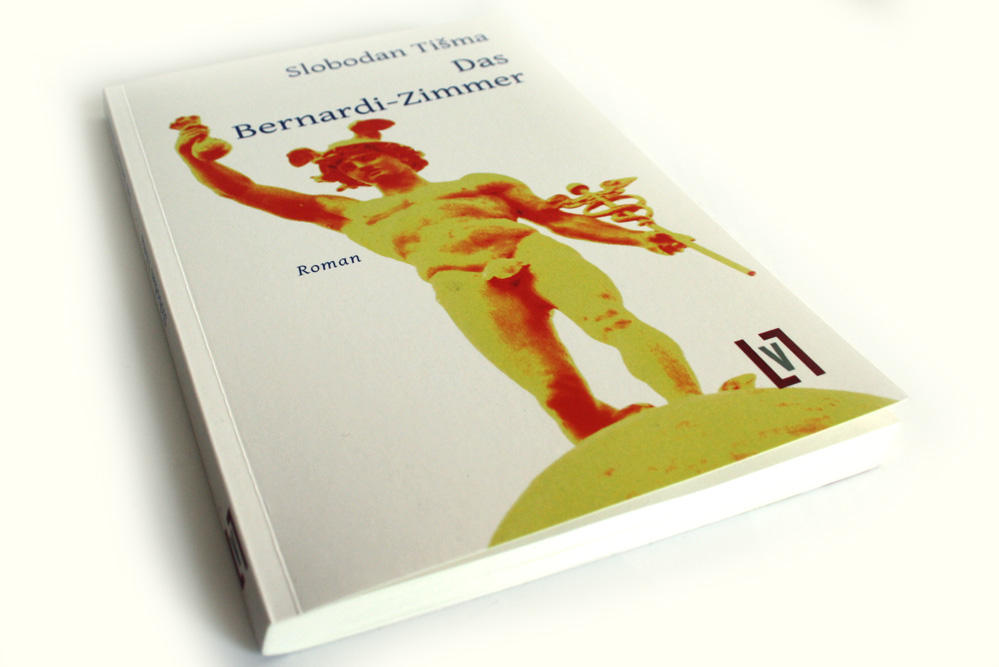








Keine Kommentare bisher