Na ja, zu Grüezi, Moin und Servus erfährt man in diesem Bändchen nichts. Aber diese Grußformeln machen natürlich heute noch sichtbar, dass im deutschen Sprachraum keineswegs überall dasselbe gesprochen wird. Auch wenn die Dialekte und Idiome überall auf dem Rückzug sind. Während Dialektwörtbücher praktisch nur noch Vergangenheit abbilden, zeigt dieses Studienprojekt, wie sich Sprache ganz gegenwärtig verändert. Denn es ist ein Studienprojekt.
Federführend sind der Fachbereich Germanistik an der Universität Salzburg und das Département de Langues et Littératures modernes an der Université de Liège, wo mit Prof. Dr. Stephan Elspaß und Prof. Dr. Robert Möller auch die federführenden Wissenschaftler tätig sind, die erforschen, wie sich die deutsche Alltagssprache verändert. Denn sie verändert sich. Seit 2003 schon werden in immer neuen Runden immer mehr Bewohner des deutschen Sprachraums dafür gewonnen, zu ihrem täglichen Sprachverhalten online Auskunft zugeben. Über die Plattform des „Spiegel“ erreichte man in der jüngsten Runde über 700.000 Teilnehmer an 18.000 Orten in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg.
Das ermöglicht nicht nur die Erstellung von kleinteiligen Karten, die zeigen, welcher Wortgebrauch in welcher Gegend üblich ist. Da man auch auf ältere Daten zurückgreifen kann, kann man auch etwas zeigen, was der einzelne Sprecher des Deutschen meist gar nicht mitbekommt. Denn Sprache verändert sich. Sie wandert mit ihren Sprechern. Gerade große Städte spielen eine wichtige Rolle in der Veränderung des Sprachgebrauchs, denn sie sind regelrechte Motoren auch in der sprachlichen Modernisierung. Hier ist der Druck am größten, sich klar verständlich zu machen, also die Strukturen der Hochsprache zu übernehmen. Und damit oft auch ganze Wörter. Das fällt sogar in Sachsen auf, diesem seltsamen kleinen Land rechts außen auf der Landkarte, wo scheinbar ein paar Leute dafür streiken, dass sich ja nüscht ändert.
Tut es aber doch. Vielleicht ist das das, was die Leute hinter Dresden so verängstigt: Dass sich selbst die Sprache verändert. Da versteht man ja nüschte mehr. Man bekommt so ein Gefühl von Nicht-mehr-Herr-im-eigenen-Haus sein. Wo sind denn nun die Pantoffeln?
Weg sind sie. Oder waren es eben noch Schlappen? Oder hat man schon immer Latschen gesagt? So wie in der ganzen ehemaligen SBZ? Man kommt ins Grübeln, denn anderswo sind diese Worte noch im Schwang. Aber seit wann sind sie es in Leipzig nicht mehr? Oder waren sie es nie?
Dass man hier als junger Mensch Katschie gesagt hat und nicht Katapult, das scheint fest im Erinnerungsspeicher zu stecken. Und trotzdem zeigt das Befragungsergebnis: Man lebt mitten in einem riesigen Gebiet, wo die Kinder augenscheinlich Katapult sagen zu dem, was man eigentlich sonst eher als Zwille bezeichnet hätte. Zumindest etwas weiter westlich in Thüringen und Sachsen-Anhalt sagen sie es noch so.
Manchmal erkennt man an der Verteilung bestimmter Worte noch alte Landesgrenzen. Aber auch alte Dialektgrenzen. Bis weit ins 20. Jahrhundert waren einige Dialekte ja noch sehr lebendig. Das norddeutsche Platt genauso wie die hessischen, bayerischen oder rheinländischen Einschläge. Wobei im Rheinland schon seit Jahren ein Prozess im Gange zu sein scheint, der die alten Dialekte verschwinden lässt. Die Karnevalsübertragungen im Fernsehen wirken ja mittlerweile wie die Berichte über den Umzug von Randexoten. Kein Willy Millowitsch kann noch vermitteln, dass der rheinische Zungenschlag heute noch en vogue ist.
Woran – die Karten zeigen es – auch hier die großen Städte die Schuld tragen. Sie sind wie Turbomotoren, die die sprachlichen Modernisierungen vorantreiben. Denn darum geht es ja meist. Dialekte trugen einst die Abgrenzung in sich, das Deutlichmachen, wer Heimischer und wer Fremder war. Am Zungenschlag erkannte man den Nicht-Dazugehörenden. Was heute zwar manchmal auch noch so ist. Aber tatsächlich strahlen die großen Städte ab. Auch die Provinz will dazugehören.
Manchmal sind es die Schulen, die den Kindern schon das ordentliche einheitliche Sprechen und Schreiben beibringen und damit auch sprachliche Vereinfachungsprozesse aufhalten, wie die vier Autoren am Beispiel der Aussprache von Fünfzehn deutlich machen. Fuffzehn würden wir sagen und schreiben, wenn es nach Goethe gegangen wäre. Fuffzehn sagen die Sachsen, meint zumindest die Karte auf Seite 158. Komisch nur, dass die meisten Leute hier eher Fümfzehn sagen, das gar nicht auf der Karte erscheint – aber zumindest im Text erwähnt wird. Denn in den Texten zu den farbenreichen Karten erläutern die Autoren, woher die verschiedenen Worte kommen, die oft für dieselben Dinge benutzt werden. Vieles, was uns wie Lautmalerei vorkommt, ist tatsächlich ein gern benutztes Lehnwort.
Wer Deutsch zu sprechen versuchte, ohne Lehnworte zu verwenden, der würde ein gewaltiges Problem bekommen. Wir haben uns seit über 1.000 Jahren immer emsig bedient. Unser Sprachschatz ist ein Vielvölkersprachschatz, der gerade deshalb farbig und lebendig ist. Was natürlich nicht ausschließt, dass in etlichen der in diesem Buch behandelten Worte auch noch die uralten indogermanischen Wurzeln zu erkennen sind, teilweise echte mundartliche Restbestände, die überdauert haben, weil die Gebrauchswörter fest zu unserem Alltag gehören. So wie die Latschen, die ich doch so gern Puschen nenne. Aber die Puschen gehören dann wieder eher zu den Niedersachsen, genauso wie die Zwille, die im Ruhrpott Flitsche heißt.
Und dass die Börse nur im Wiener Raum üblich sein sollte und die gut erzogenen Norddeutschen alle brav Portemonnaie sagen, erstaunt schon. Aber man merkt auch, dass man als Vielleser auch viel mehr Wörter als normal parat hat und sich mit ihnen heimisch fühlt, während die meisten Leute im Alltag wohl doch eher alle dasselbe sagen. Wobei mich selbst das mit der Bulette überrascht – gefühlsmäßig einfach den Berlinern zugeordnet, weil ich vorm Lesen des Buches dachte, in einer Fleischklops-Region zu wohnen. Aber die Bulette ist augenscheinlich sprachlich auf Eroberungstour. So wie der Kartoffelbrei und der Kanten, der doch eben noch ein ordentlicher Brotknust war.
Die Online-Abfrage macht augenscheinlich sichtbar, wie die Vielfalt oft regionaler Spezialausdrücke verschwindet, je mehr die ganze Republik ins Wandern kommt. Denn diese moderne Mobilität ist ja der Hauptgrund dafür, dass Menschen ihren Sprach- und Dialektraum wechseln. Und es ist augenscheinlich nicht mehr so, dass sich die Neuankömmlinge dem Idiom ihrer Gaststadt anpassen (außer in Berlin, wo sie alle schnell dazugehören wollen und „dit“ sagen), sondern dass sich die alten Idiome auflösen, je mobiler die Menschen werden.
Und je eiliger sie es haben. Einige Kapitel – gerade im hinteren Teil des Buches zur besonderen Aussprache der Wörter – beschäftigen sich auch mit den allgegenwärtigen Trends zur Vereinfachung. Aber dass man im Leipziger Raum bei den Neujahrs-Prosits gleich mal das Jahr hinter „Frohes Neues“ weglässt, finde ich verwunderlich. Schon gar, weil ich augenscheinlich zur verdrängten Fraktion derer gehöre, die noch immer ein „glückliches neues Jahr“ wünsche, weil ich es Käse finde, den Beglückwünschten so etwas wie Frohheit zu wünschen, wo Gesundheit und Glück doch viel wichtiger sind. Aber augenscheinlich wünscht kein Mensch mehr ein „Glückliches Neues Jahr“. Warum eigentlich nicht? Sind die alle mit Frohsein schon zufrieden? So nach dem Motto: „Kannste froh sein, dass du das noch erleben darfst.“
Es ist schon sonderbar, was so eine Umfrage mit wirklich vielen Teilnehmern bringt. Sie zeigt auch, wie eigene Sprachgewohnheiten in die Minderheit geraten und so langsam verschwinden. Meist – wie es aussieht – ganz gedankenlos. Menschen passen ihren Alltagssprachgebrauch den Menschen um sich herum an.
Wobei ich bei diesem „Frohen Neuen“ den leisen Verdacht habe, es hat auch etwas mit zunehmender Oberflächlichkeit zu tun. Man möchte die Dinge, die man sagt, nicht mehr so ernst meinen. Denn wenn man jemandem Glück wünscht, zeigt man ja auch eine gewisse Zuneigung, eine, die sich mal nicht mit den Zipperlein beschäftigt, die einen so befallen können.
Viele, viele bunte Karten machen anschaulich, was die Befragungsergebnisse ergeben haben, machen Sprachgrenzen deutlich, aber auch Übergangsräume. Da wird die verwendete Farbe dann blasser und man ahnt nur, dass der meistgebrauchte Begriff noch in Konkurrenz steht zu dem einen oder anderen Gebrauchswort. Die Texte erklären sehr schön, wie sich diese bunten Landschaften verschieben und wie sich damit unser Sprachverhalten ändert – selbst dann, wenn wir glauben, dass es das gar nicht tut. Ein richtig schönes Büchlein für alle, die deutschsprachige Lande als Sprachenlandschaft erleben möchten. Ganz gemütlich daheim im Fauteuil oder Faltstuhl, wie das Ding mal hieß, bevor es übers Französische wieder zu uns kam.
Adrian Leemann, Stephan Elspaß, Robert Möller, Timo Grossenbacher Grüezi, Moin, Servus!, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2018, 9,99 Euro.
Fast so etwas wie eine Geburtstagsausgabe – Die neue LZ Nr. 50 ist da
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
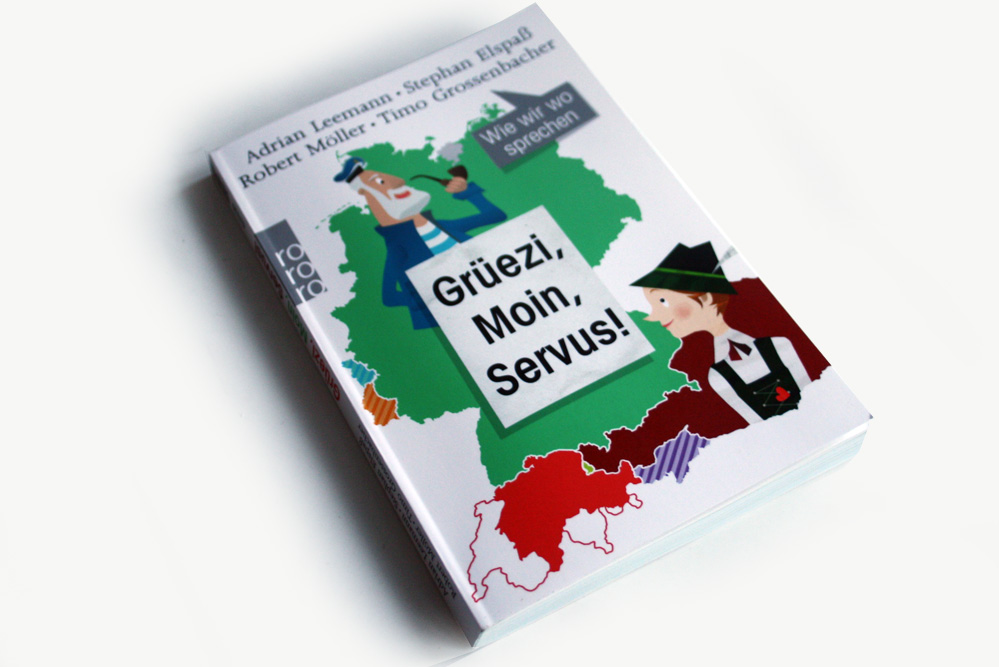








Keine Kommentare bisher