Es ist ein Buch wie ein Möbelstück. 375 Seiten dick, reich bebildert und im Grunde etwas, was man sich als echte Doktorarbeit vorstellen kann. Hat Thomas Nabert natürlich nicht nötig. Seit 1991 hat er seinen Dr. phil. in Neuerer Geschichte. Was auch bedeutet, dass er mit solchen Themen umzugehen weiß, bei denen der Laie sich nur fragt: Ja, wo nimmt er das denn alles her?
Die Antwort lautet natürlich: Die gewaltige Recherchearbeit hat er nicht allein geleistet. Eine ganze Interessengemeinschaft Sachsenmöbel hat sich zusammengetan, um zur langen und reichen Geschichte der sächsischen Möbelindustrie zu forschen. Im Grunde jeder ein Experte auf dem Gebiet, viele selbst lange in der Möbelwirtschaft tätig. Und einen Dreh- und Angelpunkt für das Rechercheprojekt gibt es auch: Das ist das Deutsche Stuhlbaumuseum in Rabenau. Das nicht ganz zufällig dort steht. Denn in Rabenau war mal ein Tummelplatz der sächsischen Stuhlbauer.
Die Reise, die dieses opulente Grundlagenwerk unternimmt, geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Da gab es zwar noch keine Möbelindustrie in Sachsen, jedes Möbelstück wurde in aufwändiger handwerklicher Arbeit hergestellt. Aber diese Vorgeschichte gehört natürlich dazu. Denn die Entstehung einer Industrie ist ein langwieriger Prozess. Sie entsteht nicht aus dem Nichts. Sie braucht funktionierende Absatzmärkte und funktionierende Transportsysteme, sie braucht genügend Rohstoffe und Fachleute. Sie braucht, je größer die Stückzahlen werden, stärkere Maschinen – oder überhaupt erst einmal Maschinen, die auch Arbeitsteilungen ermöglichen – und die Erhöhung der Produktionsgeschwindigkeit. Und sie braucht etwas, was die Möbelhersteller ziemlich genau spüren: Bevölkerungswachstum und forcierten Wohnungsbau. Wenn es der Bauwirtschaft schlecht geht, geht es auch den Möbelbauern schlecht.
Alle genannten Aspekte beleuchtet Nabert natürlich, bettet die Entstehung der ersten größeren Möbelfabriken ein in die industrielle Revolution, die mit der Dampfmaschine im späten 18. Jahrhundert auch in Sachsen ganz vorsichtig begann und dann mit dem Bau der ersten Ferneisenbahnen ab 1839 so richtig Fahrt aufnahm.
Natürlich geht es im Buch nicht so schnell. Denn Möbel hängen ja auch vom Zeitgeschmack ab. Und so gibt es auch zu all den Zeitetappen, die im Buch beschrieben werden, Erörterungen zur Veränderung der Wohnkultur, auch zu ihrer Aufsplittung in die verschiedener Bevölkerungsschichten. Wobei natürlich die ganz armen Bevölkerungsteile – Tagelöhner, Dienstboten usw. – hier natürlich ausgespart sind. Auch die von Handwerkern im Erzgebirge und anderswo hergestellten Möbel waren für eine Kundschaft gedacht, die überhaupt in der Lage war, sich Möbel zu kaufen.Zwar erweiterte sich der Kreis der Käuferschichten im 19. Jahrhundert nach und nach – großbürgerliche Haushalte begannen, ihre Wohnungen so prächtig auszustatten wie zuvor die Adligen ihre Schlösser, der bürgerliche Mittelstand versuchte mit bescheidenen Mitteln, den Wohnluxus der Reichen zu imitieren, und irgendwann gab es auch die ersten Ausstattungslösungen für die kleineren Wohnungen der Kleinbürger und Angestellten. Aber das war ein durchaus langer und komplexer Prozess, bis es so weit kam. Dazu mussten auch die Möbelbauer umlernen und herausfinden, wie man die Produktion von Möbelstücken in Einzelschritte auflösen kann. Nicht jeder Handwerksbetrieb ging diesen Schritt. Denn ein gewisser Mut gehörte dazu. Es gab auch ein bisschen Industriespionage. Und es gab zuweilen sogar recht heftige Diskussionen darüber, wie ein ordentliches Möbelstück auszusehen habe. Etliche Fotos im Band geben einen Eindruck davon, wie normale bürgerliche Wohnungen etwa in der Gründerzeit aussahen, dominiert von schweren Stühlen, Tischen, Buffetts und Truhen, oft im Neorenaissance-Stil, mit dem das neue nationale Denken bis in die Schlafzimmer der Bürger hinein seine Ausprägung fand.
Was einen dann doch über so manchen Schlossbesuch grübeln lässt. Denn kaum eines der seinerzeit in allerlei Neo-Stilen umgebauten Schlösser ist mit wirklich alten Möbeln ausgestattet, die meisten zeigen fürstliche Schwere aus dem späten 19. Jahrhundert – und damit eigentlich die Erzeugnisse einer zunehmend standardisierten sächsischen Möbelproduktion. Es waren die Möbeldesigner selbst, die um die Jahrhundertwende herum begannen zu rebellieren und den Gebrauchswert und die nützliche Einfachheit von Möbeln zu betonen begannen. Ein Vorreiter waren die Deutschen Werkstätten Hellerau in Dresden, ein Name, der heute noch Klang hat, vor allem weil aus diesem Werk immer wieder Innovationsimpulse kamen, die die Entwicklung der ganzen Branche voranbrachten.
Als Wachstum noch neu war: Eine Zeitreise ins Zeitalter der sächsischen Industrie- und Gewerbeausstellungen
Band für Band bekommt Sachsen …
Das große Buch zum Ende einer Ära: Die Braunkohlenindustrie in Mitteldeutschland
Es ist nicht nur für den Geowissenschaftler …
Geschmackssache, Ansichtssache oder ein Fall fürs Museum? Wie schmeckte die DDR?
Wie schmeckte die DDR? …
Ein anderer Innovationsträger waren die Eschebachwerke, die viele jener Klassiker entwarfen, die weit ins 20. Jahrhundert hinein das Standardmobiliar in deutschen Küchen und Wohnzimmern waren. Es lohnt sich tatsächlich, Omas altes Küchenbuffett genauer unter die Lupe zu nehmen. Es mag alt und bieder wirken – aber auch darin steckt schon die moderne Design-Entwicklung der 1920er Jahre – und jede Menge Nachdenken über die nützliche Anordnung von Fächern und Borden. Natürlich waren das nicht schon alle namhaften Möbelproduzenten aus Sachsen. Weit über 100 Unternehmen belieferten den Markt mit einer geradezu beeindruckenden Produktvielfalt. Der Absatzmarkt des bevölkerungsmäßig permanent wachsenden Deutschland war unersättlich. Gerade das Wachstum der Großstädte mit ihren großen Wohnungsbauprogrammen sorgte dafür, dass die Nachfrage nach praktischen, mit kleiner Wohnfläche kompatiblem Mobiliar nicht nachließ.
Die üblichen Einbrüche gab es immer dann, wenn auch die gesamte Gesellschaft in Krisen geriet. Auch Sachsens Möbelbauer mussten in die beiden Weltkriege ziehen, litten unter den Wirtschaftskrisen der 1920er Jahre. Aber das Thema Fachkräftemangel tauchte immer wieder auf, zuletzt natürlich in der DDR-Zeit, in der die Möbelindustrie genauso wie alle anderen Wirtschaftsbereiche einem mehrfachen Stresstest unterzogen wurde. Irgendwie nach dem Motto: Wieviel hält so eine Wirtschaft eigentlich aus, bis sie zusammenbricht?
Auch diese Epoche schildert Thomas Nabert sehr detailliert samt den Auswirkungen, die anfangs die Kriegsverluste, kurz darauf die Demontagen von rund einem Drittel der sächsischen Möbelfabriken im Zuge der Reparationsleistungen an die Sowjetunion bedeuteten. Eine Phase, die Sachsens Möbelfabrikanten übrigens mit viel Einfallsreichtum und Improvisationstalent überstanden, genauso wie die rigiden Planvorgaben der frühen Ulbricht-Zeit. In den 1950er und 1960er Jahren waren Sachsens Möbelhersteller international noch wettbewerbsfähig, verblüfften mit einer erstaunlichen Modellbreite ihrer Produktion. Und wurden trotzdem nicht geschont, als die DDR-Wirtschaft immer mehr zentralisiert wurde und in der Honeckerzeit dann die letzte Privatisierungswelle auch noch dem letzten überlebenden Unternehmer die Fabrik entzog.Aber noch schlimmer wirkte sich etwas anderes auf die Wettbewerbsfähigkeit der DDR-Möbelwirtschaft aus: Die Gründung des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), in dem praktisch von Moskau aus bestimmt wurde, welches Land des Ostblocks welche Güter zu produzieren hatte. Das bedeutete für Ostdeutschland nicht nur den Verlust wichtiger innovativer Wirtschaftszweige wie etwa den Flugzeugbau oder die Busproduktion, es bedeutete auch das Ende der ostdeutschen Herstellung von Maschinen für die Möbelindustrie. Eigentlich waren Bulgarien und Rumänien vorgesehen, diese Maschinenproduktion aufzubauen – doch das ist bis zum Zusammenbruch des Ostblocks nie geschehen. Das heißt: Ab Mitte der 1960er Jahre stand die schon stark spezialisierte Möbelindustrie ohne eigene Maschinenlieferanten da. Ab jetzt wurden die Maschinen – wenn man sie nicht in Eigenbau selbst zusammenbastelte oder für teure Valuta im Nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet (NSW) einkaufte, auf Verschleiß gefahren.
Die Möbelbauer zeigten zwar trotzdem eine erstaunliche Innovationsfreude. Doch die DDR-Bürger bekamen davon nicht allzu viel mit, denn ein Großteil der Produktion wurde gegen wertvolle Devisen in den Westen verkauft oder als langfristiger Großauftrag in den Osten. Und im Westen waren die Produkte aus sächsischen Betrieben trotz allem gefragt. Die Qualität stimmte und der Preis lag deutlich unter den Herstellungspreisen im Westen. Auch die Krise um das zeitweilig verwendete Formaldehyd wurde ausgestanden. Da aber immer mehr der Faktor Export dominierte, führte das flächendeckend zu einer Minimierung der Angebotspalette.
Die Folgen wurden 1990 sichtbar, als Sachsens Möbelbauer auf einen Schlag gleich beide wichtigen Exportmärkte verloren – den Osten, weil dort niemand die DM hatte, um die Möbel zu bezahlen, und den Westen, weil Sachsens Fabriken mit ihrer jahrzehntealten Maschinenausstattung auf einmal mit hochmodernen Unternehmen konkurrierten, ohne dass sie über das Lohnniveau noch einen Wettbewerbsvorteil hatten.
Entsprechend folgenreich war der Ansatz der Treuhand, bis 1992 alles schnellstmöglich zu versilbern, was irgend zu versilbern ging. Viel zu spät merkte man in der Chefetage der Treuhand, dass ein solcher Transformationsprozess echte Unterstützung brauchte. Einigen wichtigen sächsischen Möbelproduzenten ist so – mit deutlich verschlankter Mannschaft – der Schritt in die Marktwirtschaft gelungen. Einige gehören heute wieder zur Crème de la crème der deutschen Möbelproduzenten. Andere haben dann – trotz bester Qualität – die in DDR-Zeiten gewonnenen Zulieferaufträge verloren, etwa an IKEA, weil weiter ostwärts eben doch noch billiger produziert werden konnte. Auch das Kapitel IKEA und Haftanstalten wird kurz angetippt. Aber wenn man diese Produktion mit Häftlingen betrachtet, muss man sich das in den 1980er Jahren verschärfende Arbeitskräfteproblem der DDR bedenken. Einige VEB konnten ihre Produktion nur absichern, indem sie Teile davon mit Häftlingen abdeckten. Aber auch das war ja ein Zeichen für die Nöte des Landes, die sich am Ende immer mehr zuspitzten.
Oft genug fragt man sich als Leser: Haben die Wirtschaftsexperten im Politbüro diese Entwicklung nicht begriffen? Oder konnten sie nicht anders?
Das Buch erzählt natürlich am Ende davon, mit welchem Wagemut die Möbelbauer in Sachsen teilweise den Neuanfang wagten – und in vielen Fällen auch schafften. Nebenbei erfährt der Leser allerlei über Möbelpreise, Löhne, die verwendeten Materialien bis hin zu den modernen, materialsparenden Varietäten von der Spanplatte bis zur Dekorfolie. Es ist ganz beiläufig auch eine kleine Alltagsgeschichte mit Einblicken in alte Prachtkataloge oder recht triste HO-Schaufenster. Ein Buch, das Fachleuten genauso eine Fundgrube sein wird wie Leuten, die auch in der Geschichte der heimischen Möbel ein faszinierendes Stück Historie entdecken wollen.
Thomas Nabert “Möbel für alle”, Pro Leipzig, Leipzig 2014, 29 Euro
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
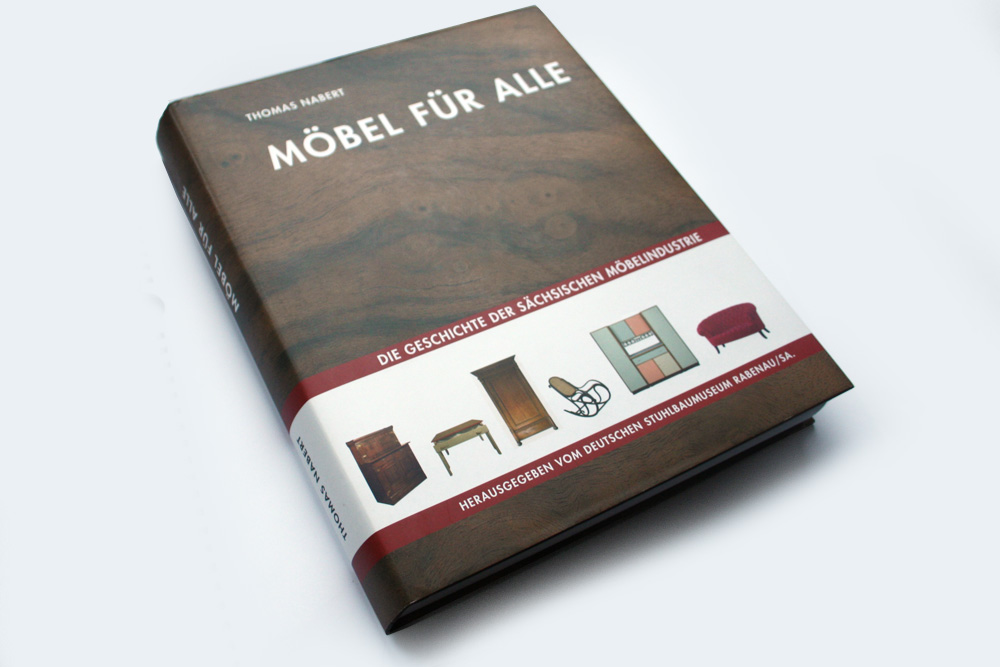








Keine Kommentare bisher