Mongolische Dichtkunst ist auf dem deutschen Buchmarkt kaum präsent. Es geht dem 3-Millionen-Einwohnerland da nicht besser als so vielen anderen Nationen, deren Sprache es schwer hat, per Übersetzung in deutsche Buchhandlungen zu gelangen. Dabei ist es auch heute noch das stolze Volk der Nachfahren Tschingis Chaans: ein Volk der Reiter, Hirten, Nomaden. Zumindest in der Lyrik. Denn wie man vom Kirgisen Tschingis Aitmatow weiß: Der Tag zieht den Jahrhundertweg ...
Tradition und Moderne prallen auch in den Steppen der Mongolei aufeinander. In der einen, immer mehr ausufernden Hauptstadt Ulaanbaatar sowieso, wo heute 1,3 Millionen Mongolen leben. Auch wenn die Mongolei mit ihren riesigen Steppen und Wüstenlandschaften eines der größten Länder der Erde ist, leben dort weniger Menschen als in Sachsen. Und der Widerspruch wird noch deutlicher, wenn man sich vorstellt, dass 1,5 Millionen Sachsen allein in der Landeshauptstadt Dresden wohnen würden. Dabei ging auch das Land am Altai im 20. Jahrhundert den steinigen Weg durch die Knochenmühle der Modernisierung. Vor 100 Jahren waren die Mongolen tatsächlich noch ein fast klassisches Volk der Reiternomaden, einzig bedrängt von den beiden Großmächten Russland und China, die hier um Einfluss rangen.
Vor 100 Jahren ging der Jahrhunderte lange Einfluss Chinas zu Ende, die Mongolen begannen, eine nationale Eigenständigkeit zu erkämpfen, die sie 1924 auch erlangten. Damals wurde die Mongolei zum zweiten sozialistischen Staat der Erde. Und bis 1989 entwickelt sich das Land im gewaltigen Schlagschatten der Sowjetunion. Auch die Mongolen erlebten ihre friedliche Revolution, die Etablierung eines demokratischen Staates und die konfliktreiche Reise in die Welt des heutigen Kapitalismus, die sich in den Ländern der Erde überall so verblüffend ähnlich ist – mit einer kleinen Schicht von Reichen, die sich die Ressourcen des Landes aneignen und immer reicher werden – und mit einer wachsenden Schicht von Armen, die versuchen, von den übrig bleibenden Brosamen zu überleben. Auch in der Mongolei lebt ein Drittel der Menschen heute unter der Armutsschwelle.
Diesen ganzen Spannungsbogen hat Klaus Oehmichen eingesammelt, als er 2006 begann, zielgerichtet Gedichte der letzten 100 Jahre zu übersetzen. Tatsächlich ist die Spanne weit größer, denn er ist mit einigen Beispielen mongolischer Dichtkunst bis ins 13. Jahrhundert zurückgegangen. So zeigt er die Wurzeln der jüngeren Dichter, die die “Weisheitssprüche Tschingis Chaans” ebenso umfassen wie diverse Chroniken des 16. und 17. Jahrhunderts und Volkslieder des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Einflüsse der lamaistischen Klöster werden sichtbar, genauso wie die jahrhundertelange Trennung zwischen der in den Klöstern gepflegten schriftlichen Überlieferung und den Gesängen, Liedern, Balladen und Legenden, die in den Jurten von Sängern und Erzählern mündlich weitergetragen wurden.
Tatsächlich floss das erst mit dem frühen 20. Jahrhundert erstmals zusammen. Erst seitdem entwickelte sich eine breite mongolische Literatur, die nun nicht mehr an die Schreibgelehrten der Klöster gebunden war. Und was sich da entwickelte, ist bis heute einzigartig. Dazu braucht es nicht einmal die von Barbara Große für den Auswahlband bereitgestellten Aquarelle weiter grüner Landschaften. Denn diese Landschaften sind in der mongolischen Dichtung präsent. Bis heute.
Noch, muss man sagen. Denn was die 65 Jahre des Sozialismus nicht geschafft haben – den Bruch mit der alten Kultur des Reitervolkes -, das vollbringen nun die Hammerschläge der kapitalistischen Marktwirtschaft. Immer mehr junge Mongolen suchen ihr Glück in der großen Stadt, Familien, denen Kälte und Dürre die Herden dezimiert haben, siedeln sich im Umfeld der Hauptstadt Ulaan Baatar an. Und damit beginnen die alten Traditionen zu zerbrechen, sich aufzulösen. Und auch die Dichter des Landes erleben es als Schock. Gerade weil sie noch bis vor wenigen Jahren ohne wirklich spürbare Distanz von der Weite der mongolischen Himmel singen konnten, von der Liebe zur Familie, den Steinen der Heimat, den Pferden, auf deren Rücken sie ein ganzes Leben verbrachten.
Es tauchen immer wieder die selben Motive auf, mal in der allumfassenden Perspektive des Staunens darüber, wie schön dieses Land ist, mal aus der Nahdistanz, wenn das Schlummern der Liebsten beschrieben wird, die Freude der Kinder, die Handgriffe des Alltags. Und das Verblüffende beim Lesen: Es wird nicht langweilig. Es ist, als liefe vor dem inneren Auge die ganze Zeit ein großer Breitwandfilm ab, auf dem sich das goldene Gras der Steppen wiegt, der blaue Altai den Horizont markiert, Staubfahnen durch die dreizehn Regionen der Gobi wehen – und immer wieder der Zoom auf die Jurten, die umworbenen Frauen, die stolzen Reiter, auf stille Seen, sprudelnde Flüsse und kreisende Vögel an einem unendlichen Himmel. Ein schönes Leben und ein rauhes Leben. Mongolische Dichter werden nicht alt. Der Wechsel der Generationen ist dichter als bei uns.
Der Atem, mit dem die Dichter – und im späten 20. Jahrhundert auch die Dichterinnen – das Leben unter dem endlosen Himmel beschreiben, erinnert – wohl nicht ganz zufällig – an die “Grashalme” von Walt Whitman. Auch sie “singen ihr Land”, tun es oft im Tonfall der alten Lieder und Hymnen, es fällt schon auf, wenn sie versuchen, die europäische Dichtung der Moderne aufzugreifen. Es passt einfach nicht. In guter Dichtung spiegelt sich immer das Lebenstempo und das Lebensgefühl der Völker. Manches erinnert ebenso natürlich auch an Lieder, wie sie einst Herder in den “Stimmen der Völker in Liedern” versammelte. Hier hat es sich bewahrt, weil auch die Kultur sich lange bewahren konnte. Auch in der Zeit des Sozialismus, auch wenn gerade die Generation der Parteidichter in diesem Band nicht vorkommt. Die ist vergangen. Die liest auch in der Mongolei vermutlich niemand mehr.

Doch das empfindet man nicht als Verlust. Denn fast nahtlos schließt sich an die Dichtungen der ersten schreibkundigen Generation, die sich ab 1921 zu Wort meldete, die “Goldene Generation” an, die ab den 1960er Jahren eine eigene Sprache fand, wie Klaus Oehmichen im Nachwort schreibt, in dem er noch einmal einen kleinen Abriss der jüngeren mongolischen (Literatur-)Geschichte gibt. So kann man die 108 Gedichte, die er gesammelt hat, einordnen. Und ebenso wichtig ist der Anhang mit den biographischen Notizen zu den ausgewählten Dichterinnen und Dichtern, die auch zeigen, wie eng Dichtung mit persönlichem Erleben zusammen hängt. Und wie Dichtung selbst gesellschaftliche Entwicklungen vorantreibt. Denn der mutige Ton der “Goldenen Generation” hat – ganz ähnlich wie in der “befreundeten” Sowjetunion die “Tauwetter”-Literatur – die Umbrüche der 1980er Jahre vorweggenommen und beflügelt.
Übrigens etwas, dessen man sich im ostdeutschen Revolutionsfrühling bis heute nicht wirklich bewusst werden will. Auch die DDR hatte ihre “Tauwetter”-Literatur.
Eine Gesellschaft muss sich auch immer an den Maßstäben der Dichter messen lassen. Und die sind hoch, gerade bei den besten mongolischen Dichtern. Was ebenfalls mit einem Aspekt zu tun hat, den die Mongolei mit der damaligen Sowjetunion und der DDR gemeinsam hatte: der hohen gesellschaftlichen Wertschätzung von Dichtung, was den Dichtern auch vergleichsweise hohe Auflagenzahlen für ihre Lyrikbände verschaffte. So etwas schafft Wechselwirkungen. Denn Achtung hat auch mit Aufmerksamkeit zu tun. Denn kluge Dichtung schärft auch den Blick fürs eigene Leben und Lebendigsein. Umso schmerzhafter werden die Widersprüche deutlich, wenn ein richtiges Leben im falschen nicht mehr möglich ist. Das gilt nicht nur für die gescheiterten Marxisten. Das gilt auch für die oft genug emotionslosen Ingenieure der Marktwirtschaft, die nur die Rendite und die Effizienz begreifen, aber nicht, was eine marktkonforme Gesellschaft mit den Menschen, ihren familiären und traditionellen Bindungen anrichtet.
Deswegen wirken gerade die jüngeren Gedichte in diesem Band wie ein Bruch, als spürten die Dichter am eigenen Leib, wie das alte, staunende Verhältnis zur unendlich schönen Mongolei gestört, zerrissen, lädiert ist. Sie spüren es wie ein Leiden im eigenen Kopf. Wie Baataryn Galsansüch: “Das Organ Seele erkrankt wie die Leber (…) Das Organ Seele wird stillstehen wie das Herz.” Was auch den Leser herausschleudert aus dem großen, mitreißenden Gesang, wie ihn Begdsijn Jawuuchulan 1961 noch schreiben konnte: “Über den weiten blauen Himmel zu gebieten bin ich geboren …”
Und auch das wirkt auf den Leser im heutigen Mitteleuropa verwirrend vertraut – als Widerspruch mitten im eigenen Leben: zwischen Sehnsucht und erlebtem Alltag, Traum von Freiheit und gelebter Verwirrung. Natürlich hat das mit Sinnstiftung zu tun. Und mit dem wachsenden Misstrauen, wenn Menschen sich nicht mehr geborgen fühlen in ihrer Welt. Oder um Bajarchuugijn Itschinchorloo zu zitieren, der 1995 den jungen Adler besingt: “Mehr Angst vor dem Tod haben sie vor deinem sicheren Blick / Bitte vertrau nicht den Menschen hier, o Adler (…) Die Leute mögen solch stolzes Verhalten nicht …”
So wird die Sammlung auch wie ein schwermütiger Blick zurück in ein Land, das ebenso am Verschwinden ist, wie jedes andere dieser alten, traditionellen Länder, die in den Mahlstrom der sturen Marktwirtschaft geworfen wurden, die alles überall den selben Regeln und Gesetzen unterwirft. Und sich dann nicht einmal wundern kann, dass die Menschen in der neuen Verheißung nicht glücklich werden.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
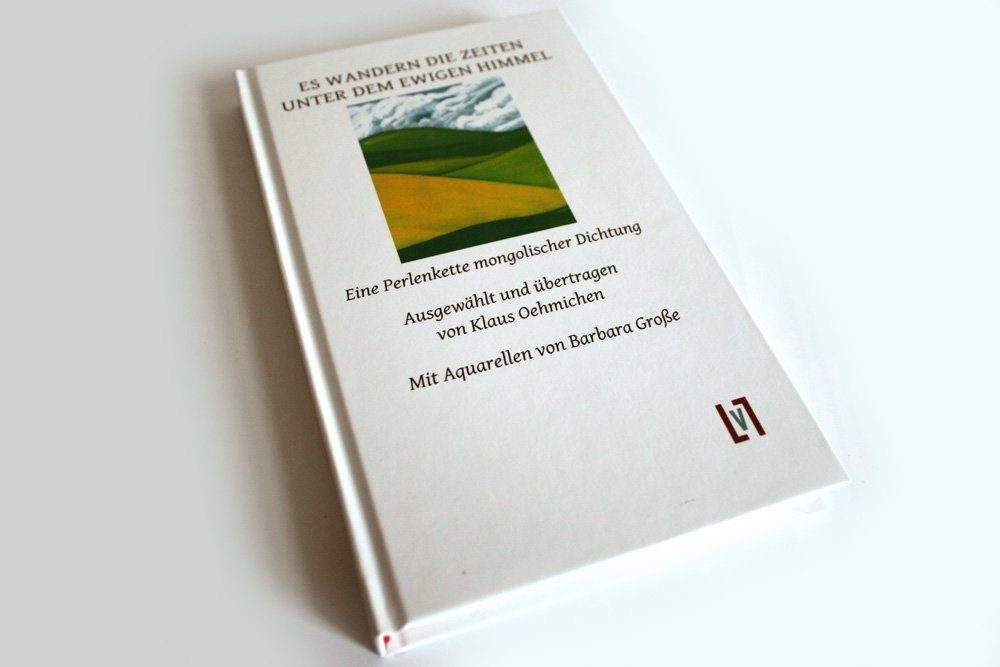








Keine Kommentare bisher