Als am 26. April 1986 um 01:24 Uhr der Reaktor 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl infolge eines fehlgeschlagenen Experimentes buchstäblich in die Luft flog, wurden die Feuerwehren sofort alarmiert. Allerdings wurden diese nicht zu einem Reaktorbrand gerufen, sondern zu einem Brand auf dem Dach des 4. Reaktorblocks. An all den hier beschriebenen Einsatzhandlungen waren auch Feuerwehrangehörige aus unserer Partnerstadt Kiew beteiligt.
Nach der Explosion im Reaktorblock 4 wurde der Feuerwehr nicht mitgeteilt, dass der Reaktor explodiert war. Die Bedienmannschaft in der Zentrale hatte über das Geschehen lange keine klaren Vorstellungen, auch wenn es schon bald deutliche Anzeichen gegeben hatte, dass etwas Entsetzliches geschehen sein musste. Sie ahnten nicht, dass hier ein Ereignis eingetreten war, welches bis dahin als undenkbar galt.
Dennoch handelte die Reaktorbedienmannschaft geistesgegenwärtig, indem sie den Wasserstoff schnell aus den großen Turbinen abgelassen hatte. Sie wies den ersten Einsatzkräften der Feuerwehr des Kernkraftwerkes den Weg, wo sie am besten ihre Tätigkeiten zur Brandbekämpfung aufnehmen sollten.
Durch die Fehleinschätzung, dass der Reaktor selbst noch intakt war, wurde auf Anordnung der Bedienmannschaft des Reaktors tonnenweise Wasser in den Reaktor gepumpt, im guten Glauben, diesen dadurch ausreichend kühlen zu können. Unabhängig von den Informationen des Kernkraftwerkes an die Feuerwehr führte diese zum Glück ständig eine eigene Informationsbeschaffung durch.
Die Tragik der letzten Minuten vor der Reaktorexplosion lag darin, dass der Bedienmannschaft des Reaktors einige konstruktive Reaktormängel nicht bekannt gewesen sind. Denn gerade die Notabschaltung des Reaktors führte dazu, dass der Reaktor explodierte. Das lag an der zuvor stattgefunden Überhitzung des Reaktors, die dazu führte, dass die Kanäle für die Steuerung der Notabschaltung sich verformt hatten und die Stäbe dadurch nicht vollständig eingefahren werden konnten.
Zu allem Unglück waren die Spitzen der Stäbe der Notabschaltung aus Graphit, was die Kernspaltung zusätzlich verbesserte. Da die Stäbe der Notausschaltung stecken blieben, wurde die Kernspaltung zusätzlich erhöht. Das führte dazu, dass statt der erhofften Notabschaltung die Reaktorleistung nochmals deutlich anstieg und der Reaktor explodierte.
Somit war ein Ereignis eingetreten, welches nie hätte eintreten dürfen. So dachten oder hofften die Verantwortlichen sehr, dass es nur eine Explosion des Speisewassertanks sei. Selbst dann noch, als Angehörige der Bedienmannschaft des Reaktors vor den Verantwortlichen schon nach kurzer Zeit zusammengebrochen waren.
Im Gegensatz zu den Bildern, die sich schnell über den gesamten Globus verteilten, hatten die Feuerwehrleute der ersten Stunden nicht die privilegierte Sicht auf den Reaktor. Dasselbe gilt für Informationen, die zu einer bestimmten Zeit den jeweiligen Einsatzkräften übermittelt wurden.
Das muss immer berücksichtigt werden, wenn es um die Handlungen der Feuerwehr- und Rettungsmannschaften geht. Nur so kann man im Nachhinein das Handeln der Einsatzkräfte, im Zusammenhang mit dem weltweit ersten Feuerwehreinsatz an einem überkritischen Reaktor sachlich einschätzen.
Ohne besonderen Schutz in den Einsatz
Die unmittelbare Gefahreneindämmung der Feuerwehr wurde gemeinsam mit der Betriebsmannschaft durchgeführt. Dabei trugen die Einsatzkräfte der Feuerwehr nur die normale Feuerwehrschutzausrüstung, da die zuständigen Dosimetristen sagten, dass bei der gemessenen Strahlung etwa sechs Stunden ohne gesundheitliche Gefahr gearbeitet werden könne. Als die ersten Einsatzkräfte nach kurzer Zeit, offenbar nicht nur infolge der Brandgase, zusammenbrachen, war klar, dass eine unbeschreiblich hohe ionisierende Strahlung vorhanden war. Von da an war der Feuerwehr die Dimension des Ereignisses klar.
Unabhängig vom Werkspersonal führte der Zivilschutz eigene Messungen durch, die ein ganz anderes Bild ergaben. Der mittlerweile eingetroffene Betriebsdirektor und der Chefingenieur des Kernkraftwerkes schenkten diesen Angaben aber keinen Glauben und meinten, dass deren Messgerät defekt sei. Deshalb gab die Kernkraftwerksleitung auch falsche Informationen nach Moskau. Jedoch müssen schon frühzeitig in Moskau auch noch andere Meldungen vorgelegen haben, da eine erste Sondermaschine schon in den frühen Morgenstunden von Moskau nach Kiew flog. Dasselbe gilt dann für die zweite Sondermaschine, in der der wissenschaftliche Einsatzleiter, Waleri Legassow, nach Kiew und anschließend nach Tschernobyl mit dem Hubschrauber gebracht wurde.
Für die nachrückenden Feuerwehrmannschaften aus dem Raum Kiew spielten diese Fehleinschätzungen kaum eine große Rolle, obwohl diese schon seit etwa 25 Minuten in Richtung Kernkraftwerk mit den ersten Fahrzeugen unterwegs waren und die Information über die hohe Strahlenbelastung bekannt war.
Das bedeutete aber, dass die Feuerwehr des Kernkraftwerkes, die nur zum Dachbrand alarmiert wurde, aufgrund des bloßen Verdachtes schon auf der Anfahrt den Alarm erhöhte. Entsprechend den Einsatzplanungen und Einsatzübungen wurden die Feuerwehren der umliegenden Orte bis einschließlich Kiew hinzugerufen.
Dem Einsatzleiter (man kann ihn nicht mehr fragen) war offenbar die eigenartige Flammenbildung, die so gar nicht zu einem Dachbrand passte, suspekt, weshalb er den Alarm deutlich erhöhte.
Der Feuerwehr von Kiew waren die hohen Strahlenwerte offensichtlich aus einer anderen Quelle übermittelt worden, da diese drei Kilometer vor dem Kernkraftwerk unter Berücksichtigung der Windrichtung in Bereitschaft gingen und nur so viele Feuerwehrmänner zum Einsatz brachten, wie für die Ablösung und Rettung der Verunglückten erforderlich waren. Wenn es die Einsatzlage ermöglichte, wurden jetzt die Einsatzkräfte auch mit zusätzlicher Schutzausrüstung zum Ort des Geschehens gebracht.
Die Brandbekämpfung in den ersten Stunden musste sehr zügig durchgeführt werden. Denn unmittelbar neben dem Reaktorblock 4 war der Reaktorblock 3 noch in Betrieb. Durch die starken Zerstörungen im Reaktorblock 4 mussten die Feuerwehrleute oft erst mittels tragbaren Leitern, bei fast vollständiger Dunkelheit und Rauch, an den Ort des Geschehens gelangen. Dabei mussten Höhen bis zu 70 Meter bewältigt werden.
Auf dem Dach brannte aber das aus dem Inneren des Reaktors ausgeworfene Graphit, das der Feuerwehr aber nicht als solches bekannt war. Den Feuerwehrleuten wurde aber schnell klar, dass die Angaben der Dosimitristen nicht stimmen konnten, als ihnen schlecht wurde, ohne dass eine Rauchgasvergiftung vorlag.
Für die nachrückenden Einsatzkräfte gab es aber dennoch keine Wahl. Sie mussten ihren Kameraden Hilfe leisten und diese auch aus großer Höhen herunterbringen. Spätestens ab da nahmen sie bewusst das Risiko in Kauf, schwere gesundheitliche Schäden zu erleiden. Denn ein Zurück gab es nicht mehr. Und Schutzausrüstung gegen eine solch hohe ionisierende Strahlung gab es weltweit weder damals noch heute. Aber selbst wenn eine solche zur Verfügung gestanden hätte, hätte sie nichts genützt, da es unmöglich gewesen wäre, mit dieser über die zerstörten Treppenhäuser in große Höhen zu gelangen.
Eine Knallgasexplosion um jeden Preis verhindern
Als diese Gefahr des Übergreifen auf den Reaktorblock 3 in den Morgenstunden des 26. April gebannt war und ein Großaufgebot von Feuerwehren aus dem Raum Kiew nach und nach eintraf, hatten bereits 6 der 28 ersteintreffenden Einsatzkräfte eine tödliche Strahlendosis abbekommen, an deren Folge sie im Mai unter furchtbaren Qualen starben. Zu diesen Einsatzkräften kam noch ein großer Teil der Betriebsmannschaft, die unter anderem zur Brandbekämpfung in der Turbinenhalle eingesetzt war.
Der Ersteinsatz war erfolgreich und der Reaktor 3 konnte in den Morgenstunden heruntergefahren werden. Dann jedoch begann der als Moderator genutzte Graphit im offenliegenden Reaktor zu brennen.
Nachdem der Reaktorbrand durch den selbstlosen Einsatz vieler Hubschrauberbesatzungen eingedämmt worden war, entwickelte sich durch die nach oben hin nicht mehr abzuführende Hitze eine Situation, die alles, was bis dahin passiert war, weit in den Schatten gestellt hätte. Es bestand die große Gefahr des Durchbrechens der Kernschmelze in die mit Wasser gefüllten unteren Räume des Reaktorgebäudes.
Dies hätte eine gewaltige Knallgasexplosion zur Folge gehabt, in deren Folge auch Reaktor 3 zerstört worden wäre und die Reaktoren 1 und 2 schwere Beschädigungen erlitten hätten. Die Wissenschaftler gingen davon aus, dass viele Millionen Menschen innerhalb kürzester Zeit gestorben wären und weite Teile der Ukraine, Weißrusslands, den baltischen Staaten sowie Polen unbewohnbar geworden wären.
Auch wären weite Teile Ostdeutschlands stark verseucht gewesen und in Westeuropa würden viele tausend Menschen zusätzlich an Krebs sterben.
In dieser Situation wurde durch freiwillige Angehörige der Feuerwehr, des Militärs und Betriebsangehörige alles unternommen, um das Wasser aus dem Keller zu bekommen. Dies gelang ihnen, da sie zuvor die notwendigen Einsatzhandlungen, zum Teil im Dunklen, im baugleichen Kernkraftwerk Kursk intensiv trainiert hatten. Dafür wurden viele Feuerwehrangehörige auch sofort nach der Reaktorexplosion nach Kursk ausgeflogen, um alle möglichen Situationen zu trainieren. So konnte die schlimmste Katastrophe für Ost- und Mitteleuropa abgewendet werden.
Der Kabelbrand am 22. Mai 1986
Eine ähnlich gefährliche Situation entwickelte sich in der Nacht vom 22. zum 23. Mai 1986, als ein Kabelbrand unter den Katakomben von Reaktor 4 entstanden war. Um das Ausland nicht zu beunruhigen, wurde dieser Feuerwehreinsatz über ein Jahrzehnt geheimgehalten. Es musste wiederum ein umfangreicher Löschangriff unter enormer Strahlenbelastung vorgetragen werden.
Um die Strahlenbelastung für die Einsatzkräfte so gering wie nur möglich zu halten, wurden durch den Oberst der Feuerwehr Maksimtschuk, einem der Leitenden Mitarbeiter der Hauptverwaltung der Feuerwehren der UdSSR in Moskau, über 300 Feuerwehrmänner unter Anwendung einer speziellen Taktik zum Einsatz gebracht.
Oberst Maksimtschuk verstarb im Jahr 1994 trotz aller Mühen eines internationalen Ärzteteams an den Folgen dieses Einsatzes – als einziger innerhalb von zehn Jahren nach diesem Einsatz. Seine minutiös ausgeklügelte Einsatztaktik war beim Kabelbrand für die Gesundheit der eingesetzten Feuerwehrmänner enorm wichtig. So waren diese nur so lange der ionisierenden Strahlung ausgesetzt, bis die „Katastrophendosis“, die man nur einmal im Leben aufnehmen darf, erreicht war. Oberst Maksimtschuk jedoch, der die Einsatzkräfte einteilte und überwachte, hatte sehr viel mehr Strahlung abbekommen.
Da dieser Einsatz geheimgehalten wurde, erhielten die Beteiligten – im Gegensatz zu vielen anderen – keine entsprechende Würdigung. Auch nicht Maksimtschuk, der in Ost und West kein Unbekannter war. Er leitete die Nationalmannschaft der Sowjetunion im Feuerwehrkampfsport. Er war Ende Mai 1981 auch in Leipzig, als er beim Internationalen Feuerwehrwettkampf in Leipzig seine Mannschaft zum Sieg führte.
Zwei Jahre später gratulierte er bei den internationalen Feuerwehrwettkämpfen in Böblingen aufrichtig dem Chef der DDR-Nationalmannschaft dafür, dass diese auf deutschem Boden erstmals die Mannschaft der Sowjetunion besiegt und den ersten Platz in der Mannschaftswertung errungen hatte. 15 Jahre nach der Reaktorexplosion wurde Maksimtschuk der Titel „Held Russlands“ postum verliehen. Die Angehörigen dieses Feuerwehreinsatzes erhielten ebenfalls hohe Auszeichnungen. Damit war die Geheimhaltung dieses Einsatzes offiziell aufgehoben.
Mit 30 Kilo schwerer Schutzausrüstung auf dem Reaktorblock
Ein Teil dieser durchtrainierten sowjetischen Feuerwehrsportler war es dann auch, die gemeinsam mit Offiziersschülern der Feuerwehr und des Militärs als sogenannte „Bioroboter“ auf dem Dach des Reaktorblockes 4 tätig wurden. Ihre Aufgabe war es, für wenige Sekunden den strahlenden Schutt vom Dach in den Reaktorraum zurückzuwerfen. Dies wurde erforderlich, nachdem die Robotertechnik aus Ost und West ihre Funktion infolge der bekannten sehr hohen Strahlung aufgegeben hatte. Dafür konnten nur die sportlichsten Feuerwehrleute eingesetzt werden, die mit einer über 35 kg schweren Bleischutzausrüstung über 70 Meter hoch klettern mussten.
So waren die Feuerwehreinsätze in Tschernobyl von Anfang an – im Gegensatz zu manch anderen Aussagen – unter den vorhanden Informationen sehr erfolgreich.
Im Rückblick betrachtet, waren die Handlungen der Feuerwehren und der anderer Rettungskräfte, im Gegensatz zu den Maßnahmen der Evakuierung und Information der Bevölkerung, nahezu perfekt. Ihrem Handeln verdanken auch wir in Deutschland, dass es bei weitem nicht so schlimm kam, wie es hätte kommen können.
35 Jahre nach Tschernobyl sollten wir innehalten und den Rettungskräften, die in dieser Situation in der Ukraine tätig waren, Dank sagen und uns verneigen. In Deutschland wäre eine solche Katastrophe unter den ähnlichen rechtlichen Rahmenbedingungen abgearbeitet worden, wie jetzt bei Corona.
Für Europa war es ein Glück, dass es bei Tschernobyl einen wissenschaftlichen Einsatzleiter, Walerie Legassow, gegeben hat. Legassow und seinem Wissenschaftsstab war es letztlich gelungen, dass sogar die politisch Verantwortlichen diesen unterstützt mussten. Gorbatschow, der 13 Monate im Amt war, hätte sicher noch den einen oder anderen Fehler im Zusammenhang mit Tschernobyl gemacht. Aber eines hatte es auch gegeben: Erstmals konnten sogar ausländische Feuerwehrjournalisten Einsatzkräfte im Moskauer Spezialkrankenhaus für Strahlenopfer kurz vor ihrem qualvollen Tod sprechen. Dass der amerikanische Knochenmarkspezialist Robert Gale dort ebenfalls zum Einsatz kommen konnte, wäre bis kurz vor diesem tragischen Ereignis undenkbar gewesen.
Der Leipziger Reinhard Steffler ist selbst Feuerwehrmann und hat die Gelegenheit genutzt, mit Kollegen in Leipzigs Partnerstadt Kiew zu sprechen. Er hat sich auch mit Feuerwehreinsätzen bei anderen Reaktorunfällen beschäftigt.
Nachlesen kann man das in seinem Buch: Reinhard Steffler Reaktorunfälle und die Handlungen der Feuerwehr, Machtwort-Verlag, Dessau 2016, ISBN: 978-3-86761-148-0
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
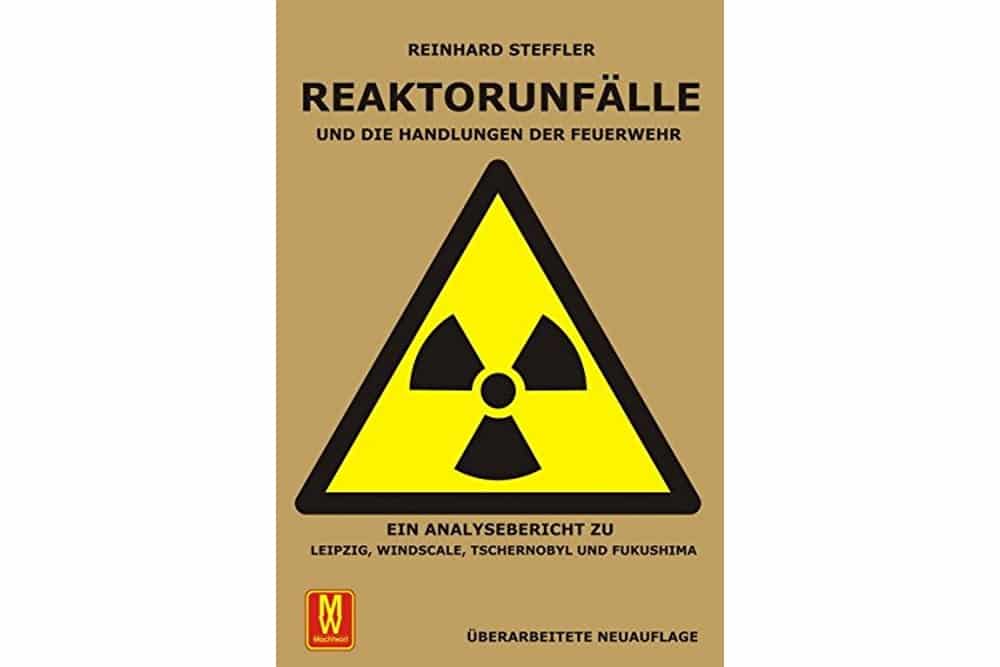










Keine Kommentare bisher