In den Buchhandlungen liegen wieder die Stapel mit Aitmatow-Büchern. Im Herbst wäre der Autor aus Kirgisien, der mir „Djamila“ Weltruhm errang, 90 Jahre alt geworden. Sein Todestag jährt sich zum zehnten Mal. Für Irmtraud Gutschke, die sein Werk in der DDR einst aufmerksam und helfend begleitete, ein handfester Grund darüber nachzudenken, warum dieses Werk auch heute noch die Leser erschüttert.
Sie nennt es „Reisen in Aitmatows Welt“, was vieldeutig klingt – und genauso verwirrt wie so mancher Aitmatow-Titel. Natürlich geht es um die intensiven Reisen in seine Geschichten-Welt, aber auch Reisen in seine Heimat. Reisen, die Irmtraud Gutschke wirklich unternommen hat, sodass sie mit eigenen Augen sah, wie sehr Tschingis Aitmatow seine Geschichten direkt aus den Erlebnissen seiner Kindheit schöpfte.
Was möglicherweise für seine westlichen Leser hochgradig exotisch wirkte, war gelebte Realität, echte Armut, echte Aufbruchsstimmung, war tiefe Verwurzelung in den kirgisischen Legenden, Mythen und Liedern und in einer Kultur, in der die Familie deshalb eine so prägende Rolle spielte, weil sie noch immer der wichtigste Schutz für den Einzelnen gegen Hunger, Kälte und die Gefahren einer rauen Welt war, die erst mit dem Sozialismus aufbrach in eine neue Zeit.
Darin steckte auch viel Hoffnung. Eine Hoffnung, für die auch Männer wie Aitmatows Vater Torekul standen, der zu den jungen Kadern – wie das damals hieß – in der jungen Sowjetrepublik Kirgisien gehörte, nach Moskau entsandt auf die Parteischule, um sich auf höhere Ämter vorzubereiten und dann 1937 in die Mühlen der Stalinschen Vernichtungspolitik geriet. Ein Trauma für seine Kinder und seine Frau, die sogar über sein Schicksal jahrelang im Unklaren gelassen wurden.
Auch das eine Reise in Aitmatows Welt: Wie keine Andere kennt Irmtraud Gutschke alles, was zu Tschingis Aitmatow veröffentlicht wurde, auch all die Veröffentlichungen in Russland, in denen sich Weggenossen und Kinder an den berühmten Schriftsteller erinnern und an die lange Spurensuche zu seiner Kindheit, zum Verschwinden Torekuls und der späten Aufklärung über sein Schicksal.
Und wenn man das alles endlich weiß, dann liest man Aitmatows Bücher noch einmal mit anderen Augen. Und genau das hat Irmtraud Gutschke wohl auch wieder getan – und so den Jungen (wieder-)entdeckt, der in Aitmatows Geschichten immer wieder auftaucht, der mit dem Verlust des Vaters umgehen muss und sich trotzdem nach ihm sehnt. Das sind Erzählstränge, die man meist überliest, weil man so erpicht ist auf die Große Botschaft in Aitmatows Texten.
Die steckt natürlich immer drin. Denn kaum ein Schriftsteller in der damaligen Sowjetunion hat so intensiv die Suche nach dem richtigen menschlichen Verhalten ins Zentrum seiner Bücher gestellt – wissend darum, dass der Mensch immer wieder in Zwiespalt gerät mit sich selbst, mit seiner Familie und der Natur. Konflikte, die auch im kirgisischen Mythos immer präsent sind. Man konnte „Djamila“ als „die schönste Liebesgeschichte der Welt“ (Aragon) lesen, aber auch als die Geschichte eines bitteren Verlustes voller Tragik.
Aber auch als eine aufmüpfige Geschichte, denn hier begehrt eine junge Frau, die in einer hochgradig traditionellen Gesellschaft aufgewachsen ist, gegen Konventionen und Selbstverständlichkeiten auf. Es war wohl die eindrucksvollste Geschichte über weibliche Emanzipation, die im Osten je geschrieben wurde.
Und man muss nicht erst nach Kirgisien fahren, um zu spüren, dass das noch heute gilt. Wahrscheinlich noch viel mehr. Buch für Buch taucht in Irmtraud Gutschkes Essay auf – denn das ist er ja eigentlich: Ein Text, der intensiv und kenntnisreich die ganze Erzählwelt des kirgisischen Autors noch einmal auslotet und die Motive erforscht, die diese Bücher so stark machen, die Leser mitleiden lassen und in ihnen das Gefühl erzeugen, ungemein starke Charaktere vor sich zu haben, für die es selbstverständlich ist, sich für andere einzusetzen und den richtigen Weg in ihrem Leben zu gehen.
Jede Geschichte stellt ihre Helden in kaum lösbare Konflikte, stellt große moralische Fragen – und nie macht es sich Aitmatow einfach. Er bedient nie die simplen Erwartungen seiner möglichen Kritiker in der Sowjetunion, aber auch nicht die platten Happyends, die manch westlicher Leser gewohnt war. Manchmal zerreißt es dem Leser regelrecht das Herz, wenn er sieht, wie die so intensiv erlebten Helden scheitern oder auch voller Überzeugung in ihren Untergang gehen. Und oft liegt gerade in diesem Scheitern die Hoffnung. Denn was bleibt, ist ja immer die erzählte Geschichte selbst. Eigentlich etwas Selbstverständliches.
Aber manchmal muss es einem doch wieder jemand erzählen wie Irmtraud Gutschke, die als Literaturredakteurin ausgerechnet beim Parteiorgan „Neues Deutschland“ dafür kämpfte, dass alle Aitmatow-Titel auch in der DDR erscheinen konnten. Auch jene, bei denen die DDR-Zensoren anfingen, die Panik zu bekommen. Denn mit „Der Tag zieht den Jahrhundertweg“ (1982) und „Die Richtstatt“ (1986) stellte Aitmatow ganz unübersehbar das infrage, was aus dem Sozialismus in der Sowjetunion (und im Ostblock) geworden war.
Der letztlich in die planetarische Dimension geweitete Blick zeigt, auf was für einem irren Weg nicht nur der tönerne Koloss UdSSR längst war. Dabei entstanden beide Bücher in Zeiten der aufkeimenden Hoffnung. Aitmatow wurde ab 1985 zu einem der wichtigsten Stichwortgeber für Michail Gorbatschow. Auch er setzte gewaltige Hoffnungen auf Glasnost und Perestroika. Und wenn Gorbatschow vom planetarischen Bewusstsein sprach und von der Verantwortung für unseren Planeten, dann ist das von Aitmatow.
Und wenn man das erst einmal weiß, dann liest man seine Bücher natürlich auch unter diesem Blickwinkel und merkt, welch bindende Rolle in allen seinen Geschichten die belebte Natur spielt, wie die bei ihm auch als Helden auftauchenden Tiere eigentlich zwei wichtige Fragen stellen: Die nach unserem Verhältnis zur verletzlichen Natur. Und die nach unserem Verhältnis zu uns selbst.
Dafür stehen die Wölfe in seinen Geschichten genauso wie der Hengst Gülsary oder der Schneeleopard aus seinem letzten Roman. In unserem Verhältnis zur lebendigen Natur zeigt sich unser Charakter. Dass gleichzeitig auch ein tiefer Pessimismus alle Werke Aitmatows durchzieht – man entdeckt es mit Irmtraud Gutschke aufs Neue, die sich hier eines Autors mit frischer Aufmerksamkeit versichert, der eigentlich in eine 1990 untergegangene Zeit zu gehören schien – und der beim Wiederlesen eigentlich erst richtig zeigt, dass das „Experiment Sozialismus“ vor allem an einem scheiterte: an der Unfähigkeit, aus dem alten, fast feudalen Denken auszubrechen.
Ein Denken, das uns – das darf man wohl sagen – überhaupt nicht fremd ist. Denn wo immer es um Macht, Geld und Einfluss geht, versuchen menschliche Leidenschaften das Regime zu übernehmen: Gier, Selbstsucht, Elite-Denken. Dann werden manche Menschen wieder zum Raubtier. Und sie kennen keine Skrupel, auch noch das letzte wilde Tier zu erlegen, Länder zu verwüsten und Menschen ihrer Existenzgrundlage zu berauben.
Etliche Aitmatow-Geschichten erzählen davon, wie schnell eine Unbesonnenheit oder Hass ein Leben zerstört, Hoffnungen vernichtet und die Mühe eines ganzen Lebens zunichte macht. Worüber Aitmatow ja auch deshalb schreiben konnte, weil er das alles selbst erlebt hat. Bis hin zu diesem Urerlebnis, wie viel Hoffnung darin steckt, wenn nach einem harten Hungerwinter die Kraniche wieder ziehen. In aller Bitternis – so Gutschke – scheint bei ihm immer auch die Hoffnung auf.
Es sind keine zimmertemperierten Geschichten. Es sind hochemotionale Geschichten, die ihre Helden in der Regel in Situationen zeigen, aus denen sie nicht ausbrechen können, in denen sie dazu verdammt sind, eine Entscheidung zu treffen. Und gerade deshalb fiebert man als Leser mit – weil viele dieser Entscheidungen eigentlich nicht auszuhalten sind. Und trotzdem reißen sie uns mit, weil sie uns an der Wurzel packen, da, wo wir Mensch sein wollen, wohl wissend, dass wir soviel Rückgrat nicht immer aufbringen. Und Aitmatow wusste es ja selbst. Die Geschichten spiegeln – man erfährt es ja mit Irmtraud Gutschke – auch all die Konflikte seines Lebens und Liebens. Da schrieb auch einer, der wusste, wie wenig man sich gegen die Liebe wehren kann. Und wie einen das innerlich zerreißt.
Damit setzte Aitmatow Maßstäbe, die auch im scheinbar so zufriedenen Westen gelten. Und auch hier immer drängender werden. Denn so mancher dürfte sich, als in „Die Richtstatt“ vom Mankurt erzählt wurde, gefragt haben, ob er eigentlich wirklich sein Leben lebt – oder doch nur den Befehlen und Erwartungen anderer Leute folgt, selber willenlos, nur zu bereit, auch das Liebste zu opfern, wenn es nur jemand befiehlt.
Spätestens mit „Die Richtstatt“ war klar, dass Tschingis Aitmatow die ganz großen Menschheitsfragen ansprach. Das, was er selbst planetarisches Denken nannte, und das heute so rar geworden ist, weggeräumt mit dem für lächerlich erklärten Experiment Gorbatschows. Gier, Neid und Zwietracht scheinen wieder die Kräfte zu sein, die die Welt regieren.
Da wirken Aitmatows Bücher natürlich umso stärker, umso nachhaltiger. Und mit Irmtraud Gutschke erschließt man sich diese Welt und auch den Schriftsteller, der sie erschaffen hat, herausgeschrieben hat aus sich. Solange die Kraniche ziehen, gibt es Hoffnung. Es sei denn, jemand liegt auf der Lauer und bereitet diesem Stück Leben den Garaus. So weit entfernt ist uns weder die Welt aus „Frühe Kraniche“ noch die aus „Der Schneeleopard“. Die Landschaften wirken nicht einmal exotisch, sondern sehr vertraut. Als wären es unsere inneren Landschaften, in denen sich Aitmatows Helden den Gefahren ihres Lebens stellen.
Landschaften, die um vieles stärker sind als das meiste, was westeuropäische Autoren an Schilderungen fertigkriegen. Was auch daran liegt, dass Aitmatow noch den unverstellten, den mythischen Blick auf seine Landschaften hat. Etwas, worüber Irmtraud Gutschke ja schon 1986 schrieb in „Menschheitsfragen, Märchen, Mythen“, auch wenn sie heute die Betonung von Legende und Mythos deutlich zurücknimmt.
Denn wenn man sich zu sehr darauf konzentriert, überliest man schnell, dass Aitmatow über echte menschliche Konflikte schreibt, solche, die unser Leben wirklich ausmachen, wenn wir den Blick vom Oberflächlichen abwenden und unsere Sehnsucht suchen, unsere Liebe und unsere tiefe Verbundenheit mit diesem einmaligen Planeten, den wir nicht retten können, wenn wir nicht beginnen, ein planetarisches Bewusstsein zu entwickeln.
Irmtraud Gutschke Das Versprechen der Kraniche, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2018, 16 Euro.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
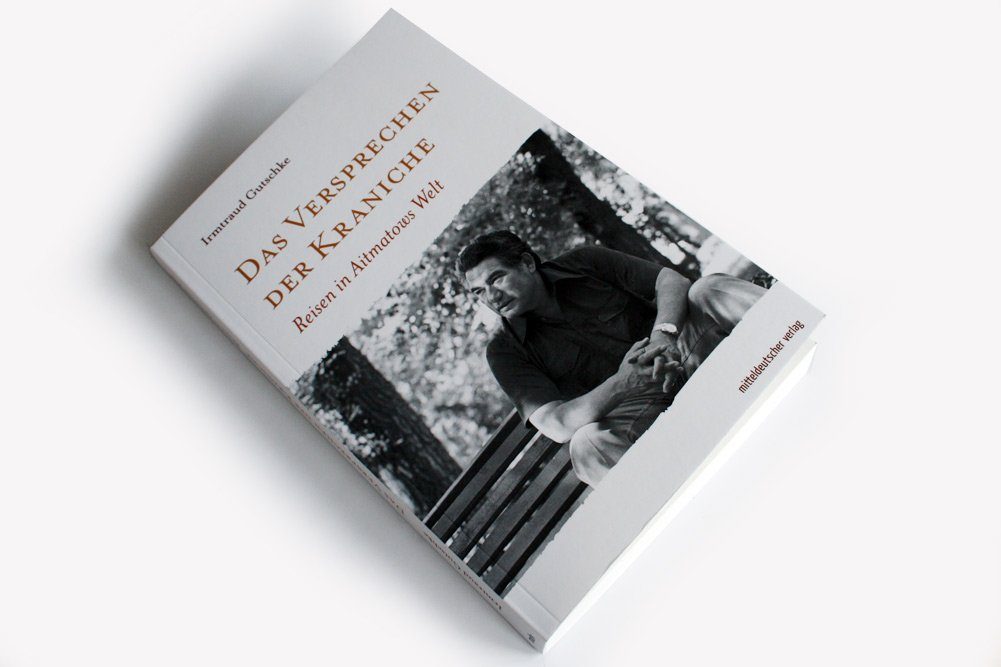








Keine Kommentare bisher