Manager kommen nicht in den Himmel. Und ihr Humor ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Der Schweizer Peter Beeler-Scheidegger war selbst „Jahrzehnte lang im Topmanagement“ tätig. Er kennt also die Kollegen, die Welt, in der sie leben, und ihre Denkweise. Und er hat so eine Ahnung, was dieses Denken in der Welt anrichtet. Und mit den Menschen. Sind Manager noch zu retten? Wenigstens einer? Ein gewisser Saladin, der tatsächlich im Himmel landet?
Oder vielmehr: Den der Autor dort landen lässt, etwas verwirrt, weil Manager mit so viel unproduktiver Untätigkeit nichts anfangen können. Denn wenn man es recht bedenkt, landen im Himmel genau die Leute, die von knallharten Managern am liebsten gefeuert, fertiggemacht und ausgebeutet werden. All jene, die sich nach 30, 40, 50 Jahren Schinderei danach sehnen, endlich in Ruhe gelassen zu werden, nicht mehr funktionieren zu müssen wie ein Hamster im Laufrad.
Und weil Saladin nie gelernt hat, einfach mal loszulassen, schlägt er jetzt Gott und Petrus vor, im Himmel mal ein bisschen aufzuräumen, den Himmel quasi wettbewerbsfähiger zu machen. Nur geht das halt mit dem vorhandenen Personal nicht. Weder die Seelen der Verstorbenen noch die Engel haben die mindeste Lust, dem Mann in seiner Optimierungs- und Sanierungswut zu helfen.
Weshalb er sich nach Verbündeten umschaut, wo seine Berufskollegen alle gelandet sind: beim Teufel. Der natürlich nur zu bereit ist, mit Saladin ein ordentliches Geschäft zu machen. Was auch beinah zustande kommt, würden nicht Gott und Petrus dazwischenfunken. So war das nicht gedacht, als sie Saladin die Organisationsgeschäfte im Himmel anvertrauten.
Aber was macht man mit dem Manne? Sie geben ihm eine Chance. Er darf noch einmal auf die Erde. Nicht nur einmal, sondern vielmals. Bis er all die Dinge gelernt hat, die einen Menschen befähigen, gut zu sein. Denn darum geht es eigentlich. Auch wenn es Beeler-Scheidegger am Ende als „himmlischen Frieden“ begreift, was seinen Saladin endlich ins Reine kommen lässt mit sich und der Welt.
Denn das merkt man bald. Und es klingt wie selbst erlebt, wenn Beeler-Scheidegger erzählt, wie Manager tatsächlich ticken – nicht nur die in der Wirtschaft. Es kommen auch einige aus der Kirche, der Politik und dem Militär vor. Und Saladin schlüpft auch in ihre Haut, um darin im Grunde dasselbe zu erleben, was er auch schon in seinem tatsächlichen Job als Manager erlebt hat: Man landet in solchen Hierarchien nicht ganz oben, wenn man ein ganzer Mensch ist, der mit sich im Reinen ist, der jene Gelassenheit hat, die Saladin erst nach seinem sechsten oder siebenten Tod so langsam findet – typischerweise in einem tibetanischen Kloster, so einem, in das auch reale Manager gern fliehen, wenn sie meinen, ihre Batterie wieder aufladen zu müssen, weil sie sich ausgebrannt fühlen. Um danach dann wieder weiterzumachen in einem Job, in dem sie wieder nur Getriebene sind.
Nein, so lustig, wie Beeler-Scheidegger es ankündigt, wird das Buch nicht. Es sei denn, Menschen in solchen Führungspositionen hätten tatsächlich so einen etwas zynischen Humor. Was man sich gut vorstellen kann. Denn eines merkt man bald: Manager sind einsam, verdammt einsam. Denn sie leben in einer Welt, in der ihnen stets jemand den Job und die tolle Bonifikation streitig macht. Von unten drücken lauter Gleichartige nach, die der festen Überzeugung sind, es genauso gut, wenn nicht gar besser zu machen.
Und die alles tun, die Arbeit des Alten in Misskredit zu bringen. Und über jedem Manager sitzen die eigentlichen Chefs – die Aufsichtsräte und Aktionäre, die die Führungsmannschaft nur nach einem bewerten: Wirft das Unternehmen Gewinne ab? Und steigen sie bittesehr? Und da sie das aller Vierteljahre erwarten, werden Manager zu Getriebenen und sind permanent auf der Suche nach Lösungen, noch mehr Geld aus der Firma zu pressen.
Die Rezepte kennen wir alle. Sie gehen so gut wie alle auf Kosten der Umwelt und der Angestellten, die als entbehrlich gelten. Oder der Gemeinschaft, die man dann gern auch noch um ehrliche Steuern bescheißt. Es wird outgesourct und verschlankt. Und so ganz beiläufig gibt Beeler-Scheidegger einen tiefen Einblick in das Seelenleben seines Managers. Denn dieser Saladin ist typisch, wahrscheinlich viel typischer, als selbst der Autor glaubt. Denn er hat verinnerlicht, wie man als Manager in hohe Positionen kommt. Und das war nicht nur ein Lernprozess. Es hat seinen Charakter geformt.
Er hat all die Managersprüche verinnerlicht, die man alle schon mal irgendwo gehört hat, aber nicht unbedingt mit Managerkursen und Karriereseminaren in Verbindung bringt. Diese hier zum Beispiel: „Die Großen fressen die Kleinen, die Schnellen die Langsamen.“ Oder: „Wir müssen uns auf das Kerngeschäft konzentrieren.“ Oder „Abläufe verkürzen, Auswahlverfahren vereinfachen, Synergien bündeln“, wie es der Teufel vorschlägt. Manager grübeln nicht, Manager machen. Und wenn sie die ganze zweite Führungsebene entlassen, „um neuen Schwung in den Laden zu bringen“.
Saladins Aufenthalte auf der Erde werden regelrecht zu einem Chrashkurs in Selbsterkenntnis. Denn gelernt hat er vor allem eins: Chefs zeigen keine Schwäche, sie müssen immer und überall den Macher zeigen, eine glänzende Performance hinlegen. Sie lernen vor allem, hart zu sich selbst zu sein und auch beim Survival-Kurs über ihre Grenzen zu gehen.
Das kennt man irgendwie. Das kommt einem sehr vertraut vor. Das sind die Typen, die in unserer Gesellschaft den Ton angeben und jenes Klima erzeugen, in dem „Minderleister“ verachtet werden und selbst die kleinsten Angestellten lernen, dass sie bei aller Schikane stets zu lächeln haben. Es entsteht ein Klima, in dem der Manager ständig in Angst lebt, seinen Job loszuwerden, weil er nicht genug leistet, weil ihm nichts mehr einfällt, den Laden aufzumischen, weil der Aufsichtsrat das Gefühl haben könnte, er könnte zu weich geworden sein, nicht mehr gut genug „performen“.
Und so eilt auch Saladin Tag für Tag zur Arbeit mit dem Druck im Bauch, jetzt schnellstens wieder eine Aktion starten zu müssen, Tatkraft und Durchsetzungsvermögen zu zeigen und allen zu beweisen, was für ein knallharter Macher er ist. Wirklich zufrieden ist er nie, denn das gnädige Wohlwollen des Aufsichtsrates kann schon morgen wieder verscherzt sein. Wer liest, wie Saladin immer wieder in seine angelernten Gewohnheiten zurückfällt, der ahnt so ein wenig, warum die Manager der großen Konzerne so kopflos in immer neue Katastrophen steuern, faule Deals eingehen und auch immer weniger Risiko zulassen. Denn wer etwas Neues wagt, das nicht gleich morgen Früchte trägt, riskiert seinen Job. Dem wird „das Vertrauen“ entzogen.
Auch diese Stelle gibt es im Buch, an der Saladin (noch) zufrieden darüber nachdenkt, wie schön es ist, das Vertrauen der Aktionäre zu genießen. Nur eins hat er nicht: Urvertrauen. In der Hülle des durch großes Ego und blendendes Selbstvertrauen schillernden Machers steckt ein Mensch, der weder seinen Mitarbeitern noch der Welt vertraut. Und sich selbst auch nicht. Die knallharten Sprüche sind Durchhalteparolen. Deswegen ähneln militärische Karrieristen so auffällig Wirtschaftskarrieristen und politischen Karrieristen, die alle von der blendenden Show des Kerls leben, der „ohne Rücksicht auf Verluste“ regiert und agiert. Machertypen. Führerfiguren.
Und die dafür auch jede Menge Aufmerksamkeit von willfährigen Medien bekommen. Oder sollte man nicht lieber schreiben: opportunistischen Medien? Denn so nach dem dritten oder vierten Tod beginnt auch Saladin zu begreifen, dass er sich die ganze Zeit wie ein Opportunist verhalten hat. Er hat geliebedienert nach oben und nach unten getreten. Und er weiß, dass es alle seine anderen Mitkarrieristen genauso gemacht haben. Und genauso machen. Denn keiner von ihnen ist sein eigener Herr. Sie kaschieren ihre Rolle des funktionierenden Angestellten nur durch große Show. Eine Show, in der ihr enges Gedankenkorsett geradezu als heilige Weisheit verkauft wird. Wirklich zum Lachen wird das Büchlein nicht, auch wenn es sich Beeler-Scheidegger wünscht. Dazu zeigt es zu viel aus dieser Welt der Männer, die auch noch Weib und Kind an den Teufel verkaufen würden, wenn es ihnen nur den kleinsten geschäftlichen Vorteil bringt.
Es ist diese fast schon zynische Analyse der Gedankenwelt der heute so typischen Manager, die das Buch auch ein wenig zum Erkenntnisbuch macht: Man lernt mit diesem Saladin, wie all die Kerle ticken, die heute in verantwortlichen Positionen sitzen und alles dafür tun, dass alles so (weiter-)läuft wie es läuft. Dass die Maschine ja nicht ins Stottern kommt oder die Menschen gar zur Besinnung kommen.
Eigentlich schickt ihn Gott immer wieder hinunter auf die Erde, damit Saladin seine Manager-Kolleg/-innen dazu bringt, von diesem rücksichtslosen Agieren abzulassen, gelassener zu werden, wieder Humor und Menschlichkeit in die Welt zu bringen. Also zu lernen, dass die Welt nicht untergeht, wenn man gelassener, nachdenklicher und rücksichtsvoller wirtschaftet.
Auch wenn die letzte Geschichte darauf hindeutet, dass es Saladin doch noch gelingt, indem er wirklich gegen jede angelernte Regel der Vermarktung verstößt und damit Riesenerfolg hat, bleibt die Skepsis. Dazu bleiben die Menschen um Saladin zu schemenhaft, werden nicht greifbar. Nur er selbst gewinnt tatsächlich die Gelassenheit, die ihm endlich den Frieden mit sich selbst bringt. Er muss sich nicht mehr rechtfertigen. Nichts mehr erklären.
Er hat sich also quasi selbst erlöst.
Auch vom „wichtigen Managerwissen“, das der Umschlagtext verspricht. Wie Unternehmensführung anders sein könnte – kooperativer zum Beispiel, solidarischer und einfühlsamer – das deutet Peter Beeler-Scheidegger bestenfalls an. Wohl auch deshalb, weil es dafür kaum positive Beispiele gibt, unter den großen Konzernen schon gar nicht. Gerade dort ist der Druck auf die Manager besonders hoch und gnadenlos.
Auch das Lösungsangebot in der letzten Geschichte stellt „Wettbewerb“ und „Erfolg“ in den Mittelpunkt, eigentlich so ähnlich, wie in den großen „Spaßkonzernen“, die sich gern als jung und kreativ verkaufen, in wirtschaftlichen Entscheidungen aber genauso rücksichtslos sind wie die „alten“ Konzerne.
Der Leser fühlt sich also keineswegs miterlöst. Und so ganz lustig ist ihm auch nicht zumute. Denn dass die knallharten Entscheider keineswegs dabei sind, sich in freundliche Saladine zu verwandeln, das ist ja nun leider unübersehbar. Eher werden sie noch bissiger und rücksichtsloser, denn sie merken ja ebenfalls, dass ihre Art des Wirtschaftens gerade unsere Lebensgrundlagen zerstört.
Während ihre Aktionäre immer weiter schöne satte Gewinne und Dividenden erwarten. Da verengt sich der Fokus, da wird Panik zum Dauerzustand. Eine Panik, die die überbezahlten Zampanos ja gerade mit all ihrer Macht in die Gesellschaften des Westens drücken. Sirenen im Nadelstreifenanzug, könnte man sagen. Nur einer ist gerettet: Saladin.
Peter Beeler-Scheidegger „Ein Manager im Himmel“, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2019, 13,90 Euro.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
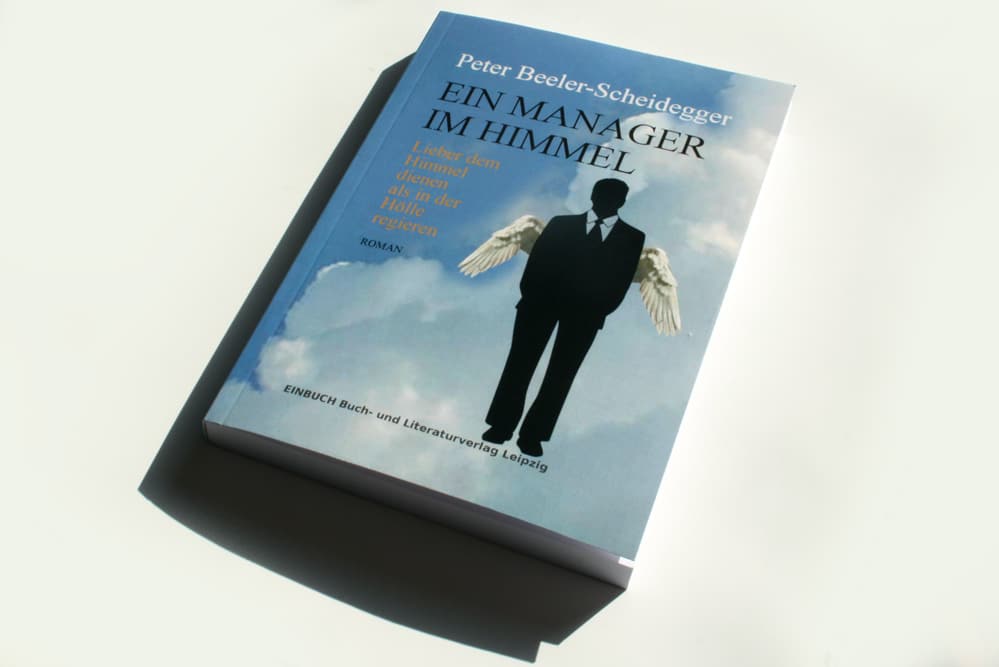








Keine Kommentare bisher