Er ist der Held in Volker Surmanns Roman "Extremly Cold Water", Social-Media-Mann in einer Berliner Werbebude, nicht wirklich üppig bezahlt, aber es reicht wohl zum Leben, wenn man bereit ist, sich jeden Tag in die Agentur zu bemühen und sich wilde Marketingideen einfallen zu lassen für Produkte, die so hipp sind, dass sie wirklich keiner braucht. Eine Lebensgefährtin hat er auch - aber die ist fast immer für eine Umweltorganisation auf Reisen, also eigentlich nicht richtig da, aber arg besorgt, dass der Beziehungsstatus gepflegt wird. Dreifacher Stress also, den manche Leute heutzutage für normal halten. Wahrscheinlich bis sie austicken, ausbrennen oder einfach tot umfallen.
Eugen Thomas scheint davon noch weit entfernt, als er sich mitten im Stau entschließt, einfach aus dem Auto zu steigen, es stehenzulassen. Einfach so. Dann kauft er sich im nächstbesten Schuhladen Wanderschuhe, bucht sich einen Flug in die USA. Und weil ihm so schnell kein anderes Ziel einfällt als der Name auf der Schuhhaustüte, ist es halt Reno. So einfach, so gut. Und so flott. Denn Surmann hat sich keinen Grübler, keinen zerbrochenen Menschen zum Helden gemacht. Selbst während er lauter Dinge tut, für die andere Leute all ihren Mut und ihr Geld zusammenraffen müssen, denkt dieser Eugen noch recht verwundert darüber nach, wie verrückt das eigentlich ist, was er da tut. Und tut’s trotzdem.
Er lässt ein Meeting platzen, riskiert seinen Job, gibt Geld aus, das eigentlich für den nächsten Urlaub mit Bille gedacht war, und checkt dann auch noch unter verdrehtem Namen ein. Nur weg. Aber warum nur? Und weil er nicht zögert, nimmt ein Abenteuer seinen Lauf, wie man es aus den schönsten amerikanischen Roadmovies kennt, verzockt er in seiner ersten Nacht in Reno sein ganzes Geld und den Dispokredit seiner Bank noch dazu. Als er nach einem etwas überhasteten Aufbruch am Lake Tahoe landet, ist er restlos pleite, hat seinen Bankberater zutiefst beleidigt und der Beziehungsstatus zu Bille hat sich auch online ins Negative gedreht. Und wie er so drüber nachdenkt, muss er sich eingestehen: Es ist ihm eigentlich egal. Manchmal braucht man tatsächlich ein paar tausend Kilometer Distanz, um sich selber einzugestehen, dass dieser unverständliche Schritt eigentlich längst dran war. Man muss ihn nicht erklären. Er erklärt sich von selbst.
Auch wenn dann am Zielort guter Rat teuer ist. Was in diesem Fall zwar zu vielen (auch für den Leser) recht aufregenden Situationen führt, denn ohne Geld hat man auch nicht viele Chancen, noch irgendwie gesetzeskonform durchs Leben zu kommen, aber gleichzeitig gewinnt die Geschichte eine Leichtigkeit, wie man sie an guten Aussteigergeschichten mag. Die Sache rollt. Auch weil sich Eugen Thomas einlässt auf die Menschen, die ihm begegnen. Irgendwie will er ja doch wissen, warum er so holterdipolter alles hat stehen und liegen lassen, um in einem Nest im amerikanischen Westen zu landen, das vor allem durch eine Schriftart berühmt wurde: Tahoma.
In guten Roadstories treffen sich die Windverwehten, das ist zwangsläufig so. Die Seelenverwandten, denen im Leben irgendwie dasselbe passierte. In diesem Fall ist es der zehnjährige Joshua, der seinen Alltag im Haus am See mehr oder weniger allein bewältigt, und der Callboy Phil, der in Eugens Unterschlupf poltert, weil er irgendwie seinen Gefühlen hinterher jagt. Dass alle drei wenig später zu einer Rettungsmission zu Joshuas Schwester Liza im Nachbarstaat Oregon aufbrechen, schwant ihnen zwar noch nicht. Aber in so einer Geschichte vor der traumhaften Kulisse des Lake Tahoe ist alles möglich. Und Eugen ist eh längst soweit, dass er auch für die verrücktesten Sachen zu haben ist, auch wenn in ihm noch – durchaus als Über-Ich präsent – der ganze deutsche Zweifel sitzt, ob das denn alles gut gehen kann und richtig ist. Die alte Panik, die unsereins in diesem von Ängsten besessenen Land treibt, nur ja alles mitzumachen, was verlangt wird, um ja nicht auf- oder gar auszufallen, hübsch verpackt in eine aufgesetzte Coolness, die nichts als Hülle ist, ein bunter Flitter für die Mäuse im Laufrad.
Am Ende sitzt Eugen mit den anderen in einer schrottreifen Karre und lernt wieder ein Stück echtes Amerika kennen, auch dessen ganze jämmerliche Provinzialität außerhalb der leuchtenden großen Cities. Er lernt auch Joshuas Schwester kennen und ihren tätowierten Musikerfreund. Und am Ende staunt er auch nicht mehr, wie leicht er sich in dieser Gruppe Gleichgesinnter wiederfindet und wie sehr sie alle durch das Thema ihres Lebens verbunden sind: die Flucht. Auch wenn jede Flucht ein bisschen anders ist und andere Gründe hatte. Sie brauchen es auch nicht extra zu sagen, dass sie eher nicht die Kämpfer- und Draufgängertypen sind. Solche wie der gewalttätige Darren, der Anlass war für die große Tour. Aber ist das ein Grund zum Verzweifeln? Eigentlich nicht.
Auch wenn Eugen noch einmal einen dieser Schreckmomente erlebt, als er nach zwei Wochen zurückfliegen will nach Deutschland und ihm ein staubtrockener Zeitgenosse erklärt, dass er das mit seinem Ticket nicht kann. Es gibt ein paar dieser innigen Schrecksekunden im Buch, mit denen Surmann seinen Stoff so richtig schön auf die Spitze treibt. Ist ja nicht nur der verdatterte Eugen Thomas, der sich bisher immer so sicher gefühlt hatte in den Koordinaten einer durchorganisierten Welt, die eigentlich keine Freiräume lässt für persönliche Ausfluchten, gar wilde Richtungsänderungen mitten auf der Fahrbahn des Lebens.
Raus aus dem falschen Leben: Ein Himmel voller Haie
Wie fühlt man sich …
Es klingt wie ein Filmtitel …
Die Rückkehr des Wassermannzeitalters: Jorge auf der Suche nach der Weltenformel
Wie viele Bücher über den Versuch …
Krimi, Road-Movie, Aussteigerroman? – Karls Flucht aus der schönen heilen Welt wegwohin
Auch “Jenseits der Dunkelwelt” …
Eine Liebesgeschichte der besonderen schwejkschen Art: Tatar mit Veilchen
Wenn dieses Buch nicht unter …
Es ist auch keine Überraschung, dass dieser Roman von einem Autoren aus der großen Welt der Berliner Lesebühnen geschrieben wurde, auch wenn Surmann schon 2010 seinen ersten Roman (“Die Schwerelosigkeit der Flusspferde”) vorgelegt hat. Denn kaum irgendwo wird das Thema des Aussteigens, des Nicht-mehr-Mitspielens vielfältiger und forscher durchgespielt als in den Texten der Berliner Bühnenautoren. Als dränge diese Stadt mit ihrer zunehmenden Gentrifizierung und Vermarktung auch noch der letzten wilden Nische geradezu zum Ausbruch. Surmanns Lesebühne sind die “Brauseboys”. Kein Problem für ihn, auch gleich noch drei Kapitel einzulesen. Sie sind auf der Verlagswebsite zu finden.
Natürlich beschreibt dieses auf Tempo erzählte Buch auch von Surmanns Faszination von Amerika, der Sierra Nevada, des Lake Tahoe und der Riesenburger, die es dort gibt unter der Bezeichnung Awful Awful. Aber die Pancakes scheinen noch eine Nummer heftiger zu sein. Und natürlich lebt die Geschichte auch davon, dass auch die ganz amerikanische Art, die Dinge einfach ohne allzuviele Skrupel anzupacken, mitwirkt als Gegenentwurf zu unserer ganz und gar German Angst, aus dem Raster zu fallen. Die Angst spielt mit in diesem Buch. Keine Frage. Beim Lesen merkt man bald, wie tief sie sitzt, wie viel Macht andere Leute über die eigenen Lebensregeln haben. Und wie tief die Panik sitzt, wenn die Regeln mal außer Kraft sind, irgend ein Webfehlerchen dafür sorgt, dass nichts mehr ist, wie es gestern noch schien.
So ein Stück Amerika fehlt uns. Eindeutig. Auch wenn Eugen dann am Flughafen auch einem leiblichen Vertreter des neueren, von panischem Sicherheitsbedürfnis getriebenen Amerika begegnet. Das Amerika, das wir mal träumten, ist genauso gefährdet wie unser eigener, wohlorganisierter Traum vom Glück. Wie dünn der Lack ist, merkt Eugen spätestens, als sich die Veränderung seines Beziehungsstatus zu Bille in einen Shitstorm im Sozialen Netz verwandelt. Einem kleinen nur. Die scheinbare Freiheit des Internet ist nicht wirklich eine. Sie ersetzt jedenfalls nicht das, was Eugen am Lake Tahoe geschieht: Die Begegnung mit zufälligen Weggefährten, die ihn so nehmen, wie er ist.
Eigentlich auch eine therapeutische Geschichte, wenn man’s recht betrachtet. Eine Mutmachergeschichte sowieso – für alle, die glauben, in der so mühsam aufgebauten Burg des Lebens müsse man es aushalten, egal, was passiert. Muss man nicht. Es braucht nur ein bisschen Mut, einfach mal den Trott zu verlassen. Oder so einen stocknüchternen Moment, wie ihn Eugen im Berliner Stau erlebt, als er aussteigt und losgeht. Nicht mal ahnend, wohin. Und so mittendrin in seiner Suche nach dem großen Wieso springt er ja dann ahnungslos in den eiskalten Lake Tahoe mit dem “Extremly Cold Water”. Manchmal braucht man das aber ganz dringend, um aufzuwachen, um wieder wahrzunehmen, dass man die ganze Zeit im falschen Traum war, im Traum anderer Leute, die alles mögliche von einem wollen, nur eines nicht: dass man sein eigenes Leben lebt.
Volker Surmann “Extremly Cold Water”, Voland & Quist, DResden und Leipzig 2014, 16,90 Euro
http://volkersurmann.de
Zu Buch und Leseproben:
www.voland-quist.de/buch/?199/Extremely+Cold+Water–Volker+Surmann
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
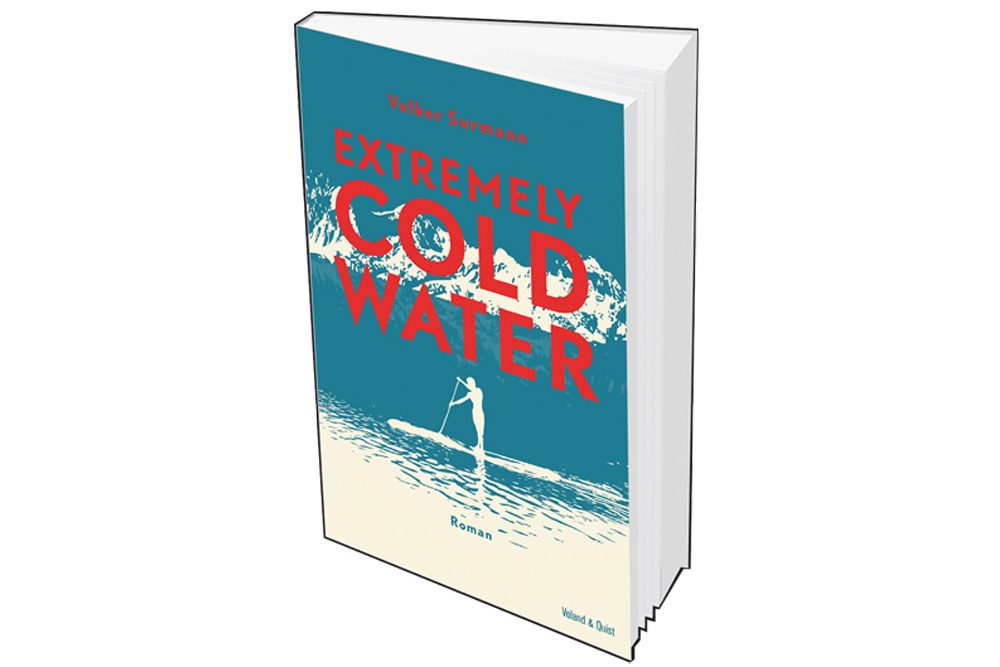









Keine Kommentare bisher