Mit dem Jahrbuch „Leipziger Stadtgeschichte“ gibt der Leipziger Geschichtsverein jedes Jahr ein Paket von Lesestoff heraus, das den Geschichtsinteressierten zeigt, was es an Leipzigs Geschichte noch alles zu erforschen gibt. Trotz einer ambitionierten vierbändigen Stadtgeschichte blieben noch viele Themen unbearbeitet und etliche Rätsel ungelöst. Wie das um den Namen der Stadt.
Das ist gleich der erste von zehn größeren Beiträgen, in denen die Autoren auch ein wenig ihren Vorlieben frönen. Was eine besondere Stärke von Regionalgeschichte ist: Sie erlaubt den unverstellten Zugang interessierter Historiker auch zu ganz speziellen Themen, die ihnen am Herzen liegen. Dem Briefnachlass des Slawisten August Leskien zum Beispiel (im Band sind seine Briefe an die Schwiegermutter abgedruckt), der Planung des Stadtteils Grünau in Zeiten, als sich Planer noch wie Schneekönige über völlig neue Stadtvisionen freuen konnten, oder den eindrucksvollen Skizzenbüchern von Heinrich Georg Drescher. Mit dem Thema beschäftigt sich Armin Rudolph, der erstmals eine Gesamtübersicht gibt über das, was dieser emsige Freizeithistoriker aus der Frühzeit des Leipziger Geschichtsvereins eigentlich hinterlassen hat in über 100 Skizzenbüchern, die auf den ersten Blick wie der Nachlass eines begabten Landschaftsmalers aussehen.
Doch die Bücher liegen nicht ohne Grund im Stadtgeschichtlichen Museum, denn Drescher zog Ende des 19. Jahrhunderts mit Skizzenbuch und Aquarellfarben los, um in tausenden, wirklich tausenden Skizzen die vom Abriss bedrohten historischen Gebäude sowohl in Leipzig als auch in seiner näheren Umgebung festzuhalten. Wohl wissend, dass der enorme Modernisierungsdruck der wachsenden Großstadt dafür sorgen würde, dass eine ganze Architekturepoche fast spurlos verschwinden würde.
Heute werden viele seiner Skizzen immer wieder abgedruckt, weil sie die einzigen authentischen Abbildungen vieler historischer Orte und Gebäude sind. Der Bestand ist dabei noch längst nicht ausgewertet. Das Museum bemüht sich darum, alle Skizzenbücher zu digitalisieren und damit tatsächlich erst vollumfänglich der Forschung zugänglich zu machen.
Manche Beiträge schreiben Forschungen fort, die anderswo schon umfangreich veröffentlicht wurden – und dennoch Fragen offenließen. So zu den Handwerkerausständen des 18. Jahrhunderts (Stichwort: Unruhiges Leipzig) oder dem zunehmend restriktiven Universitätszugang im 18./19. Jahrhundert (Stichwort: Geschichte der Uni Leipzig), den Jens Schubert ganz mutig einordnet in den zunehmenden Zugriff des aufstrebenden (Wirtschafts-)Bürgertums auf die Universitäten. Aus einem elitären Zugang der gehobenen Stände wurde ein neuer elitärer Zugang über Leistungsnachweise, die das Studium immer stärker davon abhängig machten, ob ein Bewerber auch die nötigen Zeugnisse beibringen konnte. Ein durchaus interessanter Zugang, den Schubert in die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft einfügt.
Augenscheinlich völlig unbearbeitet ist das Gebiet der sogenannten „Türkentaufen“ im späten 17. Jahrhundert, das mit der Beteiligung Sachsens an den Türkenkriegen zu tun hat. Die Sachsen waren auch im entscheidenden Jahr 1683 (Stichwort: Schlacht am Kahlenberg) dabei, als der Vormarsch der Türken auf Wien gestoppt wurde und der Krieg eine resolute Kehrtwende nahm. Was auch türkische Gefangene nach Sachsen brachte, oft genug als Sklaven. Ein Thema, das in den üblichen Werken zur sächsischen Geschichte so gut wie nie auftaucht. Genauso, wie bis heute das große Werk zu Sachsen als Kriegsmacht fehlt. Und damit ist nicht Wolfgang Gülichs akribische Aufarbeitung der sächsischen Armeegeschichte von 1813 bis 1914 gemeint, sondern der Einsatz sächsischer Armeen in der Zeit der Markgrafen und Kurfürsten – oft eben auch außerhalb des Landes wie im Krieg mit den Schweden oder eben vor Wien.
Tatsächlich machen die Jahrbücher des Geschichtsvereins ja auch deutlich, wie sich unser Blick auf Geschichte immerfort wandelt, neue Verbindungen sichtbar werden, die zeigen, dass Geschichte eben nicht nur der Karneval berühmter Herrscher ist, sondern stets mit ökonomischen und auch militärischen Veränderungen einherging.
Das Motto könnte durchaus lauten: Traue keinem Geschichtsbuch, das älter als 20 Jahre ist. Die Zahl ist willkürlich, stimmt. Und es gibt noch immer viel zu viele Abschreiber, die auch in neueren Publikationen den Quatsch von vor 100 Jahren kolportieren, obwohl er längst korrigiert ist. Fakenews fangen nun einmal damit an, dass Autoren nicht wissen, was sie da eigentlich verbreiten.
Manchmal fangen sie aber auch mit einer wollüstigen Schwindelei an, was Georg-Meyer Thurow am Beispiel von Johann Gottfried Seumes Lebenserinnerungen in „Mein Leben“ durchexerziert. Nicht das ganze Buch, das wäre dann wohl fast schon eine Lebensarbeit. Aber er hat sich einfach mal Seumes Schilderungen seiner Schulzeit an der Nikolaischule geschnappt und ertappt den beliebten Autor dabei, wie er sich seine Leipziger Schuljahre phantasiereich zurechtgeschwindelt hat. Was natürlich die alte Warnung bestätigt: Misstraut den Lebenserinnerungen großer Menschen. Sie tricksen sich das Bild zurecht, das sie gern vor der Weltgeschichte abgeben möchten. Die überlieferten Akten erzählen oft genug etwas völlig anders – zuweilen wesentlich weniger heroisch.
Und das trifft wohl auch auf Libzi und Libizken zu, womit sich der Namensforscher Karlheinz Hengst beschäftigt, der eher nur so nebenbei erwähnt, dass Libzi möglicherweise doch einen slawischen Ursprung haben könnte. Nicht – wie gern kolportiert – im Baumnamen Lipa, sondern im slawischen Wort für „der Hagere“. Was dann die Herkunft in der Zeit vor der Slawenbesiedlung infrage stellt. Aber das werde noch diskutiert, meint Hengst.
Ihn hat eher die bislang als späte Fälschung betrachtete Form Libizken interessiert, die in einer Urkunde aus dem Jahr 1050 vorkommt. Auch wenn die Urkunde wohl eine spätere Kopie ist, ist sie wohl keine Fälschung. Im Gegenteil. Sie scheint etwas zu verraten, was der Name Libzi noch nicht verriet: dass es auch im 11. Jahrhundert schon einen Begriff gab, der nicht nur den Burgward (Libzi) beschrieb, sondern auch den zugehörigen Burgwardbereich, also so ungefähr den mesto libzi, erkenntlich am Anhängsel k. Was Hengst dann zur Überzeugung bringt, es muss auch schon im 10. Jahrhundert einen (slawischen) Begriff für den Burgwardbezirk Libzi gegeben haben. Denn slawisch sprachen damals nun einmal die meisten „Leipziger“ – und zwar weit bis ins 11., 12., 13. Jahrhundert hinein. Die Amtsschreiber mussten zwangsläufig auch slawisch können und die slawischen Ortsnamen korrekt aufschreiben können. Erst nach und nach wurden die slawischen Ortsnamen eingedeutscht, ein Prozess, der im 15., 16. Jahrhundert zu Ende ging.
Ein Buch also voller neuer Ergebnisse auf zuweilen sehr speziellen Forschungsgebieten, aber auch ein schönes Zeichen aus der kleinen Leipziger Forschergemeinde, dass man mit der Stadtgeschichte noch lange nicht fertig ist. Auch bis zur nächsten Großen Stadtgeschichte nicht. Im Gegenteil: Wer sucht und neugierig ist, der findet Dinge, die wie lose Fäden in einen riesigen Wolleberg führen und neue Seiten an einer Stadt zeigen, die so oft in langweiligen Stereotypen erscheint, die man eigentlich nicht mehr hören mag nach allem, was in letzter Zeit schon ans Tageslicht kam.
Leipziger Geschichtsverein (Hrsg.) Leipziger Stadtgeschichte. Jahrbuch 2016, Sax Verlag, Beucha und Markkleeberg 2017, 15 Euro.
In eigener Sache: Abo-Sommerauktion & Spendenaktion „Zahl doch, was Du willst“
Abo-Sommerauktion & Spendenaktion „Zahl doch, was Du willst“
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
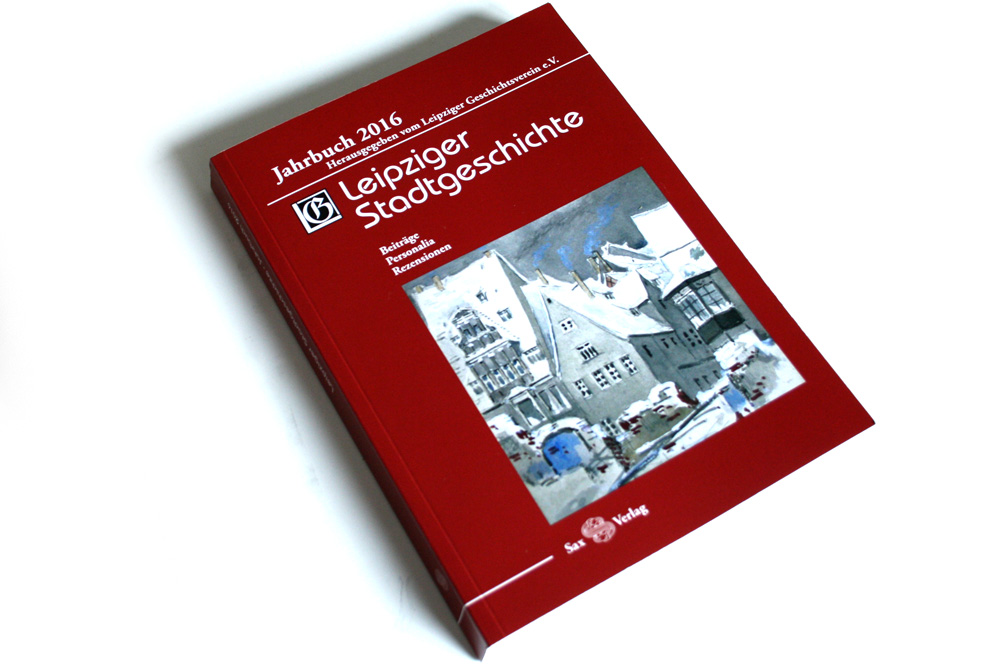









Keine Kommentare bisher