Auch ein liebenswerter Bär kann sich irren. Der liebenswürdige Bär heißt Harry Rowohlt. Man denkt, er ist immer noch da. Irgendwo wird er wohl gerade wieder einige seiner kauzigen Lesungen zelebrieren. Aber 2015 ist er gestorben – hat aber einige dicke Bände mit Briefen und Kolumnen hinterlassen. In einem seiner Briefe ist er sich sicher, dass es in Leipzig eine Ernst-Rowohlt-Straße gegeben haben muss.
Der Germanistikprofessor der Universität Wroclaw Tomasz Małyszek zitiert diesen Brief in seinem hier vorgelegten Buch, das vor allem das Schaffen von Harry Rowohlt würdigt und seine Übersetzertätigkeit einordnet in die literarischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. Wobei bei diesem Harry Rowohlt hinzukommt: Er hat die Rezeption irischer, englischer und amerikanischer Literatur in Deutschland viel stärker geprägt als die meisten anderen Menschen, die in Fleißarbeit die Werke der englischsprachigen Autorinnen und Autoren übersetzen.
Harrys Wahlverwandtschaften
Ohne Harry Rowohl ist die intensive Wahrnehmung von Autoren wie Flann O’Brien, Kurt Vonnegut, David Sedaris, Philip Ardagh oder Frank McCourt so nicht denkbar. Etliche seiner über 130 Übersetzungen präsentieren den Namen des Übersetzers genauso groß wie den des Autors. Viele Leser kauften die Bücher nicht wegen des Originalautors, sondern wegen Harry Rowohlt.
Denn sie wussten dann zwei Dinge ganz sicher: Sie bekamen eine erstklassige Übersetzung in die Hand, und sie lernten Autoren kennen, deren Humor dem ihres Lieblingsübersetzers nahekam. Auch wenn man manchmal nicht weiß: Ist es der Humor des Übersetzers oder tatsächlich der des Autors? Es sind eindeutige Wahlverwandtschaften. Und für manchen begnadeten Autor aus dem Angelsächsischen war Rowohlt der Türöffner in den deutschen Buchmarkt.
Auch wenn ihn viele seine Bewunderer vor allem mit A. A. Milnes „Pu der Bär“ identifizieren, einem Buch, das Harry Rowohlt schon als Kind begleitete und das er 1987 völlig neu übersetzte. Kenntnisreich, denn seine einstige Volontariatszeit in den USA sollte nicht umsonst gewesen sein. Er hatte auch das sichere Gespür für Slang, Phrasen und Werbesprech mitgebracht. Wer diese Nuancen nicht kennt, wird in Texten gerade satirischer Autoren vieles einfach überlesen und damit auch nicht herüber transportieren ins Deutsche. Und Milne ist so ein Satiriker, auch wenn Rowohlt um die am Ende doch sehr belastende Rolle des Autors für seinen Sohn Christopher Robin weiß, ohne den es die Pu-Gechichten nicht gegeben hätte.
Tomasz Małyszek geht mehrfach darauf ein, wie sich Rowohlt immer wieder auch mit den Vater-Sohn-Beziehungen der von ihm übersetzten Autoren beschäftigte. Ein Thema, das ja auch sein Leben bestimmte als Sohn des ja tatsächlich berühmten Ernst Rowohlt, der im Lauf seines Lebens drei Rowohlt Verlage gründete, den ersten 1908 in Leipzig – aus dem dann 1912 der Kurt-Wolff-Verlag wurde. Und es ist ja tatsächlich so, dass in keiner anderen Stadt in Deutschland so viele Straßen nach berühmten Verlegern benannt sind. Da hätte ja auch ein Ernst Rowohlt dabei gewesen sein können. Und irgendjemand muss das Harry Rowohlt auch so erzählt haben.
Nein, keine Ernst-Rowohlt-Straße
Der dann auch gleich noch einen richtig schwarzen Scherz daraus gemacht hat: „Dabei war mein Vater Ehrendoktor der Karl-Marx-Universität Leipzig, und es gab in Leipzig eine Ernst-Rowohlt-Straße. Die ist wahrscheinlich nach der Vereinigung in Dr.-Josef-Goebbels-Straße zurückbenannt worden.“
Ist sie natürlich nicht. Es gab nur eben nie eine Ernst-Rowohlt-Straße. Auch keine Kurt-Wolff-Straße. Das mit dem Ehrendoktor aber stimmt. Den bekam Ernst Rowohlt 1957 zum 70. Geburtstag. Da hatte er 1946 in Hamburg schon seinen dritten Rowohlt Verlag gegründet, von dem auch Harry Rowohlt, Sohn aus Ernst Rowohlts vierter Ehe, zur Hälfte (49 %) erbte. Aber sowohl seine Berufskarriere als auch seine späteren deutlichen Äußerungen in Briefen und Kolumnen machten deutlich, dass dieser begabte Harry nicht vorhatte, den Weg einzuschlagen, den sein Vater für ihn vorgesehen hatte.
Obwohl er seinem Vater durchaus zugestand, dass er ihm eine für seine Zeit ungewöhnlich reiche Bildung hat zukommen lassen – natürlich durch Bücher. Und auch durch Bücher aus dem amerikanischen Literaturkreis, die Ernst Rowohlt und Harrys Halbbruder Heinrich Maria Ledig-Rowohlt im Rowohlt Verlag in preiswerten Ausgaben unters Publikum brachten. Natürlich prägt so etwas.
Auch wenn es Harry dann eher dazu brachte, den Weg eines Übersetzers einzuschlagen und dann in der „Zeit“ die beliebte Kolumne „Pooh’s Corner“ zu beginnen. Und natürlich seine fest verwurzelte Haltung als Kommunist auszuleben, was er immer wieder betonte. Ohne diese Haltung ist auch sein tiefer und augenzwinkender Humor nicht verständlich. Kann man in unserer Zeit überhaupt noch allen Ernstes Kommunist sein? Eine nicht ganz unwichtige Frage, nachdem der real existierende Sozialismus scheinbar bewiesen hat, dass das nicht funktioniert. Aber ist damit jedes kritische Denken über den real existierenden Kapitalismus obsolet?
Deutschland von außen: Zwei Pantoffel in einem
Dass da irgendetwas nicht stimmt in all den Verabsolutierungen, macht Tomasz Małyszek sichtbar, indem er etwas tut, was so noch kein Biograf der jüngeren Zeit getan hat: Er ordnet Harry Rowohlt nicht nur in die westdeutsche Kulturentwicklung ein, sondern reflektiert parallel immer wieder auch auf die Entwicklung in der DDR. Dazu muss man wahrscheinlich wirklich den Blickwinkel völlig ändern und von außen auf dieses Deutschland gucken, das sich 40 Jahre lang in einem gegenseitigen Schlechtmachen geübt hat. Und damit auch 1990 nicht wirklich aufgehört hat.
Sodass dann alles entwertet erscheint, was da in der DDR geschah – bis hin zu den heftigen literarischen Konflikten, Schlachten und Niederlagen, die eine ganze Reihe der besten Autorinnen und Autoren zum Auswandern in den Westen brachten.
Dabei wurde die westdeutsche Literatur im Osten immer ernsthaft rezipiert. Bücher waren Schmuggelware und subversiv. Und der Rowohltsche Humor kam im Osten genauso gut an wie im Westen, denn die Phänomene, welche die von Rowohlt so gern übersetzten Autoren aufs Korn nahmen, sind weltweit überall dieselben – Kleingeistigkeit, Opportunismus, Provinzialität und vor allem die Arroganz der kleinen Funktionsträger, die ihre Macht genossen, wenn sie andere Leute beschämen, schikanieren und piesacken konnten.
Das große Buch über den großen deutschen Humor des 20. Jahrhunderts ist noch lange nicht geschrieben. Da würde ein Harry Rowohlt einen sehr zentralen Platz einnehmen. Und dass linkes Denken nicht damit anfängt, dass man sich in die drögen Programme kommunistischer Parteien einliest, wird deutlich ausgerechnet an Rowohlts Auftritt im deutschen Fernsehen – als Obdachloser in der „Lindenstraße“. Eine Rolle, die er sich selbst gewünscht hatte, weil sie im deutschen TV eindeutig unterrepräsentiert war – genauso übrigens wie sämtliche Personifizierungen der Underdogs und Malocher. Da beginnt linkes Denken nämlich: mit einem echten Verständnis für die Ausgegrenzten, Niedergehaltenen, Benachteiligten.
Der Humor der Überlebenskünstler
Das heutige deutsche Rotzlöffeltum und der Niedergang der Linken hat genau damit zu tun: mit der medialen und politischen Ignoranz all denen gegenüber, die sich ganz unten irgendwie mit penetrant wenig Geld und meist ohne echte Unterstützung von Staats wegen durchschlagen müssen. Die Gutbetuchten sind es, die in diesem Land am lautesten jammern und wehklagen, wenn man ihnen auch nur den Lolli wegzunehmen droht.
Die wirklich Benachteiligten haben keine Stimme. Außer sie werden doch einmal die Heldinnen und Helden in wirklich guten Büchern, die dann meist von einem tiefen und starken Humor leben. So wie Frank McCourts Lebenserinnerungen: Am Ende weiß man da, was man alles durchgemacht hat und dass einem kein reicher Papa geholfen hat, wenn man mal wieder so richtig auf die Fresse geflogen ist.
Genau dafür liebten die Leser auch den Autor von „Pooh’s Corner“. Es war ein Ton, der selten geworden ist in unserer Zeitungslandschaft, die ihr Herz für die Armen längst vergessen hat und im Chor der Wohlversorgten mitjammert, dass es an manchen Tagen nicht mehr auszuhalten ist. So sehr, dass man sich oft genug an die bräsigen Kohl-Jahre erinnert fühlt, als die alte Bundesrepublik in ihrem Wohlgefallen regelrecht stagnierte. Eine Selbstgefälligkeit, gegen die Rowohlt in seiner Kolumne immer wieder scharfzüngige Abschweife zu formulieren wusste.
Als Filmkritiker rezensierte er damals auch den ziemlich lausigen Zustand der deutschen Filmlandschaft. Ein gebranntes Kind, seit ihm in seiner Kindheit die süßlichen Karl-May-Verfilmungen gezeigt hatten, wie man einen spannenden Lesestoff in ungenießbaren Pudding verwandeln kann.
Gegängelte Sprache
Aber je bräsiger eine Gesellschaft wird, um so deftiger wird die – natürlich: linke – Kritik. Beziehungsweise ihre Satire-Abteilung, die sich damals um die Neue Frankfurter Schule und die „Titanic“ sammelte. Mit Leuten, mit denen sich Rowohlt bestens verstand und mit denen er auch gern Bücher machte. Während er sich gleichzeitig über die Reformer der deutschen Rechtschreibung bissig ausließ, Leute, die nie einen einzigen literarischen Text verfasst hatten, aber unbedingt an der Rechtschreibung herumdoktern mussten.
Eine ganz wunde Stelle. Denn Rowohlt wusste ja, wie genau und lebendig Sprache sein musste, wenn sie als literarischer Text funktionieren sollte. Welche Fülle an Anspielungen und Emotionen darin steckten – auch dann, wenn Autoren mit Rechtschreibung und Grammatik spielen.
Natürlich ist die Arbeit von Tomasz Małyszek noch nicht die große Harry-Rowohlt-Biografie, eher eine Annäherung auf literaturwissenschaftlicher Basis, die versucht, diesen unangepassten Übersetzer und Kolumnisten in den Strom der deutschen Literaturentwicklung einzuordnen, Mitstreiter und Freunde zu identifizieren – und auch an einigen Stellen deutlich zu machen, wie sehr Rowohlt konservative und konservierende Literatur verachtete.
Ein extrovertiertes Leben
Und natürlich steht die Frage: Was bleibt, da Harry Rowohlt ja – anders als Mark Twain – keine Autobiografie hinterlassen hat, die erst nach 100 Jahren aus dem Panzerschrank geholt werden darf. Aber was er zu sagen hatte, hat er alles bei Lebzeiten veröffentlicht – in seinen Kolumnen und in den dicken Briefbänden. Und natürlich auch in „In Schlucken-zwei-Spechte“, das er zusammen mit Ralf Sotschek im schönen ländlichen Irland verfasste.
Er lebte, wie Małyszek feststellt, ein extrovertiertes Leben, erzählte unheimlich gern selbst erlebte Anekdoten und gab viel Privates preis, sodass man durchaus denken könnte, über diesen Querkopf sei eigentlich alles bekannt und gesagt. Ein Leben in Anekdoten also? Aber das wird Rowohlt wohl nicht gerecht. Genauso wenig, wie die Reduktion auf den Milne-Übersetzer, der mit „Pooh’s Corner“ scheinbar selbst in die Rolle des Bären schlüpfte. Vielleicht bringt es sogar die Flann-O’Brien-Biografin Anne Clune am besten auf den Punkt, wenn sie nach der Begegnung mit Harry Rowohlt schrieb: „Harry entsprach kein bisschen meinem Deutschenbild. Er war zu unkonventionell, zu anarchisch, zu … irisch.“
Was für ein Lob. Aber genau das kommt der Sache nahe: Dass dieser große bärtige Bär auch für eine Lebenshaltung stand, die das biedere deutsche Feuilleton zutiefst verabscheut. Nicht die Bohne brav, bieder und angepasst. Da müsste man eigentlich die Polizei holen. Der Kerl nahm sich was raus. Das geht doch nicht. Hier in Deutschland. Polizei!
Tomasz Małyszek „Harry Rowohlt. Ein gut übersetztes Leben“, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2023, 29 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
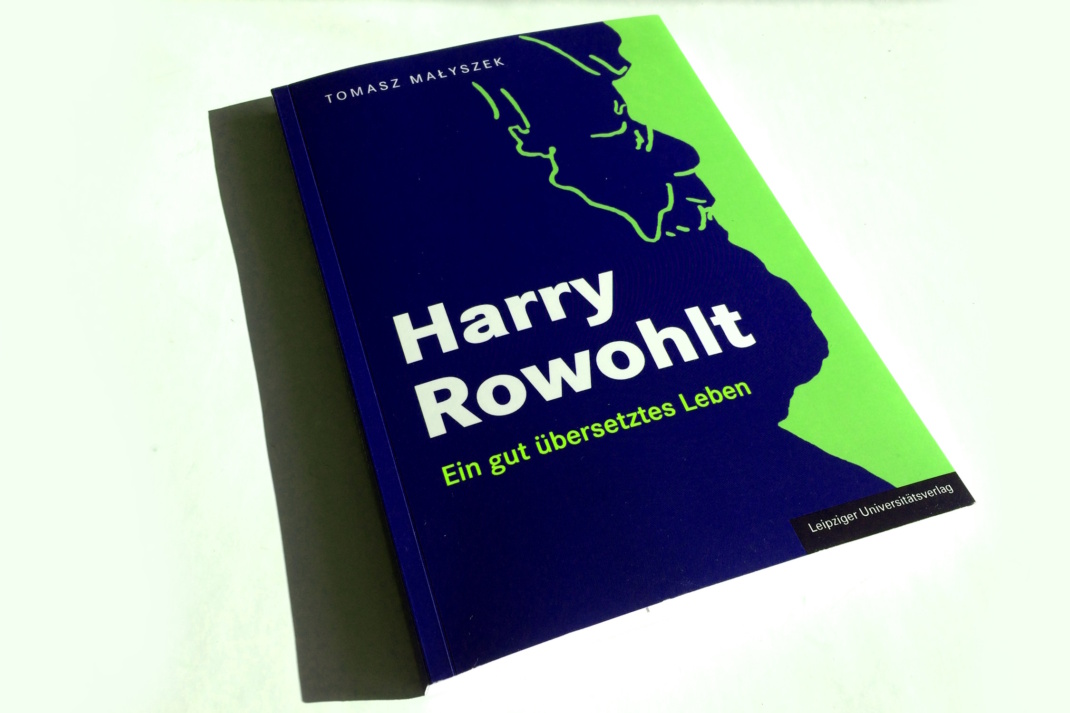
















Keine Kommentare bisher