Ich möchte heute von einer besonderen Sportstunde erzählen. Sport an sich ist für mich immer eine ziemlich feine Sache gewesen, ich glaube insgeheim wirklich, dass der Mensch für sehr viel tägliche Bewegung vorgesehen ist. Für mich gilt: Drei Tage ohne Leibesertüchtigung und ich fühl mich wie ein Fisch auf einem Fahrrad. Oder wie auch immer dieser Spruch lautet. Dabei interessierte mich dieses Höher-Schneller-Weiter-Dingens zeitlebens nie so sehr, die B-Note und der Spaß an sich gerieten mir stets ausreichend zur Freude. Das aber dann gern radikal.
Die Älteren unter den Lesern werden sich noch erinnern: Wenn man früher radikal wurde, fand man sich zur meist gleichgeschlechtlichen Popgymnastik ein, wobei das radikalste die Gewandung zu nennen war, die man eher in der nähe vom Straßenstrich Köln-Deutz in der Nähe von Verrichtungsboxen vermutet hätte als in der Turnhalle Döbeln-Süd.
Nachdem man endlich auch in der fasanenartigen Sport- und Fitness-Szene in den reichlich zwei Dekaden nach dem Mauerfall den letzten Ausweg aus der Vernunft genommen hatte, hieß Popgymnastik endlich Groupfitness oder wenn es ganz hart kam: Vom Frauenhaus ins Powerhouse! Von Pontius zu Pilates ist die Quintessenz des bedauerlichen Trends der sportiven Neuzeit, was nicht nur die Kirche zu bedauern hat.
Ich weiß so ungefähr, wovon ich rede: Ich hab’s nämlich sogar für Geld gemacht: Sport. Ich war eine Hopse, eine Hupfdohle, eine Vorturnerin. Was auch immer der deutsche Wortschatz an despektierlichen Begriffen dafür bereithielt. Es war der Kapitalismus des Körpers: Andere nach seiner Pfeife tanzen lassen und Entlohnung für ein bisschen Mumpitz abkassieren. So kannte ich bald alle Turnhallen jenseits und diesseits der Elbe. Eine gute Zeit war das. Mit vielen erinnerungswürdigen und schönen Begegnungen. Ich denke gern daran zurück.
Auch heute gebe ich mich vereinzelt noch für eine Hüpfstunde her. Wenn ich selber Freude daran empfinde.
So war das auch vor einiger Zeit, als sie herankam – meine erste Aerobicstunde mit Flüchtlingsfrauen. Ich schreibe Flüchtlingsfrauen, obwohl ich mich ein bisschen darüber ärgere. Aber es waren Flüchtlingsfrauen. Damals wohnhaft in einer Zeltstadt in Leipzig. Nahe der Deutschen Bücherei, dem Ort, wo ich als Studentin lange Zeit Lesesäle und Cafeterien heimzusuchen wusste. Immer im herrlich unausgewogenen Wechsel.
Hatte ich ein bisschen Bedenken gehabt?
Schon wegen der Vorankündigung, die verlautbarte: Nun ja, eigentlich sei Deutsch noch Fehlalarm, ein paar der Frauen sprächen ein paar Brocken Englisch. Mal sehen, wie viele sich überhaupt einfinden würden. Manche würden das Kopftuch ablegen, andere nicht. Man solle schauen, was überhaupt ginge. Nein. Bedenken hatte ich im Grunde nicht gehabt. So etwas wie leicht erhöhtes Fieber, nur in Vorfreude gemessen, vielleicht.
Und das war auch richtig so, wie sich herausstellen sollte: Vor mir etwa 16-17 Frauen und Mädchen, vorrangig afghanischen Ursprungs, schwarzhaarig fast alle, zwei, drei mit Kopftuch, eine mit aufgenordeten Melaninwurzeln, was bei so dunklem Haar häufig in solch einem changierenden Orangeton gipfelt.
Nachdem ich den ersten Satz in die Runde gesprochen hatte, wusste ich: Die krieg ich bestimmt auf Tasche. Und ich glaube, es gelang tatsächlich: Mit einem unsäglichen Gemisch aus deutschen und englischen Instruktionen und Erklärungen und vor allem mit Handzeichen lief der Laden, sobald die Musik spielte.
Gut, Viervierteltakt ist zugegebenermaßen nicht die komplexeste Schönberg-Komposition, aber das hatten die drauf. Rhythmus-Gefühl und die Bereitwilligkeit, im Gesicht widerzuspiegeln, dass einem das gerade Freude bereitet, was man macht, ist reichlich vorhanden. Ebenso überraschend, das Bestreben, laut auf Deutsch mitzuzählen. Na gut: Wenn es hilft, dann hilft es eben. Und es half.
Und ich? Ich stellte resümierend fest:
Ich habe schon reichlich Klientel von Wolgast bis Spitzkunnersdorf an der tschechischen Grenze vor mir hopsen lassen. Meist mit im Nachhinein perfektem Gefühl. Aber es war auch oft Arbeit, die eine oder andere mitteleuropäische Hüfte zu etwas Wagnis zu überreden oder manch perfektionsgewohntem Gesicht ein Lächeln zu entlocken. Wir sind vielleicht so. Ein bisschen ernsthafter in die Welt blickend. Das muss ja per se auch nichts heißen. Beides aber war hier von der ersten Minute einfach da.
Zu sehen, wie diese Frauen und Mädchen Spaß hatten, war mir das kleine Geschenk, das ich mir – wenn ich ehrlich bin – mir insgeheim im Vorfeld erhofft hatte. Wir blieben freiwillig noch eine weitere Stunde und spielten Basketball mit den Frauen. Ohne viel spitzfindiges Reglement, dafür aber mit reichlich Temperament, verrutschten Kopftüchern, unbändigem Lachen und jede Menge Selfies hinterher.
Das Wichtigste aber an diesem Tag war das Gefühl, dass dies alles der Bestätigung gleichkam, dass der Mensch, egal wo er herkommt, genau aus dem besteht, was wir so ungefähr brauchen: im Normalfall aus zwei Armen, zwei Beinen, Nase, Ohren und so Zeug, einem Kopf zum Denken und einem Herz zum Fühlen.
Jeden, der die Meinung vertritt, wir seien hierzulande eventuell doch eine zivilisiertere, fortgeschrittene Spezies, eine andere Stufe der Evolution, braucht vielleicht nur etwas Bewegung. In allerlei Hinsicht. 🙂
Die neue LZ Nr. 48 ist da: Zwischen Weiterso, Mut zum Wolf und der Frage nach der Zukunft der Demokratie
Zwischen Weiterso, Mut zum Wolf und der Frage nach der Zukunft der Demokratie
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
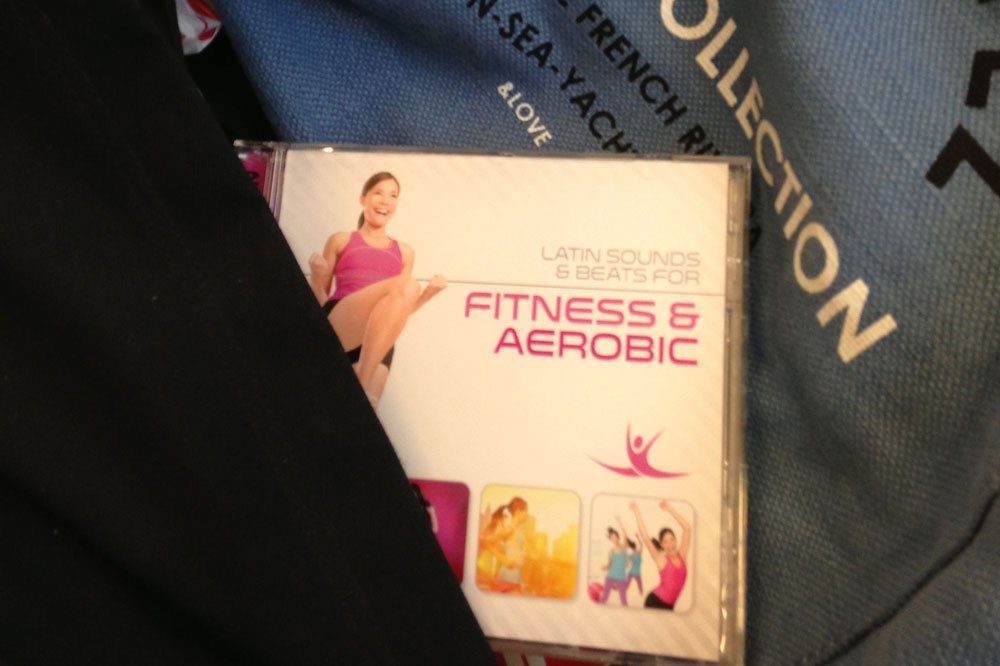




Keine Kommentare bisher