Eigentlich geht es in Utz Rachowskis Gedichten um Dinge, die er nicht vergessen kann. Und die wir selbst auch nicht vergessen sollten. Aber wie soll das gehen, wenn keiner mehr Gedichte liest? Wenn eine Gesellschaft lieber vergisst und verklärt und deshalb nicht in der Lage ist, aus der Vergangenheit zu lernen? Dann entsteht so ein seltsames Land wie dieses Sachsen von heute. In einigen von Rachowskis neueren Gedichten wird das mehr als deutlich.
Sie stehen tatsächlich am Ende dieses Sammelbands, der frühere Veröffentlichungen von Utz Rachowski zusammenfasst. Darunter auch jene Gedichte, die er 1981 gleich nach seiner Haftentlassung schrieb. In der Haft durfte er nicht schreiben. Nur wenige Briefe an die Familie, und das auch nur unter Aufsicht. Was einer der Gründe dafür ist, dass es keine Gefängnis-Literatur in diesem Sinn aus der DDR gibt.
Was über die Zuchthäuser und Haftanstalten im Osten geschrieben wurde, entstand alles erst später. Man denke nur an die erschütternden Bücher von Loest und Bienek, die auch deshalb erschüttern, weil sie mit literarischer Genauigkeit schildern, wie der denkende, fühlende und kritische Mensch in dieser Haftmaschine zermahlen werden sollte, regelrecht zerstört, bis er willfährig wurde und allen Widerstand aufgab.
Was nicht nur auf die Zuchthäuser und Jugendwerkhöfe in der DDR zutraf. Rachowski geht ja auch auf den Wehrdienst in der NVA ein, der genauso darauf angelegt war, die jungen Männer zu disziplinieren, gefügig zu machen und ihnen alle Spuren von Eigensinn und Rebellion auszutreiben.
Was passiert eigentlich mit einer Gesellschaft, in der Generation um Generation so eine Mühle der Anpassung und Willkür durchlaufen muss?
Was passiert mit diesen Menschen?
Was mit denen passierte, die wegen der wildesten Verdächtigungen inhaftiert, verhört und zu langen Zuchthausstrafen verurteilt wurden, zählt Rachowski in seinem Gedicht „Bericht über eine Kollegin“ auf, das aus seiner zweiten Gedichtserie über Suki, eine Hündin, die Rachowski während eines Aufenthalts in Pennsylvania 2012 betreute, stammt.
Anfangs wundert man sich ja ein wenig: Wo kommen jetzt diese Hunde-Gedichte in einem Band von Gedichten her, der eigentlich eine Art Bilanz über 50 Jahre Schreiben bietet? Die Bilanz eines Dichters, der zu den Sensiblen aus dem Osten gehört, denen, die eigentlich ohne die Krume der Heimat an den Schuhsohlen nicht leben können. Was eigentlich allen Dichterinnen und Dichtern passiert, die das Exil erleben. Sie werden mit der Fremde nicht warm. Sie bleiben Außenseiter. Was Emigration bedeutet, muss Rachowski niemand erklären. Auch deshalb ist seine Beziehung zum heutigen Sachsen eine höchst kritische.
Und trotzdem ist er gleich nach 1989 zurückgekehrt in seine Heimat Vogtland. Wo er aber nicht still auf einem Bauernhof sitzt und die Sterne besingt. Auch davon erzählen ja die Suki-Gedichte. Jedes Gedicht trägt einen anderen Ort im Datum. Selbst innerhalb Sachsens ist Rachowski unterwegs. Orte, Momente, Nachrichten werden zu Anlässen für eine kurze Reflexion.
Rachowski ist ein Meister der Kargheit. Er will nicht blenden, die Leser gar mit üppigem Stil betören. Das, was gesagt werden muss (oder kann), passt in wenige Zeilen. Man merkt beim Lesen wirklich, wie intensiv sich Rachowski mit seinen Vorbildern beschäftigt hat – einige davon jene Wort-Genauen wie Reiner Kunze, die den Verhaltenswächtern im Osten so große Bauchschmerzen gemacht haben, dass sie mit Zensur und Verhaftung reagierten. Selbst die Texte Wolf Biermanns wirken heute noch poetisch, manchmal ein bisschen ruppig und grimmig, aber stets bemüht, das Fassbare und Bildhafte auch in wenigen Zeilen zu fassen und wirken zu lassen.
Walter Schmitz geht in seinen zwei Nachworten nicht nur auf Rachowskis Lebensgeschichte ein, sondern auch auf seine tiefen Wurzeln in der Romantik, bei Dichtern wie Hölderlin, Kleist und Büchner. Alles keine Unbekannten. Sie standen allesamt im Mittelpunkt intensiver Literaturdiskussionen im Osten. Was offen und politisch nicht gesagt werden konnte, wurde über Bande ausdiskutiert.
Wer damals Bücher las, war mittendrin in der Diskussion, der beschäftigte sich nicht nur (durch Christa und Gerhard Wolf und Günther de Bruyn angeregt) mit den frappierenden Parallelen des „real existierenden Sozialismus“ mit der Spätromantik und dem Leiden der Dichter an ihrer Zeit, der beschäftigte sich auch mit den Stil-Diskussionen und dem Sag-Baren. Auch Rachowski, der eigentlich in Leipzig Medizin studierte, aber in seiner Freizeit schon schrieb und vor allem las. Und auch die Verbotenen und Unerwünschten las. Was im Staate der beiden Erichs schon als Staatsgefährdung verstanden wurde, Subversion und Verschwörung.
Gerade weil die SED dem Wort und seiner Wirkung misstraute, hatte Literatur eine Wirkung, die heutzutage, in einer vom Markt dirigierten Freiheit, kaum mehr vorstellbar ist. Dass das so ist, erfuhr Rachowski ja früh. Im Westen waren die Ausgereisten und Freigekauften nur dann wirklich gefragt, wenn sie den Stoff lieferten, der sich als Munition gegen das Regime im Osten verwenden ließ. Dann öffneten auch die großen Zeitungen ihre Spalten.
Dass aber einer an sich selbst, der Fremde und dem Nichtverwurzeltsein leiden könnte, war kein Thema. Es hätte ein Thema sein können. Aber nur in kleinen Kreisen, bei wirklich interessierten Lesern. So waren sie zwar alle frei – und hatten doch ihr Lesepublikum verloren. Denn das lebte im Osten und war geübt, Texte sehr genau zu lesen. Nicht nur wegen der „Zwischentöne“. Sondern der Genauigkeit wegen, mit der die wirklich Guten das menschliche Dasein erfassten unter diesen ganz konkreten Um- und Zuständen. Zuständen, in denen ja alle lebten. Oft genug wirklich auf das Menschliche und Zwischenmenschliche zurückgeworfen.
Die eigentliche Utopie in diesem Land war ja der Alltag, das Unvermarktete. Und gerade diese scheinbar so einfachen, irdischen Erkundungen waren der lesbare Widerspruch zum Proklamierten. Das eine hatte spürbar nichts mit dem anderen zu tun. Schon das Behaupten menschlicher Würde und Existenzialität war Herausforderung für einen Apparat, der alles kontrollieren wollte und auf Zensur bis fast zuletzt nicht verzichtete.
Das fatale Ergebnis: Die Kritischsten, Aufmerksamsten und Sensibelsten wurden zermürbt, zermahlen oder vergrault. Bis heute hat niemand wirklich erkundet, was das für die Selbstvergewisserung des Ostens dauerhaft bedeutet hat. Selbst all jene, die 1989 als Bürgerrechtler für einen Moment die Schleusen der Zeit in Händen zu halten schienen, machten schnell, nur allzu schnell die Erfahrung, wie machtlos sie bald wieder waren, dass wieder lauter Angepasste und Linientreue (jetzt in neuen Parteifarben) die Hebel der Macht in die Hand nahmen.
Oder auch nicht. Denn das ist ja nur allzu offensichtlich: Leute mit einem Gefühl für Möglichkeiten und Zukunftsvisionen kamen im Osten nirgendwo an die Macht. Sie saßen wieder auf dem Stühlchen am Rand des Runden Tisches und durften ab und zu mahnen. Das war’s schon.
Eine vertane Chance, die aber auch mit der Frage zu tun hat: Wie kann eine Gesellschaft ihrer selbst eigentlich bewusst werden? Hätte es dazu nicht ab 1990 einer eigenen, mutigen und wirklich aufklärenden Presse bedurft? Keiner Zeitungsklone aus dem Westen, die dann auch gleich noch die offiziöse Sicht westlicher Politik auf den Osten übernahmen. Danach war ja mit Einführung der D-Mark alles Paletti, die Bösen waren definiert, die Bürger waren zum Volk geworden.
Doch die Wahrheit kennen eher die Psychotherapeuten. Und auch Utz Rachowski machte die Erfahrung, dass mit „Wende“ und Revolution ganz und gar nichts geheilt war. Das ist eigentlich die Grundsubstanz seiner Suki-Gedichte, denn die Begegnung mit diesem Hündchen schloss für ihn ganz offensichtlich viele, lange verschlossene Gefühle wieder auf. Viele Gedichte lesen sich wie Liebesgedichte. In der offenherzigen Beziehung zu diesem kleinen Hund war dem Dichter wieder möglich, was ihm seit den Zeiten des Verrats augenscheinlich unmöglich war: wieder eine lebendige Beziehung ohne Misstrauen und Distanz-Behauptung zu einem Lebewesen aufzubauen.
Eine Erfahrung, die er auch von einem Leidensgenossen zu erzählen weiß, der die Alpträume seiner Haftzeit erst durch die lange Arbeit mit einem Therapiehund auf Abstand brachte. Und wenn Rachowski die Worte des Vernehmers zitiert, wird einem frappierend deutlich, wie sehr dieser Ton heute wieder herrscht, wie viele Menschen in diesem Land tatsächlich glauben, dass man so mit anderen Menschen umgehen kann: „Spuck dem in die Fresse / Hau dem ans Bein / Alle Menschen sind Arschlöcher“.
Ein alter, auf einmal wieder vertraut klingender Ton. So wertet man Andersdenkende ab zu Unrat, Schmutz, Verachtenswürdigem.
Und so wie die Therapiehündin Jette einem Leidensgenossen half, half auch Suki dem Dichter, der nach dieser eindrucksvollen Begegnung 2012 im Grunde zwei Gedichtbände allein nur mit Gedichten schrieb, die diese großartigen Gefühle von Vertrauen, Zuneigung und unbedingter Liebe beschreiben. Und damit – wie eine irische Leserin feststellte – die schönsten Hundegedichte, die in letzter Zeit publiziert wurden.
Und gerade beim zweiten Teil dieser Gedichte merkt man, wie sich in diesen scheinbar so simplen Liebesgedichten an einen Hund in Wirklichkeit das ganze Leben des Dichters bündelt und spiegelt, nicht nur durch die Ortsangaben bestärkt, sondern auch durch die Reflexionen auf seine Vergangenheit, seine polnischen Wurzeln und seinen starken Bezug auf die Diskurse der (Spät-)Romantiker in „Romantischer Einschub“, ein Einschub, der eben stark an einige der intensiven Diskussionen in der Spätzeit der DDR erinnert, als die sensiblen unter den Dichterinnen und Dichtern in die Rollen der Kleist, Hölderlin und Günderode schlüpften, um ihr Leiden an einer biedermeierlich observierten Gegenwart zu formulieren.
Was sich in Rachowskis Erinnerung mit den Begegnungen mit Wolf Biermann und Jürgen Fuchs in Jena überschneidet. Man staunt über die Parallelen. Und auch hier fließt der Text zurück in die Erinnerung an die Hündin Suki, ein Cavalier King Charles, die längst zur Heldin von Gedichtbänden wurde, die begeisterte Übersetzer/-innen nicht nur ins Polnische hinübertrugen. Das heißt: Rachowski wird gelesen. Anderswo. Von viel zu wenigen. Und wenn das biedermeierliche deutsche Fernsehen die Berühmten einlädt, um die Vergangenheit schönzureden, dann ist einer wie Rachowksi nicht dabei. „Ein wenig alt, nicht fotogen“.
Walter Schmitz attestiert ihm die Fähigkeit, mit wenigen Worten mehr zu sagen, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Das Weimarer Taubengedicht analysiert er vertretungsweise. Er hätte auch dieses nehmen können. Denn hier klingt an, was Rachowski so irritiert in diesem Land – die ganze Oberflächlichkeit und der gut bezahlte Unwille, sich wirklich mit den Widersprüchen und Erblasten zu beschäftigen. Alles ist schön. Ein Land, in dem wir gut und gerne leben. So ungefähr.
Nur wird die Warnung wohl wieder nicht gelesen. Man wird den „Dresdner Tieck“ einladen, aber nicht diesen weltreisenden Dichter aus dem Vogtland. Aber gerade deshalb darf man diesen Gedichtband allen Leser/-innen ans Herz legen. Gerade die Suki-Gedichte zeigen, zu was Dichtung in der Lage ist, wenn einer weiß, wie reich unser Sprachschatz tatsächlich ist. Und wie lebendig.
Utz Rachowski Die Dinge, die ich vergaß, P&L Edition, Planegg 2018, 14,80 Euro.

Ein spätes Poesiealbum für den nachdenklichen Dichter aus dem Vogtland
Ein spätes Poesiealbum für den nachdenklichen Dichter aus dem Vogtland
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
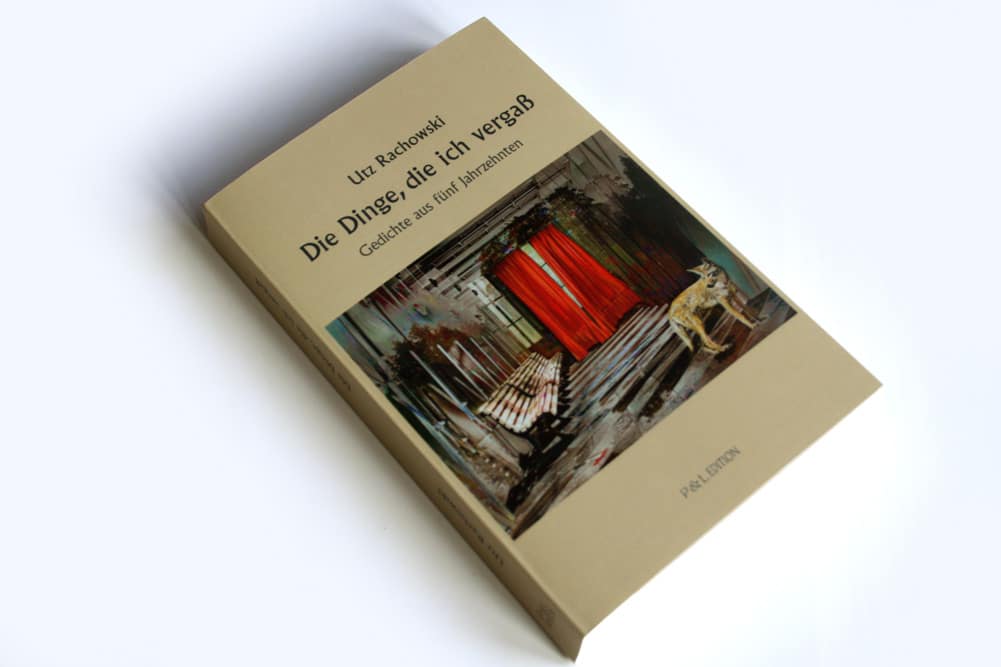









Keine Kommentare bisher