Es gibt so viele Geschichten, die gehen gar nicht gut aus. Das ist unser Leben. Doch wie erzählt man sie? Und dann auch noch so, dass die Leserinnen und Leser nicht völlig deprimiert aus dem Buch gehen? Brauchen wir nicht immer ein Fünkchen Hoffnung, damit es weitergehen kann? Oder einen Burschen wie Fé, der in das Dorf Ingoré am Ufer des Flusses Jasmin wieder so etwa bringt wie Zuversicht, dass sich das Leben trotz allem lohnt?
Trotz der bösen Flussgeister, der Irä, trotz der Unglücke, die die leichtgläubigen Menschen gen Zauberern zuschreiben. Die alte Glaubenswelt ist im Norden von Guinea-Bissau noch ebenso lebendig wie der importierte christliche Glaube. Und man findet Ingoré tatsächlich auf der Landkarte, auch wenn der Fluss am Rande des Ortes Rio de Abul heißt. Aber wie das so ist mit literarischen Orten – sie schweben zwischen den Welten. Sie sind Orte der Sehnsucht und magischer Vorgänge.
Und ein bisschen magisch geht es auch zu in dieser Geschichte des in Ingoré geborenen Autors Amadú Dafé, der in Portugal lebt und auch auf Portugiesisch schreibt. Übersetzt hat seinen Roman Rosa Rodrigues, die im Nachwort auch ein wenig erklärt, wie sie versucht hat, möglichst viele der Realien aus dem Original auch in die Übersetzung aufzunehmen, all die Worte, die mit dem Glauben und dem Animismus der Bewohner von Ingoré zu tun haben.
Denn diese Glaubensvorstellungen von Seelen- und Geisterwesen sind wesentliche Gründe dafür, dass Vorurteile und Ausgrenzungen selbst in diesem Ort, wo alles möglich scheint, dominieren.
Leben heißt Migration
Auf einmal ist man mittendrin in den modernen Geschichten von Migration, Ausgrenzung, Rassismus, die es auch in den Ländern gibt, die nicht zum globalen Norden gehören. „Ausländer“ werden misstrauisch beobachtet – aber auch gefürchtet. Haben sie nicht besondere Kräfte, die sie den Einheimischen überlegen machen? Aber wer gehört dazu?
Fé ist in Ingoré nach eine langen Wanderschaft gelandet. Auf der Insel Kap Verde geboren, ist er der Sohn eines Mannes aus einer nomadisch lebenden Volksgruppe. Er ist auf der Suche nach seiner Mutter, die seinen Vater einst aus Liebe zu einem Sohn aus einer ansässigen Konditorfamilie verließ.
Er weiß nicht, wo er sie finden kann. Der Ort Ingoré scheint lediglich ein möglicher Ort, wo sich die Schicksale von Menschen treffen, die losgezogen sind auf der Suche nach einem anderen, leichteren Leben. Natürlich ist es überraschend, hier in der Geschichte eines Autors aus Guinea-Bissau etwas zu finden, was einem aus dem heimischen Jammergarten nur zu bekannt ist. Als wenn Menschen gar nicht anders können, als andere Menschen mit hellerer oder dunklerer Hautfarbe immerfort auszugrenzen.
Das macht in dieser Geschichte auch Lua zu schaffen, die in Ingoré ein Marktrestaurant betreibt, aber mit ihrer Mutter völlig zerstritten ist und schon lange ziemlich hoffnungslos, dass sie noch einen Mann treffen wird, mit dem sie eine glückliche Partnerschaft führen könnte. Was wieder mit ihrem Vater zu tun hat, der eines mysteriösen Todes gestorben ist.
Und dann kommt eines Tages dieser Bursche von Kap Verde und gießt den Jasminstrauch in ihrem Restaurant. Sitzt wie selbstverständlich da und zeigt, dass man sich einfach kümmern muss um die Dinge, damit sie gedeihen. Und um die Menschen, damit sie wieder Zuversicht schöpfen. Und wieder Acht geben aufeinander.
Und er tut es so selbstverständlich, als wäre es wirklich das Normalste von der Welt. Obwohl er eigentlich vollauf mit seiner Suche beschäftigt ist, auch dann noch, als ihn Lua zu ihrem Angestellten macht und ihn heimlich umschwärmt, weil Fé etwas ausstrahlt, was sie schon lange vermisst hat.
Jeder in seiner eigenen Kopf-Geschichte
Am Ende wird Ingoré tatsächlich zu einem Ort des Findens. Aber auch das nur, weil Fé hartnäckig bleibt und vor allem wissen will, wer diese seltsame Pipa ist, die Lua nicht in ihrem Restaurant dulden will. Dafé lässt seine Leser eigentlich nicht im Ungewissen, auch wenn er seine Protagonisten lange im Dunkeln tappen lässt. So wie das im Leben meist die Regel ist, denn wir sind alle in unsere eigene Geschichte eingesponnen, in unsere Vorurteile und Widersprüche. Wir legen uns alles so zurecht, wie wir es verstanden haben.
Im Grunde ist das die Grundlasur, mit der Dafé seine Erzählung malt: Das Versponnensein der Menschen in ihre Geschichten, die sich nicht auflösen lassen, wenn sie die Geschichten der anderen nicht erfahren, nicht zuhören und merken, dass sie immer nur alles aus ihrer eigenen, engen Perspektive gesehen haben.
Das trifft nicht nur auf die in diesen Geschichten verwobenen dunklen Farben zum allgegenwärtigen Rassismus zu. Und auch nicht nur auf die alten Glaubensvorstellungen von Flussgeistern und Zauberern und dem Wirken jenseitiger Mächte ins Lebe und Sterben der Menschen hinein – was zuweilen finstere Formen annimmt. Und was uns so unvertraut nicht ist.
Das kennen wir auch von unseren hiesigen Erdbewohnern, die sich in ihre alten Geschichten und Vorurteile eingesponnen haben und jedem Narren nachlaufen, der ihnen erzählt, dass das die einzig richtige Sicht auf die Welt ist. Nur: Es ist keine sehr ermunternde und helle Sicht.
Die alten Geistergeschichten
Die Bewohner von Ingoré sind umsonst so niedergeschlagen, hoffnungslos und verschlossen. Die alten Geistergeschichten lähmen. Sie lassen den Blick nicht zu auf das Mögliche, auf ein Leben, das stete Veränderung ist. Im Buch immer wieder mit dem Bild des Flusses in Verbindung gebracht. Der nicht nur für Veränderung steht, sondern auch für Einssein – mit der Gemeinschaft und mit der Natur.
Denn das gehört zusammen. Nicht nur für Luas Vater, der ihr einen Brief hinterlassen hat, den sie erst ganz am Ende liest, wenn ihr endgültig klar wird, dass sie selbst bisher nur einen kleinen Teil der Geschichte gekannt hat. Einer Geschichte, die letztlich auch eine Geschichte der Migration ist und der Suche nach einem Ort, an dem ihre Eltern ihre Liebe und ihre Träume von einer gemeinsamen Zukunft leben konnten.
Und auf ihre Weise auch gelebt haben, auch wenn nicht alles so gelungen ist, wie sie sich das dachten. Kennt jeder die Geschichte seine Eltern? Wie sie sich fanden? Wie sie sich mühten und irrten? Und manchmal auch vergaßen, was sie eigentlich einmal alles teilen und erleben wollten? Auch das steckt in diesen letztlich drei Schicksalen, die sich in diesem Buch verflechten und sich als eine große gemeinsame Geschichte entpuppen. Auch wenn es gerade Lua erst sehr spät klar wird.
Zu spät.
Könnte man meinen. Denn das Ende ist kein Happyend. Manchmal gibt es keine Happyends. Auch nicht für eine Suche, die scheinbar so überraschend zum Ziel führt. Oder auch nicht. Denn dass wir erst auf die Suche gehen müssen, hat mit etwas zu tun, was Lua in einem Brief an Fé schreibt.
Oder auch nur zum Abwesenden sagt in einem langen inneren Zwiegespräch: „Mein alter Vater meinte, dass niemand wirklich versteht, was in einem Menschen vorgeht, so sehr man auch versucht, es zu erklären. Jeder ist ein Universum von Lebenswegen und Gegebenheiten, die sich untereinander und von dem Universum, das wir teilen, völlig unterscheiden.“
Deswegen müssen wir uns unsere Geschichten erzählen. Sonst finden wir nie heraus, wie sie zusammenpassen.
Amadú Dafé „Jasmin“ Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2024, 19,95 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
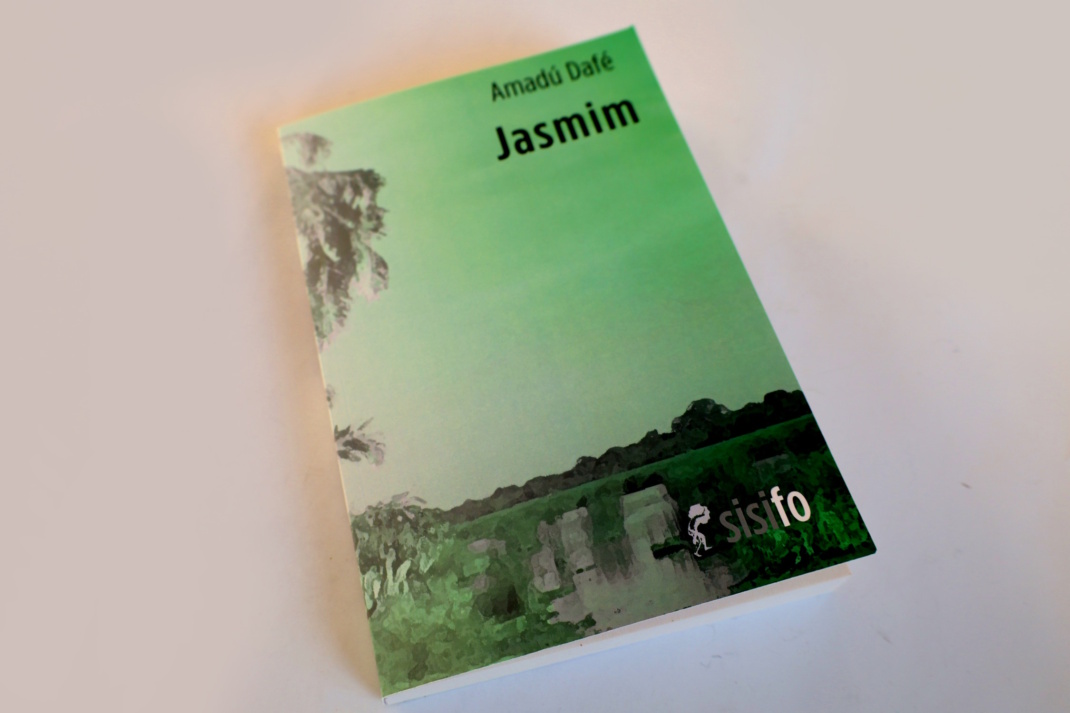
















Keine Kommentare bisher