Wie kommt man aus dem Lehrerdilemma in Sachsen heraus? Das nicht nur ein sächsisches ist. Überall in Deutschland beginnen die Lehrer zu fehlen. In internationalen Leistungstests stagnieren die Ergebnisse der Schüler – so wie in der am Dienstag, 5. Dezember, veröffentlichten IGLU-Studie. Aber wie keine Studie zuvor hat diese deutlich gemacht, dass das mit gesellschaftlichen Vorurteilen und stiller Diskriminierung zu tun hat. Starke Worte? Realität.
Das Problem deutscher Kultusminister ist tatsächlich, dass sie nicht wissen wollen, wie stark das deutsche Bildungssystem auf Diskriminierung ausgelegt ist. Ein paar Wochen früher hätte ich noch von Auslese gesprochen. Aber was da tatsächlich passiert, ist tatsächlich stille Diskriminierung: Wer aus dem falschen Elternhaus kommt, kriegt auch dann keine Chance auf bessere Bildung, wenn er in seinem Leistungsvermögen 100 Punkte über dem von Kindern aus Beamten- und Akademikerelternhäusern liegt.
Und das funktioniert automatisch.
„Als ein weiterer Kennwert wurde ein ‚kritischer Wert‘ im Lesetest verwendet“, heißt es im IGLU-Bericht. „Erreicht ein Kind diesen Wert, hat es gute Chancen, als geeignet für ein Gymnasium angesehen zu werden. Insgesamt wird eine Gymnasialpräferenz der Lehrkräfte ab einer Lesekompetenz von 562 Punkten (25 Punkte oberhalb des deutschen Mittelwerts) hinreichend wahrscheinlich.“
So weit ganz einfach: Kinder, die eine Lesekompetenz von 562 erreichen, haben nach Ansicht der meisten Lehrer das Zeug zum Gymnasium.
Aber dann schlägt der soziale Faktor zu: „Zwischen den Berufsklassen unterscheiden sich diese Werte jedoch erheblich: Während Kinder mit Eltern der oberen Berufsklassen (Akademiker, Techniker und Führungskräfte) bereits mit einem Wert von 518 (19 Punkte unterhalb des deutschen Mittelwertes) gute Chancen auf eine Gymnasialpräferenz ihrer Lehrkräfte haben, liegt der kritische Wert bei Kindern von un- und angelernten Arbeitern bei 620, also 83 Punkte oberhalb des deutschen Mittelwertes. Die Differenz zwischen diesen beiden Berufsklassen beträgt etwa 100 Punkte, was gut zwei Lernjahren entsprechen dürfte (Hornberg et al., 2007).“
Kinder aus den sogenannten „bildungsfernen Schichten“ können klüger und kompetenter sein als ihre Altersgenossen aus Akademiker-Elternhäusern – und bekommen dennoch keine Bildungsempfehlung fürs Gymnasium.
Und wie haben sich die Bildungsreformen der letzten Jahre ausgewirkt? Sie haben diese Tatsache noch verschärft.
„Im Vergleich mit früheren Erhebungen ist der kritische Wert für eine Gymnasialempfehlung gesunken: von 581 beziehungsweise 580 in den Jahren 2001 und 2006 auf 562 bei IGLU 2016. Allerdings hat dies nicht zu einer größeren Chancengerechtigkeit beigetragen“, stellen die Studienautoren fest. „Im Gegenteil: Lag der kritische Wert für die oberste Berufsgruppe 2001 bei 551, sank er 2006 auf 537 und 2016 auf 518. Im gleichen Zeitraum stieg der kritische Wert bei Kindern von un- und angelernten Arbeitern von 601 (2001) auf 614 (2006) und schließlich auf 620 (2016). Diese Werte verweisen darauf, dass beim Übergang in die Sekundarschulen die Chancengerechtigkeit nicht gewahrt ist.“
Genau da geht es los. Das Problem der Kinder aus benachteiligten Bevölkerungsschichten ist nicht, dass sie dümmer sind als ihre Altersgenossen – sie werden schon deshalb benachteiligt, weil ihr Elternhaus das falsche ist.
Dass viele Kinder aus diesen Elternhäusern sowieso schon mit einem geringeren Selbstkonzept am Start sind – also auch weniger lesen und selten aus Eigenmotivation, kommt noch dazu. Da kann man ansetzen. Aber das löst das Grundproblem nicht, das augenscheinlich darin besteht, dass bei Gymnasialempfehlungen weniger die tatsächliche Kompetenz des Kindes eine Rolle spielt als der Status des Elternhauses. Noch stärker wird der Zusammenhang, wenn die Armutsgefährdung bzw. Nicht-Armutsgefährdung der Familien verglichen wird – eindeutig sorgt die Armutsgefährdung – also das Leben in prekären Verhältnissen – dafür, dass die Lesekompetenz der Kinder im Schnitt signifikant niedriger ist.
Deutlicher kann man gar nicht zeigen: Bildung muss man sich leisten können. Und die Schulen in Deutschland heben diese Unterschiede nicht wirklich auf. Einige Befunde der Studie deuten darauf hin, dass es zwischen Erfolgserleben und Sozialklima in den Klassen einen Zusammenhang gibt. Nur würden die untersuchten Items, so die Studienautoren, nicht wirklich helfen, sozialklimatische Bedingungen zu beschreiben.
Aber irgendetwas funktioniert da einfach, kaum reflektiert, aber sichtlich demotivierend: „Etwa 55 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die das Sozialklima im Deutschunterricht als sehr unterstützend wahrnehmen, gehören zur Gruppe der leistungsstarken Leserinnen und Leser. Das gilt auch für 41 beziehungsweise 36 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die das Sozialklima als etwas weniger (aber immer noch) unterstützend oder wenig unterstützend
wahrnehmen. Das ist in der Tendenz erwartungskonform. Auch bei den leistungsschwachen Leserinnen und Lesern zeigt sich in der Tendenz das erwartete Bild.
Während nur etwa 12 Prozent derjenigen, die den Unterricht hinsichtlich des Sozialklimas sehr positiv einschätzen, zu dieser Gruppe gehören, gilt das für einen größeren Anteil derjenigen, die das Klima weniger positiv (23.5 %) oder zum Teil wohl als problematisch wahrnehmen (27.3 %).“
Aber die Autoren bezweifeln wohl zu recht, dass die verwendeten Items für das „Sozialklima“ tatsächlich das beschreiben, worum es geht: „Allerdings stellt sich die Frage, ob mit den berücksichtigten Items tatsächlich den für die Dimension ‚Sozialklima‘ bedeutenden Annahmen der Selbstbestimmungstheorie der Motivation entsprochen wird. Dort werden die drei Grundbedürfnisse Autonomie- und Kompetenzerleben sowie das Erfahren sozialer Einbindung in den Mittelpunkt gestellt.“
Wenn gerade für Kinder aus „bildungsfernen“ Elternhäusern der Unterricht als demotivierend empfunden wird, hat das wenig mit Autonomie und Kompetenz zu tun, aber jede Menge mit Ohnmacht und Frustration. Und die Beschreibung dessen, was Lehrer und Schüler genau in diesen Verhältnissen als Unterricht wahrnehmen, klafft auseinander. Tatsächlich führt diese Art Schule vor allem für Kinder zum Erfolg, die sowieso schon mit jeder Menge Rückenwind unterwegs sind, während die Scheuen, Zögernden, Unermutigten immer wieder neue Frustration erfahren. Quasi den Unterricht gewordenen Stinkefinger: Keine reichen Eltern? Vergiss es!
Das zu ändern, braucht man natürlich wirklich motivierte Lehrer. Und ein anderes Denken über Schule.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
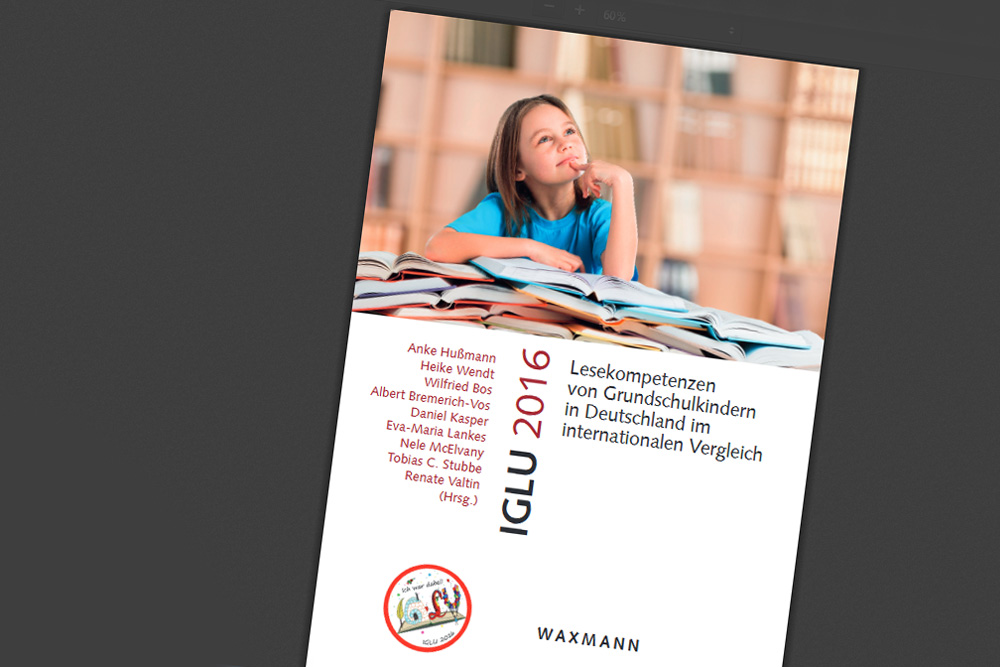









Keine Kommentare bisher