Der Neoliberalismus erzeugt eine kalte Welt. Eine eiskalte Welt. Mit selbstoptimierten Gewinnern, die sich niemals sicher sein können, dass sie nicht im vollen Galopp weggepustet werden. Und jeder Menge Verlierern, von denen die meisten selbst dann noch hoffen, zu den Siegern aufschließen zu können, wenn sie mit letztem Röcheln im Krankenhaus liegen. Aber was richtet eine Gesellschaft an, über die offiziell nicht nachgedacht werden darf?
Man muss nur das Wort erwähnen, und schon geht das große Geheule los, melden sich lauter Leute zu Wort, die bis jetzt schon alle Kraft darauf verwendet haben, irgendwo in dieser Rattenjagd mithalten zu können, und schimpfen wie die Rohrspatzen, wie wir nur so kritisch über diese marktradikale Theorie schreiben können. Wir hätten wohl gar nicht begriffen, welche Wohltaten sie über die Welt gebracht hat.
Die Wohltaten sind markant. Stimmt. Es ist eine Denkweise, die alle, wirklich alle Lebensbereiche verunsichert und zu Orten des radikalen Wettbewerbs macht. Und Deutschland ist seit 30 Jahren Experimentierfeld für diese Wettbewerbsideologie, die weder vor der Bildung der Kinder noch dem Gesundheitswesen halt macht. Länder und Städte stehen in einem mürbemachenden Wettbewerb um Investoren, Subventionen und Ansiedlungen. Jeder Bürgermeister weiß, dass er in dem Moment verloren hat, in dem seine Stadt, sein Dorf den Ruf bekommen, nicht mehr „cool“ und „hot“ zu sein. Und kein Teil Deutschlands hat dieses marktradikale Experiment so straff erlebt wie der deutsche Osten.
Die meisten Ostdeutschen können ein Lied davon singen, wie eine Region aussieht, in der der Staat komplett „verschlankt“ wurde und die tragende Wirtschaft verschwunden ist. In der die Hoffnungslosigkeit nicht nur die Jugendlichen an der Bushaltestelle, wo oft gar kein Bus mehr hält, zermürbt.
Wo das, was für die Älteren mal eine geliebte, weil lebendige Heimat war, sich in eine trostlose Einöde verwandelt hat. Ohne attraktive Jobs für die Jungen, ohne einen Hebel, an dem man anpacken könnte, um vielleicht durch bürgerliches Engagement irgendetwas zum Besseren zu ändern. Eine Gegend, in der sich nach und nach über die Jahre neben der Hoffnungslosigkeit auch eine stille Wut angesammelt hat. Das Gefühl einer permanenten Überforderung.
Die „Süddeutsche“ hat jetzt das neueste Buch von Juli Zeh rezensiert, den eigentlichen Schlüsselsatz, der die permanente Überforderung ihres emanzipierten Helden auf den Punkt bringt, aber in einem Interview Juli Zehs mit der „Berliner Zeitung“ gefunden: „In den vergangenen Jahren wurden unter dem Stichwort Emanzipation viele Gewissheiten über Bord geworfen, auf denen sich sozialer Zusammenhalt stützte. Das war auch richtig. Es wurde allerdings nicht daran gedacht, dass das den Einzelnen überfordern kann.“
Die „Süddeutsche“ zu dem Satz: „Da sprach die Autorin über ihre politische Sorge um Deutschland, über den Erfolg von Rechtspopulisten und nicht über ihren neuen Roman. Doch der stellt eine ähnliche Diagnose: Der Verlust eines Gottes, eines Patriarchen, einer Heimat treibt Menschen nicht zuerst zur AfD, sondern in die Verzweiflung.“
Die Verzweiflung war schon viel früher da als die AfD. Und sie ist nicht nur in der Provinz zu Hause. Und auch nicht nur in Ostdeutschland. Und sie hat etwas mit einer eher erzwungenen Emanzipation zu tun. Oder besser: einer falschen Emanzipation – denn darunter leidet ja der Held in Zehs Buch: Er möchte so gern ein emanzipierter Mann in einer gleichberechtigten Partnerschaft sein. Aber was ihm begegnet, sind wieder nur Pflichten, Erwartungen und Überforderungen.
Das Gleichgewicht stimmt nicht. Die Partnerschaft ist zu einem Leistungstest geworden, in dem sich der Held selbst zu permanenten Spitzenleistungen anspornt – und daran verzweifelt. Weil das nie aufhört. Selbst sein Bergfahren auf dem Mountainbike zeigt, wie sehr dieser verinnerlichte Anspruch schon wieder eine Art Selbstoptimierung ist.
Und damit eine permanente Störung des eigenen Selbstwertgefühls: Er kann nie genügen. Nicht der Frau. Nicht sich selbst.
Er hat den ganzen Wettbewerbswahnsinn der Zeit auch noch in sein eigenes Familien- und Seelenleben aufgenommen.
Und damit wird Juli Zeh mit Sicherheit wieder viele aufmerksame Leserinnen und auch Leser finden, die beim Lesen sagen: Ja, so ist es. So empfinde ich das auch.
Der Druck geht nie weg und zerfrisst sogar das Allerwichtigste, den letzten Ort, an dem Menschen wirklich Geborgenheit finden würden – wäre da nicht der permanente Leistungs- und Perfektionsanspruch.
Was jetzt nichts mit einem Loblied auf den alten Pantoffelpatriarchismus zu tun hat. Der feiert ja gerade wieder Triumphe und ist als Grundton aus dem panischen Gelärme in den a-sozialen Netzwerken überall herauszuhören. Die Männer zuallererst sind derzeit außer sich. Die Männer, die das Leistungsdenken am tiefsten verinnerlicht haben, am allerdollsten.
Denn wer sie in dieser letzten Bastion der (falschen) Gewissheit aufstöbert, bedroht die letzte als sicher geglaubte Hülle: das letzte Stück männliche Souveränität. Genau das Stück, das die Stimmungsmacher aus dem rechten Spektrum so gut ansprechen. Ihre Anhänger benehmen sich wie waidwunde Tiere. Wie tapfere Helden, die in die Enge getrieben wurden und sich jetzt nur noch von allen Seiten bedroht sehen …
Nicht Emanzipation zerstört Gewissheiten oder sozialen Zusammenhalt, wie Juli Zeh meint. Sie zwingt eher dazu, sich viel intensiver mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu beschäftigen und eine ganz andere Souveränität zu gewinnen.
Wirklich – eine ganz andere Souveränität.
Nicht die, die die neoliberalen Prediger verlangen: Flexibel seiest du, mobil, belastbar, teamfähig und selbstoptimiert.
Das ist keine Souveränität, sondern deren völlige Preisgabe.
Richtige Souveränität lernt man, wenn man sich selbst als unvollkommen, nicht-allmächtig, fehlbar und verletzbar begreift. Als einen Menschen mit allen Höhen und Tiefen, Hoffnungen, Ängsten und Verunsicherungen, die ein Mensch ganz natürlich hat.
Weshalb ja die „Gewissheiten“, die Juli Zeh benennt, so hilfreich sind: Sie sind wie Hilfskonstrukte, die in der eigenen Umgebung Zonen des Vertrauens, des Geborgenseins, des Nicht-Gehetzt-Werdens erzeugen. Also das, was manche Menschen als Heimat empfinden. Der Ort, an dem man so sein darf, wie man sich fühlt.
Wo man niemandem etwas vorspielen muss und man ganz selbstverständlich akzeptiert wird. Wo man sich auch nicht dafür rechtfertigen muss, dass man lauter ausgesprochenen oder nicht ausgesprochenen Ansprüchen nicht genügt.
Manche Menschen finden das just in einer großen, quirligen Stadt. Manche trauern der verlorenen Heimat nach, die nicht mehr reparabel scheint und durch die jetzt scharfe Winde pfeifen.
Und augenscheinlich fühlen sich verdammt viele Menschen zunehmend heimatlos, die ihren Frust jetzt in alle Netzwerke kippen und jeden Strohhalm annehmen. Und dort oft genug in seltsamen Gesellschaften auftauchen, weil die Rezepte der rechten Verführer scheinbar so einfach sind. Quasi Ersatz-Heimatgefühle und das blumige Versprechen, man würde alles wieder so heimelig machen wie anno dunnemals.
Es wird nicht geschehen. Das Versprechen ist faul. So versucht man, Verzweifelte einzufangen. Mit Panikmache und geschürter Angst. Das ist dann sozusagen der finstere Preis, den unsere Gesellschaft für die völlige Vermarktung aller Lebensbereiche zu zahlen hat: Der komplett mobilisierte Mensch wird zur Schwungmasse uralter Heilsversprechen.
Denn – da hat Juli Zeh wohl recht: Der Mensch braucht einen Ort, an dem er Mensch sein darf, ohne dass ihn gleich der Teufel holt.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
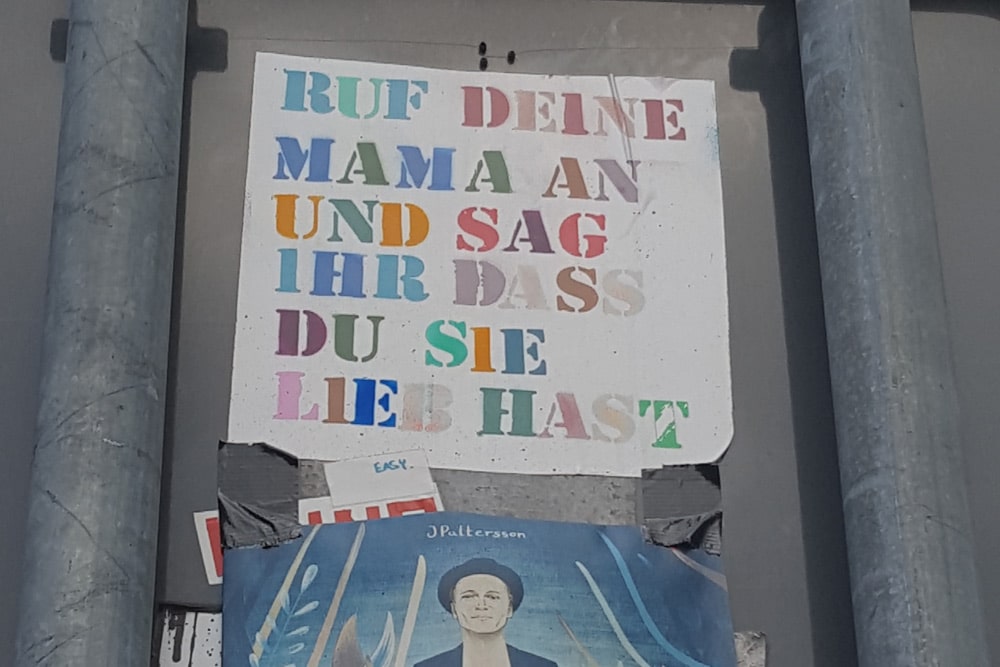








Keine Kommentare bisher