Was mir fehlt, sind die Zweifler. Die Ja, aber- und Nein, doch-Sager. Diejenigen, die das „dubito, ergo sum“ aus dem eigenen Schaffen heraus definieren und Position zwischen den politischen Frontlinien beziehen, um das Wort nicht nur an sich selbst, sondern an all jene zu richten, die sich in ihre diskursiven Schützengräben zurückgezogen haben und einen ebenso sinn- wie schier endlosen Stellungskrieg führen, der im permanenten Abfeuern von Stellungnahmen besteht, in denen sich – selbst zwischen den Zeilen – nicht der leiseste Zweifel an der Richtigkeit der eigenen Position finden lässt.
Dass Donald Trump so tut, als sei er über jeden Zweifel erhaben, ist bekannt. Aber was mir erst jetzt so richtig klar wird, ist, dass sich genau diese Art und Weise des Debatten-Führens bzw. Nicht-Führens im politischen Diskurs durchgesetzt hat.
Ich will nicht behaupten, dass Trump der entscheidende Faktor dafür ist, dass die politische Debatte in den USA – „zumindest“ in der öffentlichen Wahrnehmung – zu den Extremen tendiert und die Mitte von den Rändern zerrieben wird. Dafür sind politische Debatten zu komplex und ihre Ausformung sowie ihr konkreter Verlauf auch von zu vielen Faktoren abhängig, von denen sich nur ein Teil überhaupt steuern lässt.
Fest aber steht, dass sich die Fronten auf der politisch linken wie auf der politisch rechten Seiten immer weiter verhärten, was freilich nicht nur ein amerikanischer Trend ist, sondern auch hierzulande beobachtet werden kann und – mutatis mutandis – wohl auch noch für viele andere Staaten gilt.
Eigentlich wollte ich an dieser Stelle meine Gedanken zu diesem Thema aufschreiben, aber dann bin ich heute Morgen beim Lesen meiner täglichen Dosis amerikanischer Zeitungen, Newsletter und Politikwebseiten auf einen Text des afroamerikanischen Aktivisten und Rechtsanwalts Justin E. Giboney gestoßen, der nicht nur viele meiner Gedanken zu dem Thema enthält, sondern sie auch noch besser formuliert, als ich es in diesem Falle zu tun vermag. Giboneys Sicht auf die Dinge ist zwar – im Gegensatz zu meinen eigenen – christlich grundiert, was auch damit zu tun hat, dass er Vorsitzender der And-Campaign ist, einer Bewegung bibeltreuer Christen, die für soziale Gerechtigkeit protestiert.
Aber die Grundierung spielt in diesem Fall keine Rolle, denn erstens gilt es, die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen, zweitens die Differenz zu betonen, und drittens kann ich vieles von dem, was Giboney sagt, unterschreiben. Außerdem kennt er die Lage vor Ort besser als ich. Ich werde deshalb Mr. Giboney an dieser Stelle zum Tagebuchschreiber machen und dankbar die Rolle des Übersetzers und Kompilators einnehmen.
Giboneys Text beginnt mit dem wenig hoffnungsvoll klingenden Hinweis, dass wir nicht erwarten sollten, es würde eine ernsthafte und durchdachte Diskussion über den aktuellen Verfall der politischen Auseinandersetzung geben. Giboney macht seine These exemplarisch an den aktuellen Protesten gegen Polizeigewalt deutlich und beschreibt den tödlichen Angriff eines jungen Weißen auf zwei Demonstranten der „Black Lives-Matter“ Bewegung in Kenosha Ende August. Anschließend kommt er auf die Unruhen in Minneapolis zu sprechen, die sich aus Gerüchten und Falschnachrichten genährt und den Selbstmord eines Afroamerikaners in einen Mord durch Polizisten verkehrt haben. (Die Sache konnte zwar durch Videoaufnahmen widerlegt werden, aber die Unruhen hörten deshalb nicht auf.)
Danach macht Giboney einen Schwenk rüber zu jener Rede, die Joe Biden beim Parteitag der Demokraten gehalten hat. Aber auch hier macht er sich keine Illusionen. Obwohl Biden den Wunsch geäußert hat, das Land zu einen, bestimmten Tatsachenverdrehungen, gegenseitige Angriffe und das Leugnen des Offensichtlichen den politischen Diskurs – und zwar von den Hardlinern auf rechtskonservativer wie von denen auf linksprogressiver Seite.
„Nur wenige werden ihre eigene Taktik infrage stellen“, schreibt Giboney, „denn deine eigene Gruppe öffentlich zu kritisieren wird als Verrat betrachtet.“ Und weiter: „Unser Stolz und unser Vorurteil zwingen uns dazu, uns einer Seite zuzuschlagen und sie zu verteidigen, ganz egal, was passiert.“
Von einer offenen und ehrlichen Debatte sind die aktuellen politischen Auseinandersetzungen in den USA jedenfalls meilenweit entfernt. Dabei, so Giboney, „benötigen konstruktive Diskussionen Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit zwingt uns dazu, Dinge zuzugeben, die unserer Sache nicht immer sofort dienlich sind.“
Aber es gibt ein Problem: „Wir haben unangreifbare Narrative geschaffen, die ebenso verlogen wie schmeichelhaft sind, und wir schützen sie zum Preis unserer eigenen Glaubhaftigkeit.“ Genau diese Glaubhaftigkeit aber geht immer weiter verloren, und das, obwohl sie eine entscheidende Größe in der öffentlichen Auseinandersetzung ist. Oder zumindest sein sollte.
Das amerikanische Zwei-Parteien-System fördert laut Giboney diese Lagerbildung noch weiter. Jede Seite leugnet die Wahrheiten, die ihr unbequem sind, und das, obwohl sie jedem unbeteiligten Beobachter sofort ins Auge springen. Ein intellektueller und moralischer Bankrott ist die Folge.
„Die Rechte“, so schreibt Giboney, „kann scheinbar nicht zugeben, dass Amerika ein Problem mit Rassismus hat – und immer hatte – und dass in zu vielen unserer Polizeidienststellen eine Kultur gepflegt wird, die für die afroamerikanische Gemeinschaften eine Gefahr darstellt.“
Die politische Linke dagegen „hat Schwierigkeiten zuzugeben, dass viele ihrer Ideen noch nicht mal von denjenigen Leuten unterstützt werden, für die sie vorgeben zu sprechen.“ Giboney, der wie erwähnt selbst afroamerikanischer Herkunft ist, erklärt dazu: „So sind zum Beispiel die meisten Afroamerikaner einfach nicht so ,progressiv‘ oder liberal wie die Linke die Leute Glauben machen möchte.“
Giboney verweist dabei unter anderem auf die Tatsache, dass viele „progressive Linke“ eine Auflösung von Polizeidienststellen oder zumindest einen Rückzug der Polizei fordern, in den schwarzen Communities aber die Mehrheit der Menschen eine gegenteilige Ansicht vertritt und sich nicht nur für den Erhalt der lokalen Polizeiwachen einsetzt, sondern sich auch 81 % der Afroamerikaner wünschen, dass die Polizei mindestens genauso viel oder sogar noch mehr Zeit mit Patrouillen in ihrer Gegend verbringt.
Giboney weiter: „Die Linke verabscheut es, zuzugeben, dass das Chaos in Orten wie Portland ungerechtfertigt und unglaublich kontraproduktiv ist und wenig mit der Achtung des Lebens von Afroamerikanern zu tun hat.“
Diese „unangenehmen Fakten“, so Giboney, sind aber keine Details, die man vernachlässigen könne, sondern sie untergraben den Kern der jeweiligen Identität und ihrer Narrative. Besonders schlimm aber ist, dass diese Ein- und Widersprüche „von interner Kritik abgeschirmt werden“.
Denn: „Wir glauben, dass es unsere Sache schwächt, wenn wir Fehler zugeben. Aber unser Mangel an Aufrichtigkeit schwächt in Wahrheit unsere Glaubwürdigkeit.“ Die Folge: „Es gibt keine Glaubwürdigkeit über die ideologischen Linien hinweg, und deshalb gibt es auch keine wirkliche Diskussion.“
Giboney beschreibt das daraus entspringende Dilemma so: Diejenigen, die die Leute zu einem anderen, d. h. „höheren“ Niveau in der Auseinandersetzung anzuhalten versuchen, werden beschuldigt, in der Diskussion Schwäche zu zeigen oder sich gar nicht um die eigentliche Sache zu kümmern, während andere als Allesversteher abqualifiziert werden. „Die Situation“, so Giboney ein wenig sarkastisch, „ist immer zu drängend für die gebührende Sorgfalt oder dafür, jene anzuzweifeln, die auf unserer Seite sind.“
Die übliche „Lösung“ sieht für Giboney wie folgt aus: „Wenn es sich rausstellt, dass wir unrecht haben, einfach leugnen und weitermachen. Das alles sind echte Teile einer Geisteshaltung der Politik des Mobs.“ (Im Original heißt es bei Giboney „mob mentality politics“).
Einige Trends haben laut Giboney diese Geisteshaltung unterstützt und die damit verbundene Abwärtsspirale des politischen Diskurses in Amerika weiter verschlimmert. Er schreibt: „Die politische Rechte hat das Leugnen von Fakten entschuldigt“ und die Leugnerei an einflussreichen Orten verteidigt.
Es sei für Rechtskonservative selbstzerstörerisch, ihre Anti-Abtreibungspolitik und die Politik der religiösen Einflussnahme um jeden Preis erreichen zu wollen, schreibt Giboney, und das, obwohl – oder besser: gerade weil er das Evangelium zur Grundlage seiner eigenen Politik gemacht hat.
Dagegen habe es der „Postmodernismus der Linken“ seinen Anhänger erlaubt, ihre Realität so umzuformen, dass alle unliebsamen Fakten als soziale Konstruktionen betrachtet werden. Die Linke, so Giboney, habe die „kulturelle und die ökonomische Kraft jene Stimmen abzuschalten, die sie in der Debatte nicht haben will und anschließend zu behaupten, dass die ,cancel culture‘ nicht existiert.“
In einem solchen Klima, so Giboney, werden Nächstenliebe, kollektive Selbst-Besinnung und die Suche nach einer gemeinsamen Basis, die auf moralischen Werten basiert, permanent entmutigt. Stattdessen bestimmen Angst und simple Gut-Böse-Einteilungen den Tag.
„Die andere Seite wird einfach als dumm oder teuflisch betrachtet.“ Aufrichtigkeit wird, so Giboney, dem politischen Gegner damit von vornherein abgesprochen, und seine Absichten als so schlecht bewertet, dass es gar keinen Blick lohnt. Viele Stimmen aus der „weit rechten“ Ecke würden sich laut Giboney nicht einmal trauen, der Mutter eines Afroamerikaners, der Opfer von Polizeigewalt geworden ist, ihr Mitgefühl auszudrücken, ohne vorher überprüft zu haben, ob er nicht möglicherweise einen kriminellen Hintergrund hat.
Kurzum: Alles wird zur Entschuldigung herangezogen, wenn es nur der Unterstützung des eigenen Narrativs dient. Aber auch auf Seite der Linken, so Giboney, gibt es solche Tendenzen, etwa wenn denjenigen, die in Ruhe die Fakten zusammentragen wollen, mit Hass begegnet wird. Die Vorverurteilungen nehmen überhand, weil sich kaum noch einer die Zeit nimmt, ja oftmals gar nicht mehr nehmen kann bzw. darf, sich in Ruhe ein Urteil zu bilden …
Aber da ist noch mehr, denn Giboney schreibt, dass wir uns in die Vorstellung verrannt haben, „dass alles, was die andere Seite tut oder worauf sie zielt nur dazu gedacht ist, uns zu verletzen, zu kontrollieren oder zu betrügen.“ Vieles davon ist aber nichts als eine reine Trotzhaltung, eine Opposition der Opposition wegen, ein Marsch hinein in die Absurditäten.
„Die öffentliche Debatte wird sich nicht verbessern, solange wir uns nicht die Zeit nehmen, zuzuhören“, schreibt Giboney, wobei dieses Zuhören für ihn nur „in einer Haltung der Bescheidenheit und nicht in einer der Ablehnung, der Respektlosigkeit und der hochmütigen Selbstverteidigung“ erfolgen kann.
Denn, so Giboney: „Die meisten Menschen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, streben nicht nach einer marxistischen Revolution.“ Und weiter: „Wir haben es einfach nur satt zu sehen, wie Menschen traumatisiert oder getötet werden in einem Land, das permanent zeigt, dass es sich um die Belange schwarzer Menschen nicht ausreichend sorgt.“
Aber auch die andere Seite verschont Giboney nicht, etwa wenn er erklärt, dass jene Menschen, die sich gegen die „Cancel Culture“ aussprechen, nicht mit Rassisten und Sexisten in einen Topf geworfen werden dürfen. „Wir haben es einfach nur satt, dass nicht-konforme Stimmen auf einen Index gesetzt werden, der auf einer willkürlichen und immer größer werdenden Liste von Tabus basiert – eine Liste, die nicht aus einem allgemeinen amerikanischen Konsens heraus entstanden ist, sondern auf den weißen, westlichen Sensibilitäten der kulturellen Eliten und Akademiker beruht.“
Giboney plädiert deshalb zum Schluss seines Textes für mehr Ehrlichkeit auf allen Seiten, auch und gerade sich selbst gegenüber. Es sollte, so sagt er, nicht darum gehen, um jeden Preis Zustimmung von der eigenen Seite zu bekommen, sondern dem politischen Gegner zuzuhören und offen für andere Argumente zu sein.
Kurzum: Es ist der nagende, plagende Zweifel, den wir wieder brauchen. Aber es ist nicht jener Zweifel, der uns in unseren dunklen Stunden befällt, sondern einer, der weg von uns weist, ein Zweifel, den wir vom Selbst aufs Soziale richten und von innen nach außen stülpen, damit er in die verhärteten Frontlinien der Debatten eindringen kann.
Alle Auszüge aus dem „Tagebuch eines Hilflosen“.
Direkt zum „Tagebuch eines Hilflosen“.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
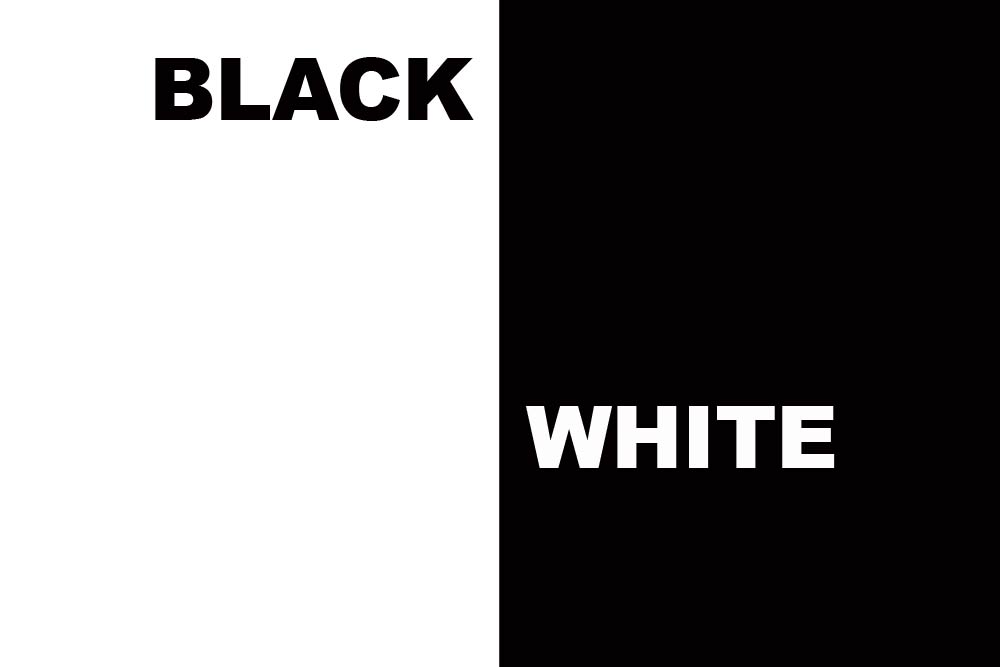








Keine Kommentare bisher