Auch ein Palindrom hat seine Grenzen. Vielleicht nicht unbedingt in der Länge. Da ist dem Berliner Germanisten und Wortkünstler Titus Meyer sicher noch ganz Anderes zuzutrauen als das jetzt vorgelegte Buch-Palindrom „Andere DNA“. Palindrome sind die Worte, die man von vorn nach hinten genauso lesen kann wie von hinten nach vorn. Etwas für Kopfakrobaten.
Erst recht, wenn man wie Titus Meyer die Sache immer weiter treibt. Wozu die deutsche Sprache eigentlich nicht geeignet ist. Denn die notwendige spiegelbildliche Symmetrie haben die meisten Worte nicht. Man muss – naja – nicht nur ein wenig tricksen. Was natürlich möglich ist. Literatur ist auch dazu da, manchmal ein paar Regeln zu brechen. Das braucht dann nur noch Leser, die auch mitspielen.
Denn „Annasusanna“, das kann jeder. Besonders gut konnte es der Satiriker Hansgeorg Stengel. Unsere Sprache hat diese herrlichen kleinen Gewächse des wortwörtlichen Spaßes. Aber darum geht es Titus Meyer nicht. Er lotet in ganz anderen Tiefen und seine Aufgabenstellung heißt: Wie weit kann ich gehen? Wann beginnt unsere Sprache sich zu verweigern? Wann werden die Texte unverständlich? Brüchig? Wann funktioniert Sprache nicht mehr als lesbarer Text?
Mit „Andere DNA“ hat er die Grenze so ziemlich erreicht. Auch wenn er alle Register zieht, das gefundene Wortmaterial ins Spiegelbild zu zwingen und sich über 50 Seiten durch einen Text zu arbeiten, der irgendwo zwischen Essay, Aphorismus, Deklamation, Monolog und Traktat changiert. Ein Roman ist es nicht geworden. Dazu fehlt der Held. Aber dafür rührt es mit seinem Versuch, Sprache ins strenge Spiegelbild zu zwingen, natürlich ans Gedicht, oder zumindest den poetischen Text, der durch Aufbrechen der alltäglichen Wort-Zusammenhänge versucht, Sprache zu entriegeln, vielleicht auch gefügig zu machen. Denn damit überhaupt ein Sinn in die Sätze kommt – die sich ja weiter hinten im Buch buchstabengetreu widerspiegeln müssen – muss Meyer so gut wie alle Regeln, die das schöne, gesittete, fließende Schreiben ausmachen, außer Kraft setzen.
Er kommt von ganz allein in eine Region, in der Sprache sich verwandelt in das, was der mutige Leser als Expeditionen in Länder wie Konkrete Poesie, Experimentelle Poesie oder Dada kennt. Man darf sich durchaus auch an Jandl erinnert fühlen. Denn hier müssen Worte parieren, tackern sie zuweilen wie ein Maschinengewehr, schrumpfen dann wieder zum kurzen Ausruf, zur hingeworfenen Frage, zur wilden Selbstbefragung eines augenscheinlich völlig überdrehten Autors, der zuweilen richtig aus dem Häuschen gerät. Oder zu geraten scheint. Denn die gewählte Baumethode zwingt natürlich geradezu zu solchen Purzelbäumen.
Auf Artikel verzichtet Meyer sowieso, das & macht er zum Satzzeichen, konjugiert wird auch nicht. Der Autor lebt folglich in einem permanenten Jetzt, in dem ihn die Dinge und Zustände regelrecht überfallen, zum sofortigen Reagieren zwingen und damit zu einem Stakkato der Aufgeregtheiten, das einem doch irgendwie vertraut vorkommt, denn man kennt es ja aus Teilen der heutigen Jugendkultur und Teilen der Jugendsprache, die einige Medien und Forscher regelrecht faszinierend finden, weil die Grammatik dort förmlich zu Boden geht. Oder in die Gosse, herunterreduziert auf Worthappen und Kunstphoneme, die ihre Bedeutung tragen, aber kaum noch komplexere Inhalte.
Tatsächlich demonstriert Meyer so beiläufig, wie man da eigentlich hinkommt und was diese Art Sprach-Reduzierung mit dem Sprecher und dem Gesprochenen anstellt. Auch dann, wenn er sein Wörterbuch bei der Hand hat – was aber Titus Meyer wahrscheinlich gar nicht nötig hat. Diese Wortkaskaden entstammen mit ziemlicher Sicherheit seinen eigenen Assoziationen. Der Stoff, mit dem er arbeitet, ist durchaus kohärent und man ahnt, wie er von der Genetik ganz zwangsläufig auf Gott und die Liebe, auf Sex, Natur und Gehirn kommt. Das ist die Folie, aus der er seinen Roman baut – auch wenn (siehe oben) der eigentliche Held fehlt. Dafür tauchen allerlei Gestalten auf, deren Namen sich zwangsläufig aus dem übrig gebliebenen Buchstaben ergibt. Ein gewisser Iwo taucht ziemlich oft auf. Oder ist es das umgangssprachliche Iwo? Manchmal wird es sogar sehr heftig umgangssprachlich.
Was nicht ausschließt, dass Meyer immer wieder mitten in Texten, die einem beim Lesen wirklich viel Aufmerksamkeit abverlangen, kleine Perlen gelingen. Eben noch hat er einen Satz regelrecht in den Würgegriff genommen. Und dann, als würde er unvermittelt das wilde Stakkato verlassen, steht so ein „Red nie intim!“ da. Da er weitgehend auf Flexionen verzichtet, dominiert natürlich im ganzen Buch der Imperativ. Als riefe sich der Autor selbst immer wieder zur Raison.
Was nicht ausschließt, dass er dem Leser durchaus beizubringen versucht, wie er über die Welt denkt. Und die Eselei in der Welt. Denn auch, wer Worte und Sätze ins Palindrom presst, hört ja nicht auf, so seine durchaus berechtigten Gedanken über die Wirklichkeit zu haben: „Eselei Volkstum.“ Kürzer geht’s nicht.
Und wenn’s länger sein muss, dann steht auch mal so ein Satz da: „Embargo welker Ungeister händle Geldes Eid.“ Sag nur einer, dass für Titus Meyer die Finanzkrise als Thema vom Tisch ist. Wenn man die Subtexte ernst nimmt, die sich so zwangsläufig ins Wortgewebe schleichen, dann ist der Autor durchaus mit einer Menge Emotionen gesegnet und sagt seine Meinung immer wieder gern auch völlig unverblümt. Oder – weil vom Material gezwungen – fast im Oden-Ton eines Klopstock: „Nahe, niedere Geldnasen hoeren Hobel der Eden-Orkana.“
Spricht da das Bewusstsein oder das Unterbewusste? Oder erzwingt sich das Wortmaterial selbst die Form, in der es dann ausgesprochen wird? Hier geht es im Artikel „Geld“ natürlich ums Bare. Aber unübersehbar ist Meyer keiner von den Lobpreisern von Börse und Gier, die man täglich im Fernsehen sieht. Er gehört eher zu jener erschrockenen Mehrheit, die unter der Dürre leiden, die die viel gepriesenen Anleger, Investoren und „Märkte“ angerichtet haben. „Nie eint Sitte feist Geldnarren & Hühner“
Inwendig sind seine Texte auch eine Narrenpredigt. Sebastian Brant lässt grüßen. Oder Eulenspiegel. Oder Edgar Allen Poe. Denn wie sonst käme Meyer ausgerechnet beim Stichwort Wissen auf den Raben?
Und just dort begegnet uns einer, der gleichzeitig durch ein anderes Buch spazierte: der Herr Godot. Das sind so kleine Déjà-vus, die man manchmal beim Lesen hat. Aber warum nicht? Die Zeiten sind ja wieder so – in den Wartemodus gerutscht. Und damit auch ziemlich nebelhaft. Keiner weiß, was kommt. Keiner weiß, wer kommt.
Nur Meyer erlebt eine Überraschung am Ende dieses Kapitels: „Mit einem Male kam. u. a. Godot.“
Nie wurde das Dilemma des Herrn Becket so gründlich aufgelöst. Auch Godot ist nur einer von uns Vielen. Und wenn er kommt, ist gar nichts Besonderes passiert. Nur Wladimir und Estragon haben sich wieder einmal völlig verausgabt, weil sie einfach nicht aushalten, dass sie mal ein Stündchen warten müssen.
Was bleibt als Fazit? Nein, ein Roman ist es nicht, auch wenn Hesse und Trakl drin vorkommen. Eher ein vertracktes Gewebe, das den Leser immerfort zum Entschlüsseln zwingt, weil die Satzlogik oft genug auf dem Kopf steht und schon gar nicht aus der Logik der vorangehenden Sätze folgt. Aber man liest, wie weit sich Sprache reduzieren und – mit einiger Kopfakrobatik – auch noch entschlüsseln lässt. Quasi selbst zur DNA wird, die man immer wieder neu zusammenbauen kann. Was ja nicht heißt, dass jedes Mal ein funktionsfähiges Lebewesen dabei herauskommt. Manchmal wird’s auch nur Ulk, manchmal herrlicher Sprachspaß, der nach einer harten Tour durchs Bergwerk der Worte dann immer wieder in solche Passagen mündet: „Liebe ist fies. Liebe ist Ahnung.“
Mehr muss man über das Thema eigentlich nicht sagen. Aber da es mitten im Text erscheint, muss sich, wer hinfinden will, auch durcharbeiten. Aber das ist auf jeden Fall noch aufregender als jeder abendliche Börsenbericht im Fernsehen.
Titus Meyer: Andere DNA, Reinecke & Voß, Leipzig 2016, 10 Euro.
In eigener Sache
Jetzt bis 13. Mai (23:59 Uhr) für 49,50 Euro im Jahr die L-IZ.de & die LEIPZIGER ZEITUNG zusammen abonnieren, Prämien, wie zB. T-Shirts von den „Hooligans Gegen Satzbau“, Schwarwels neues Karikaturenbuch & den Film „Leipzig von oben“ oder den Krimi „Trauma“ aus dem fhl Verlag abstauben. Einige Argumente, um Unterstützer von lokalem Journalismus zu werden, gibt es hier.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
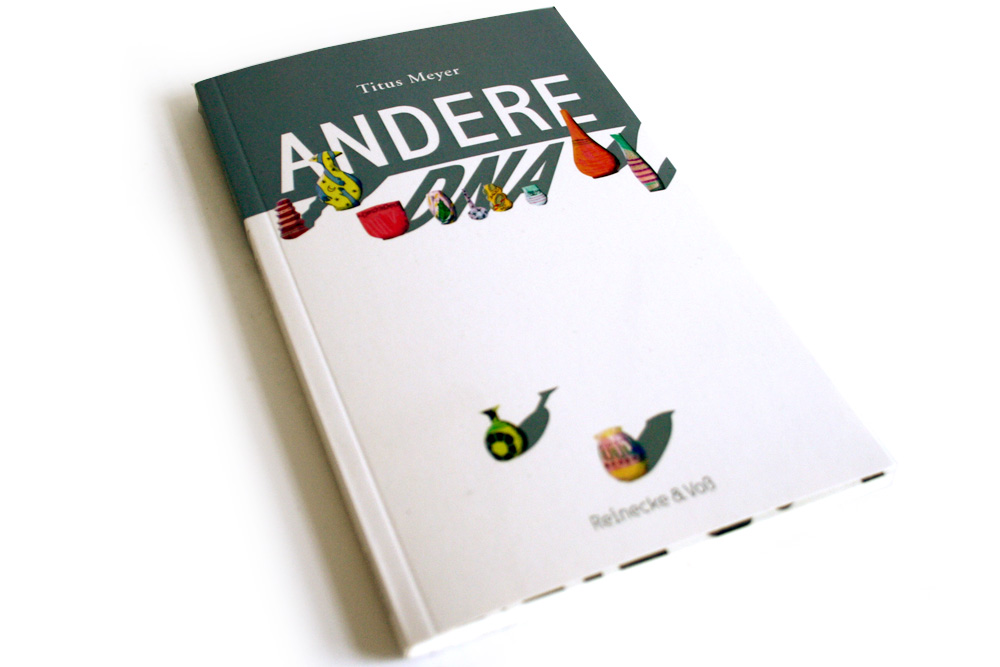








Keine Kommentare bisher