Er gehört zu den Großen und Stillen, Lauten und Begabten unter Leipzigs Autoren: Thomas Böhme. Wer 1983 jung war, der hat seinen Gedichtband „Mit der Sanduhr am Gürtel“ im Regal stehen. Neben den Platten von Bob Dylan. Und vielleicht noch ein paar anderen Böhme-Titeln, die danach erschienen und jeder für sich zeigten, dass dieser Autor Literatur als Musik begreift, so wie Dylan. Nur wurde man mit solchem Stoff in der DDR nie so weltberühmt wie Dylan. Und im heutigen Deutschland auch nicht.
Es bilden sich keine Fan-Gruppen und zu Böhmes Lesungen kommen die Leute nicht andächtig in Scharen, wohl auch, weil er selten liest. Die große Bühne ist nicht seine. Lieber streunt er durchs Grüne, fährt ans Meer oder verschwindet in den Tiefen seiner baufälligen Bücherregale, um dort unverhofft auf Bücher zu stoßen, die ihm seit Jahrzehnten nicht mehr begegnet sind. In der Literatur ist er zu Hause wie der Fisch im Wasser. Ein bisschen ist das wie bei Umberto Eco, nur dass Böhme auch keine Professur angenommen hat.
Vielleicht ist er viel zu beschäftigt, seinen Passionen nachzugehen. Nachlesbar etwa in „Heikles Handwerk“, in dem er sich (höchst poetisch) mit uralten Handwerksberufen auseinandersetzte und ihre Schönheit entdecken ließ. Oder wie in „101 Asservate“, wo er mit alten Worten dasselbe tat. Wer Böhme liest, lernt unsere Sprache wieder zu lieben, taucht in ihren Reichtum ein und merkt, wie lebendig das ist. Und trotzdem: Es sind „unendliche Weiten“, die mit dem, was den meisten Menschen im Alltagssprech begegnet, nichts zu tun haben.
Aber wie erzählt man das? Wie holt man die Unbelesenen wieder ab, jene, die die Angst vor dicken Büchern verinnerlicht haben? Und vor Texten, in denen es nicht gleich nach 160 Zeichen „Daumen rauf“ oder „Daumen runter“ heißt? Sondern erst losgeht?
Mit dem Typus Kalendergeschichte hat Böhme ein altes und einst sehr beliebtes Genre aufgegriffenen. Die Belesenen verbinden das Wort sofort mit Bertolt Brecht und Erwin Strittmatter. Eigentlich ist es kein Erzähltypus. Schon die beiden Genannten sind damit völlig unterschiedlich umgegangen. Und die Autoren, die es im 19. Jahrhundert pflegten, erst recht – man denke nur an Gottfried Keller, Ludwig Anzengruber oder Peter Rosegger. Ihre möglichst kurzen (und zumeist sehr poetischen) Geschichten landeten damals tatsächlich in Kalendern, passten im besten Fall auf ein Kalenderblatt. Die meisten Leute konnten sich damals keine Bücher leisten. Aber ein Kalender, vollgestopft mit lauter Wissenswertem, gehörte in fast jeden Haushalt. Wer Kalendergeschichten schrieb, erreichte ein sehr großes Publikum.
Das ist lange her. Das Genre ist quasi von seinem Ursprung befreit. Und es darf damit gespielt werden – so wie Umberto Eco mit seinen „Streichholzbriefchen“. Die Verwandtschaft ist wirklich nicht zufällig. Denn es geht um die Faszination des Erzählens. Des Schaffens kleiner, lebendiger Welten, in die man gleich mit dem ersten Satz eintaucht. Das ist jetzt ein kleiner Spaß für die Lesenden: Haben Sie schon einmal auf die Ersten Sätze der großen Autoren geachtet? – Natürlich haben Sie.
Denn der Erste Satz ist der Zünder. Und die wirklich begabten Autoren und Autorinnen schreiben alle Erste Sätze, die sofort funktionieren. Die das, was nun kommt, schon komprimiert enthalten. Und gleichzeitig das Tempo vorgeben. Ein Satz, und der Leser ist drin in einer ganzen neuen Welt. Und kommt auch erst wieder raus, wenn er hinten am Buchende den letzten Satz gelesen hat. Wenn überhaupt. Denn die richtig starken Bücher lassen einen ja auch dann nicht los.
Und das alte Bücherregal und einige sehr namhafte Autoren kommen in Böhmes Kalendergeschichten auch nicht zufällig vor. Sie sind eher so kleine freundschaftliche Zeichen an den belesenen Leser, wie das Tuten von Dampfern, die sich auf dem Meer begegnen: „Ich habe dich gesehen. Ich weiß, dass du da bist.“
Dieses Buch ist ein inniger literarischer Spaß. Denn Thomas Böhme schreibt nicht nur für jeden einzelnen Tag im Jahr eine Geschichte, so kurz, dass sie tatsächlich auf das Blatt eines Abreißkalenders passen würde. Es sind auch eher keine Geschichten, sondern kleine Romane. Richtige Romane mit lauter Ersten Sätzen, die einem erstaunlich vertraut vorkommen, weil sie einen sofort an viele vergangene Leseerlebnisse erinnern, an Anfänge großer Romane, in denen schon alles steckt: das Tempo, die Farbe, die Atmosphäre dessen, was da auf einen zukommt. Anfänge, die einen sofort in Erwartung versetzen: Jetzt beginnt eine Horrorgeschichte, ein Dorfroman, eine Hochstapler-Legende, ein Familien-Epos, eine Liebes-Tragödie usw..
Ganze Bücherwelten tauchen vor dem inneren Auge auf – etwa die des großen bürgerlichen Romans. Aber selbst das Märchen, der Reiseroman, der Kafka-Stil tauchen auf. Man merkt es nicht, weil es gekonnt ist. Böhme beherrscht all das. Und er weiß, wie es weitergeht, wie man das, was bei anderen 200 bis 1.000 Seiten füllt, mit einem gewissen Augenzwinkern in sechs (oder ein paar mehr) kurze Sätze packt, den Roman also auf seine Essenz reduziert. Und dann – manchmal unverhofft – zu Ende bringt.
Und nicht nur das. Denn das wirkt ja wie gekünstelt, als sei es nur eine Art zu zeigen, dass einer ohne viel Federlesen auch 365 Romane schreiben kann. Halt sehr kurze, komprimierte. Aber Romane haben (wenn sie gut sind) immer auch eine zweite und dritte Ebene. Hinter dem Erzählten lauert immer auch das Unfassbare, das Ungezähmte und Unberechenbare des Lebens. Das, was man nur erzählen kann, nicht beherrschen. Das, was richtig gute Romane so traurig und mitreißend macht. Oder so wahnwitzig skurril wie die Geschichten Kubins oder Meyrinks oder von Roald Dahl.
Natürlich steckt auch ein bisschen Wehmut drin, denn aus seinem Bücherregal fischt Böhme auch Autoren, die zu ihrer Zeit beliebte Schriftsteller waren, die heute aber kaum noch einer kennt. Und trotzdem funktionieren ihre Geschichten noch. Nur halt nur noch für den, der die Bücher ganz hinten zwischen Staub und Spinnweben findet – so wie in „Sudermann oder Sternheim?“ Was den Leser auf seltsame Art freut, da er sich wohl sicher sein kann, der Einzige zu sein, der das jetzt gerade liest. Diese Kalendergeschichte kommt übrigens direkt vor der, die dem Buch den Titel gegeben hat: „Puppenkino“.
Oberflächlich betrachtet bringt der Titel ja auf den Punkt, dass man hier 365 Romane im Puppenstadium vor sich hat, für die es nur ein bisschen Phantasie braucht, und sie entfalten sich zu großen, schillernden Schmetterlingsromanen.
Aber die betreffende Kalendergeschichte macht einen beängstigenden Gedanken zu einer Geschichte, in dem tatsächlich Puppen im Gemeindesaal sitzen und einen Film mit spielenden Kindern sehen. Puppen, die sich benehmen wie richtige Menschen. Ein kleiner, verstörender Einfall, und man landet in einer seltsamen Welt, die so seltsam aber nicht ist, wenn man sieht, was Konzerne wie Disney mit ihren Puppenfilmen und den Köpfen unserer Kinder anstellen.
Von solchen verstörenden Geschichten gibt es mehrere im Buch. Böhme braucht gar nicht erst in sein großes Bücherregal zu greifen. Er muss nur losgehen nach draußen – etwa in den Wald, wo ihm die Märchenlösungen der Grimms vor die Füße fallen, oder in den Garten, wo die seltsamen Geräusche aus dem Unterholz die Neugier anregen. Mal reicht ein geköpfter Gartenzwerg, eine Geschichte im Kopf in Gang zu setzen, mal animiert ein Regentag zum Nachdenken über die vielen Stufen von Grau.
Und wer das noch kennt, so ohne permanente Informationsberieselung aus silbernen Apparaten durch seine Tage zu wandern, der weiß auch, dass sein Gehirn genau so etwas macht, auf eigenartige Gedanken kommen kann und mit inniger Freude Geschichten daraus spinnt, Geschichten, die sich mit den Märchen aus 1001 Nacht vermischen, mit alten Bibel-Geschichten oder den noch viel phantastischeren Geschichten aus alten Naturkundebüchern.
All das gehört ja zu unserer Welt. Es ist da, wenn man es gelesen hat. Und es meldet sich, wenn wir in einer zunehmend kafkaeskeren Welt genau solchen Typen und Vorgängen begegnen. Wer belesen ist, weiß, warum man sich wundert. Und warum einem viele Menschen wie Marionetten vorkommen, längst beschriebenen Nachtmahren, die nun auf einmal mit grauer Selbstverständlichkeit Teile der Wirklichkeit besetzen.
Und wer nun wirklich wissen will, wie so eine komprimierte Geschichte beginnt, hier nur ein Beispiel: „In jenen finsteren Zeiten, in denen Europa von unpassierbaren Grenzen durchzogen war, erschien uns das Leben in geschützten Enklaven als das einzig erstrebenswerte.“
Wie es weitergeht? Selber lesen. Auch darin ist Böhme ja Umberto Eco verwandt: Er trifft den träumerischen Ton, das Märchenhafte, das unser Erinnern durchzieht und in dem sich das Gelesene mit dem Erlebten verwebt. Und in dem sich alles immerfort ändert. Auch darüber gibt es etliche Geschichten, viele Traumgeschichten, in denen Böhme zeigt, wie unser Gehirn unser Erlebtes immerfort in neue, überraschende Erlebnisse verwandelt. Während sich unsere Vergangenheit ständig verändert, weil das Erinnerte sich immer neu sortiert, manches verschwindet, anderswo füllen neue Geschichten die Löcher auf. Sodass sich auch der aufmerksamste Autor nie sicher sein kann, ob das noch seine selbst erlebte Vergangenheit ist, der er nachforscht, oder schon eine hinzuerfundene.
Was sicher auch manchen Leser verunsichern dürfte: Wie verlässlich ist Erinnerung? So wird das immerfort neue Strukturen schaffende Gedächtnis sichtbar, wie beiläufig. Und wer dann meint, da werde es dann wohl diffus, der irrt. Der weiß nicht, wie diese Aufmerksamkeit für das Erinnerbare und Wahrnehmbare dazu führt, dass die Gegenwart ertappt und aufgespießt wird in ihrer ganzen Surrealität. In „Knüppel zwischen die Beine“ genauso wie in „Sozialkunde“.
Und auffällig ist auch, wie stark das Thema Krieg den September dominiert. Auch das ein Thema falschen Denkens. Böhme braucht nicht viele Sätze, um die ganze Idiotie der Kaiser, Rittmeister und Ritter auf den Punkt zu bringen, die den Krieg als spannendes Abenteuer für die Soldaten verkaufen und Brandschatzen als Lösung höchst ritterlicher Probleme verstehen. Man muss sich nur umschauen in Medien und anderswo: Diese Typen sind allgegenwärtig. Leute ohne Erinnerung, ohne Wissen und ohne Geschichte, die immer wieder zu denselben Mitteln greifen und bei der Menge Eindruck schinden, wenn sie abmarschieren mit der bekloppten Behauptung: „Die Pflicht ruft!“
Habe ich gesagt, dass das Buch keine Emotionen wachruft? Es ruft. Und zwar im Tagestakt. Weshalb man vielleicht gut daran tut, wirklich nur jeden Tag eine Kalendergeschichte zu lesen. Sonst wird man zu unruhig, womöglich zu unbeherrscht bei der Begegnung mit diesen Helden unserer Wirklichkeit, die da draußen rumlaufen.
Und weil uns bei der Gelegenheit das Fehlen der Rezension zu Thomas Böhmes „Mit der Sanduhr am Gürtel“ von 2011 auffiel, haben wir sie flugs wieder ins System gestellt. Manchmal hilft ein gut sortierter Server, ein paar wichtige Dinge nicht zu vergessen, die sich sonst in ein Märchen oder in eine Traumparabel verwandeln.
Thomas Böhme Puppenkino, Connewitzer Verlagsbuchhandlung, Leipzig 2019, 15 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
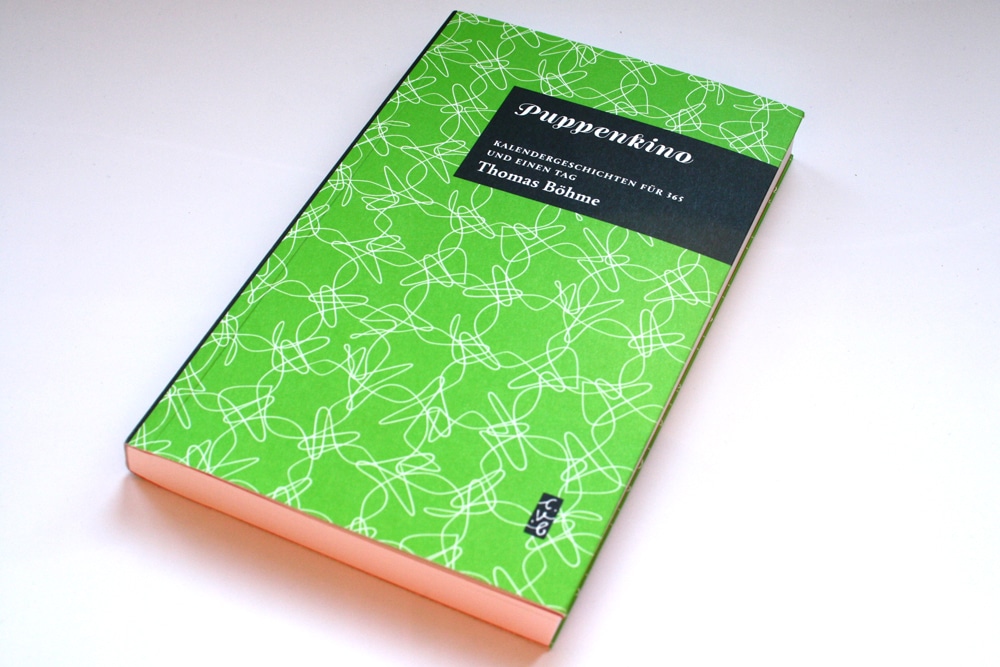











Keine Kommentare bisher