Friedrich Wolf war mal ein sehr bekannter deutscher Schriftsteller, schrieb erfolgreiche Stücke wie „Cyankali“, „Die Matrosen von Catarro“ und „Professor Mamlock“. Fast genauso berühmt wurden seine Söhne – Konrad Wolf als einer der bekanntesten Regisseure der DDR und Markus Wolf als Chef des DDR-Auslandsgeheimdienstes. Eine berühmte Familie. Mit tiefen Abgründen. Und die haben nun einmal mit der Familiengeschichte zu tun, wie der Germanist und Theologe Stefan Gotthelf Hoffmann feststellen kann, der sich tief in die Familiengeschichte der Wolfs hineingearbeitet hat.
In seinem Buch „Die weite Welt wird eng“ hat er sich ausführlich mit dem Trauma in der Geschichte der Familie Wolf beschäftigt – dem ungesühnten „Nordecker Judenmord“ von 1884, dem die Großeltern von Friedrich Wolf zum Opfer fielen. So etwas bleibt nicht ohne Spuren in den nachfolgenden Generationen. Gerade der Vater von Friedrich Wolf, Max Wolf, war zutiefst traumatisiert. Das prägte dann auch seine Rolle als Vater gegenüber dem talentierten Jungen.
Und genau um diese schwierige Beziehungskiste geht es nun in diesem Buch, das Hoffmann als „Eine psychobiographische Deutung“ untertitelt hat. Denn Schriftsteller merken oft selbst nicht, welche Muster ihr Leben bestimmen und wie sich diese Muster in ihren Arbeiten niederschlagen. In ihrem Leben sowieso, in gescheiterten oder gelungene Ehen, in Liebschaften und Freundschaften.
Und da zu Friedrich Wolf mittlerweile auch ein ganzer Stapel biografischer Arbeiten vorliegt, hat Hoffmann jede Menge Stoff, um darin die Muster zu finden, die von genau jenem Friedrich Wolf erzählen, der sich immer schon hinter dem „Klassenkämpfer“ Friedrich Wolf verborgen hat. Auch Kritiker und Anbeter sehen oft nur das, was sie sehen wollen, halten die Flucht in Arbeit, Werk und Klassenkampf für innerste Überzeugung und übersehen dabei meistens, dass diese Ruhm- und Bestätigungsfelder oft auch nur eine Flucht sind. Eine Flucht vor den eigenen Gespenstern. Oder in eine Bestätigung, die Ersatz sein muss für eine Unterstützung, die ein Friedrich Wolf in seiner Kindheit nie bekommen hat.
Der fremde Vater
Hoffmann kann – belegt durch viele biografische Aussagen – sehr ausführlich von der fast symbiotischen Beziehung von Friedrich Wolf zu seiner Mutter Ida erzählen, versucht aus allen verfügbaren biografischen Daten die Familienkonstellation der Familie Wolf zu rekonstruieren, in der ausgerechnet Friedrichs Vater Max keine wirkliche Rolle spielte. Außer die eines oft abwesenden und meist sehr aggressiven Vaters, der zeitlebens keine wirklich emotionale Bindung zu seinem Sohn aufbauen konnte. Der oft so unbeherrscht reagierte, dass Friedrichs Mutter regelrecht zur Beschützerin des Jungen werden musste, die ihn regelrecht „bemutterte“.
In solchen Konstellationen bilden sich die Rollenmuster aus, die einen Menschen zeitlebens begleiten. In diesem Fall natürlich auch dadurch verstärkt, dass die Rollenbilder der Eltern auch noch dem Erziehungsbild der Zeit entsprachen. Der abwesende, patriarchalische Vater und die klammernde Mutter, die die fehlende emotionale Nähe zum Vater durch die Umsorgung des Sohnes kompensierte. Der dann – wie könnte es anders sein – zeitlebens damit beschäftigt war, beiden Erwartungshaltungen irgendwie zu genügen. Dem Vater durch sein literarisches Werk zu beweisen, dass er nicht der vermutete Versager war. Und der Mutter immer wieder zurückzuspiegeln, dass er sich nur in ihrer unendlichen Liebe geborgen fühlte.
Ein Muster, das er dann auch wieder auf seine Frauen übertrug – die beiden Ehefrauen und seine vielen Geliebten. Ein Muster, das auch wieder zeigte, wie er versuchte, in den Frauen – die den narzisstischen Arzt und Schriftsteller durchaus faszinierend fanden – immer beides zu suchen: die bedingungslose Geliebte, die sich dem Genius zur Verfügung stellte. Und gleichzeitig die sorgende Mutter, die ihm das Gefühl von Geborgenheit verschaffen konnte. Eine Rolle, in die dann zumindest Else Dreibholz ausfüllte, die Wolf 1922 heiratete. Während seine erste Ehe mit Käthe Gumpold gescheitert war, weil sie sich in dieser Weise nicht unterordnen und verleugnen wollte.
Ein ziemlich einseitiges Frauenbild
Und auch Else hatte einiges auszuhalten in dieser Ehe, deren stabiler Anker sie war, vor allem die Liebschaften, die Friedrich Wolf nicht einmal verbarg – etwa jene zu Lotte Rayss und Ruth Herrmann. Aber die Frauen sahen durchaus, welche Spiele Wolf da spielte, und thematisierten das auch in ihren Erinnerungen an den Schriftsteller, der selbst nur zu gern das Bild vom klassenbewussten Autor bediente, der sein ganzes Schaffen dem Klassenkampf unterordnete.
Und die sozialistische Schönmalerei übernahm das nur zu gern. Wolfs Dramen waren Schulstoff in der DDR, wurden geradezu als revolutionäre Literatur verkauft, selbst Wolfs Stück „Cyankali“, das sich mit dem damals schon umstrittenen § 218 beschäftigte. Aber eben keineswegs in emanzipatorischer Absicht, wie oft lobhudelnd betont wird. Die Legende nimmt Hoffmann so ganz nebenbei auch auseinander und zeigt einen Friedrich Wolf, dem die Selbstbestimmung von Frauen völlig egal war. Und für den der „Abtreibungsparagraph“ nur so lange ein Thema war, so lange er ein Paragraph der kapitalistischen Gesetzgebung war. In der erträumten sozialistischen Gesellschaft hatte Wolf kein Problem damit, den Pragraphen wieder in Funktion zu sehen, weil ja dann die Benachteiligung der Armen und Arbeitenden nicht mehr existieren würde.
Es gibt etliche Stellen in Wolfs Arbeiten, die die eigentliche Denk- und Seelenwelt des Autors verraten, der selbst eine Menge dazu getan hatte, das Bild vom unabhängigen, selbstbewussten und klassenkämpferischen Autor zu formen, der auch im Privatleben keine bürgerlichen Vorurteile mehr kannte und ein freies Liebesleben praktizierte.
Ersatz-Befriedigungen
Ein Liebesleben, das aber gerade für die Frauen, die es betraf, so frei nicht war. Und schon gar nicht ohne Leiden, wie Hoffmann feststellen kann. Der „rettende vierte Pol“ in seinen Beziehungen war zwar irgendwie Ersatz für den Vater, der ihm seine Anerkennung versagte. Aber die „politische Sache“ ist immer nur eine Krücke. Nicht nur bei Wolf. Männer mit diesem fehlenden Vorbild eines vertrauenden und stärkenden Vaters suchen sich im öffentlichen Jubel ihre Bestätigung, jene Ersatz-Belohnung für Pflichterfüllung, Arbeitseifer und Gehorsam, den die politische Bühne immer wieder zu versprechen scheint. Nicht nur die der Linken, das kann man anmerken an dieser Stelle.
Denn das Psychogramm, das Hoffmann von Friedrich Wolf zeichnet, ist so außergewöhnlich nicht. Es trifft auch heute noch auf ganze Heerscharen narzisstischer Männer zu, die ihre in der Kindheit erfahrenen seelischen Defizite mit dem Rangeln um öffentlichen Applaus zu ersetzen versuchen. Und die dabei auch rücksichtslos und mit Ellenbogen vorgehen.
Dass das auch auf Vorbilder aus der linken politischen Bewegung zutrifft, macht Hoffmann hier nun einmal an Friedrich Wolf deutlich. Wobei eine Frage noch ausgeklammert bleibt, die er in diesem Buch nicht behandelt: Wie agierte Wolf eigentlich selbst als Vater? Oder gab er die eigenen Defizite auch wieder an seine Kinder weiter? Denn was man für sich selbst im Leben nicht erkennt, das wirkt unausgesprochen weiter. Schafft Folgen des Nicht-Wissens und des Nicht-Wissenwollens, die ganze Gesellschaften prägen.
Tradierte Muster
Da wäre jetzt auch die ostdeutsche Perspektive auf das Wolf-Bild interessant. Die vielleicht schwerer zu gewinnen ist als die eher unabhängige des in Lüneburg geborenen Autors, der sich Friedrich Wolf über die aktenkundige Familiengeschichte annähert. Denn die destruktiven Kindheitsmuster, die auch die sozialistischen Helden mit sich trugen, bewahrten ja auch alte Klischees und Vorurteile über das, was man so menschliche Beziehungen nennt. In diesem Fall die patriarchalen Rollenmuster des Wilhelminischen Kaiserreichs. Oder mit Hoffmanns Worten: „Der Sohn Friedrich ist nur mit der Mutter verbunden, diese wiederum mit dem Kindsvater/ Ehemann, wobei das Kind keinen eigenen Zugang zum väterliche Dritten hat und den Kontakt strikt meidet. Diese dysfunktionale Triade entspricht der tradierten patriachalischen Kommunikationsstruktur in Familien.“
Wie lange hat das überlebt? Oder ist das überhaupt verschwunden? Kann das verschwinden, wenn es nicht gesellschaftlich thematisiert wird und stattdessen Männer weiterhin darin bestärkt werden, ihre Bestätigung allein außerhalb der Familien zu suchen? Natürlich gibt es längst andere Familienmodelle. Aber unübersehbar wirken die alten Rollenbilder bis in die Politik hinein immer noch, bestimmen Wahlentscheidungen und erleben sogar regelrechte Comebacks, wenn die Rollenangebote rechtsradikaler Parteien wieder Konsens werden.
Versteckte Muster
Was durchaus zeigt, dass die so gern diskutierte Frage der Freiheit eigentlich hier – in Partnerschaft und Familie – ihre Wurzel hat. Wo der starke, stärkende Vater seine Rolle nicht ausfüllt und zutiefst verunsicherte Söhne in die Welt entlässt, reproduzieren sich die alten Rollenbilder immer wieder. Mitsamt ihren psychischen Folgen für Frauen und Kinder. So gesehen, war Friedrich Wolfs Hinwendung zu Sprache und Schreiben auch eine Flucht, wie Hoffmann letztlich feststellen kann. Eine Flucht aus der Beschäftigung mit seinen eigenen Verunsicherungen in eine Welt, die er augenscheinlich beherrschte. In der er die Macht über das hatte, was er schrieb und veröffentliche.
Bis zu einem gewissen Grad, wie Hoffmann zu recht feststellt. Aber das findet man nur, wenn man Wolfs Arbeiten gegen den Strich liest und das tatsächliche Menschen- und Frauenbild darin findet, das Wolf ganz selbstverständlich übernahm. Es blieb nur für die meisten Zeitgenossen unter seiner „politischen Botschaft“ verborgen. Unsichtbar, weil man den klassenkämpferischen Autor sah, aber nicht den Mann, der im Schreiben eine Bestätigung und Anerkennung suchte, die ihm der schwer traumatisierte Vater nie geben konnte.
Aber Hoffmann sitzt schon längst an den nächsten Büchern, mit denen er die Lebens- und Familiengeschichte Friedrich Wolfs unter die Lupe nimmt. Wohl wissend, dass sich die leidvollen Erfahrungen aus einer Kindheit immer in Leben und Werk eines Autors spiegeln. Oft genug unsichtbar für die Leserinnen und Leser. Bis sie die Muster hinter der Geschichte zu sehen lernen. Die einem dann oft genug nur zu vertraut vorkommen.
Stefan Gotthelf Hoffmann „Friedrich Wolf und die Frauen“, Edition Schwarzdruck, Gransee 2025, 15 Euro
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
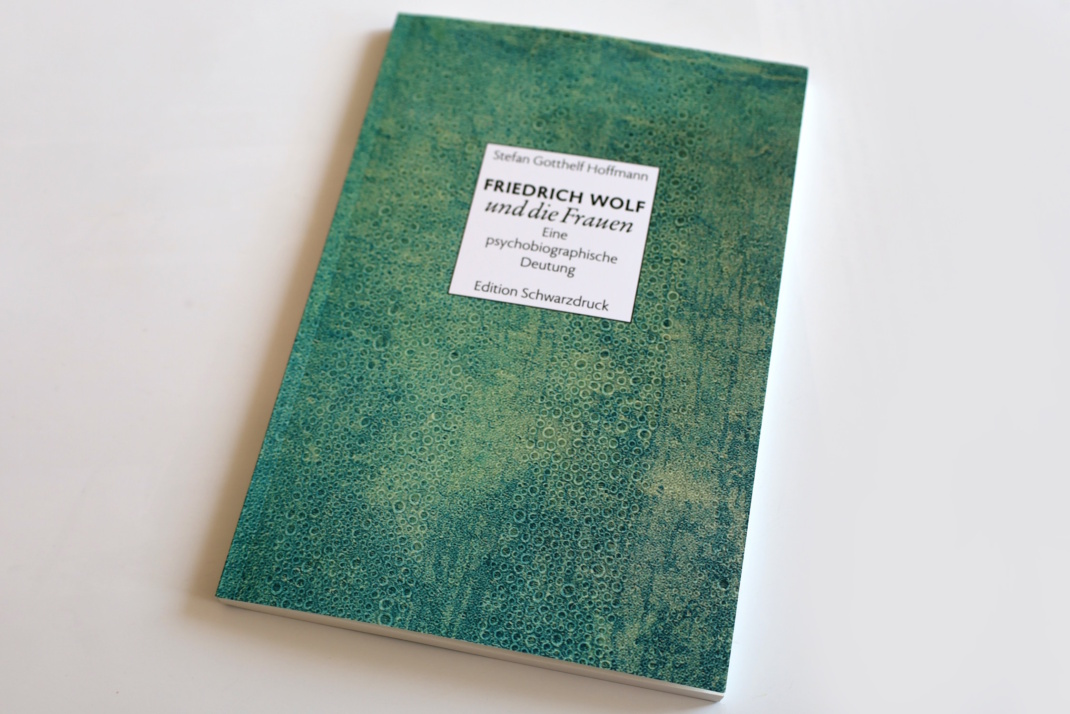














Keine Kommentare bisher