„Der Aggregatzustand des öffentlichen und privaten Lebens hat sich wegen des Coronavirus binnen weniger Tage verändert. Es ist ein soziales Experiment, das es in solcher Radikalität noch nie gegeben hat“, beginnt Matthias Alexander seinen aktuellen Beitrag in der F.A.Z. „Stresstest für das öffentliche und private Leben“. So, wie dieser Tage viele Kommentatoren ihre Beiträge beginnen, bass erstaunt, dass so ein kleiner Erreger ganze Länder in den Ausnahmeszustand versetzten kann.
Der Einstieg verspricht dann stets eine Menge. Und fast immer endet die Glosse dann – wie auch bei Alexander – in süßlichem Familienkitsch. Dabei bringt die Pandemie des Coronavirus nur etwas zum Vorschein, was so tief in unserem Denken über Wirtschaft und Freiheit steckt, dass wir es einfach nicht mehr sehen. Auch wenn wir es spüren. Denn nicht ohne Grund feiern Dystopien in TV und Kino seit Jahren Erfolge.
Die Menschen sind süchtig nach diesen Welt- oder Gesellschaftsuntergängen. Manchmal sieht es so aus, als würden Millionen Menschen geradezu genießen sich auszumalen, wie eine Welt aussehen könnte, deren gesellschaftliche und wirtschaftliche Grundlage zusammengebrochen ist und in der dann wieder bizarre Diktaturen entstehen.
Gerade hier setzen ja rechtsradikale Szenarien an. Sie spielen mit dieser unterschwelligen Angst. Der schöne bürgerliche Schein ist – wenn schon nicht brüchig – dann doch gefühlt sehr fragil geworden. Was natürlich mit ganz realen Entwicklungen zu tun hat, die aber meist ausgeblendet werden.
Denn das, was so flapsig als Globalisierung bezeichnet wird, birgt auch Gefahren Und zwar sehr reelle Gefahren, die jedes System hervorbringt, das derart komplex ist. Die Corona-Pandemie ist ja nicht die erste, die zeigt, wie sehr die weltumspannenden Reisen der heutigen mobilen Jobber und Touristen die schnelle Ausbreitung des Virus begünstigen.
Denn es sind ja Menschen, die dafür gesorgt haben, dass das Virus sich aus der chinesischen Provinz Wuhan in alle Winkel der Erde ausgebreitet hat. Genau über jene globalen Verbindungen, die das Rückgrat der Globalisierung sind. Die aber – wie der Flugverkehr – schon lange auch aus klimapolitischer Sicht in Verruf sind.
Wer hat eigentlich so ein enormes Interesse daran, alle, wirklich alle Prozesse der menschlichen Gesellschaft derart zu globalisieren?
Oder passiert das, ohne dass es jemand Konkretes tatsächlich will? Weil es irgendwie zum absoluten Wachstumswillen der deregulierten Märkte gehört, die alles niederwalzen, was als Grenze und Hemmnis verstanden werden könnte? Sodass also niemand Konkretes benennbar ist, der das will. Und trotzdem kann sich niemand dem entziehen, nicht einmal Regierungen? Nicht mal ein Trump, der sein Land versucht, wieder mit Zollschranken zu umgeben.
Wenn man aber die Kontrollen niederreißt, passiert so etwas wie die Corona-Pandemie.
Aber es muss auch keine Pandemie sein.
Wer die jüngeren Erfolgstitel dystopischer Romane gelesen hat, weiß, dass hochbegabte Autoren sich genau dort Gedanken machen, wo man sich im politischen Diskurs das Denken regelrecht verbietet. Man denke nur an Andreas Eschbachs „Black Out“. Da ging es um die elektronisch vernetzten Infrastrukturen, die natürlich auch einen gewissen Puffer haben. Aber was passiert, wenn an einem wichtigen Knotenpunkt die Systeme ausfallen? Passiert dann das, was normale Internetnutzer erleben, wenn irgendwo bei Bauarbeiten eine Leitung durchtrennt wird?
Und wie funktioniert das Leben eigentlich weiter, wenn die riesigen Verteilerketten und Netzwerke ausfallen, ohne die heute nichts mehr geht?
Ein Gedanke, der auch den britischen Autor Robert Harris umtrieb, jenen Burschen, der sich mit der „Cicero“-Trilogie schon ausgiebig Gedanken gemacht hat darüber, wie leicht manipulative Narzissten eine Demokratie kapern und zerstören können. Da fiel der dystopische Einbänder von 2019 gar nicht so auf: „Der zweite Schlaf“ hieß der und schildert ein England 600 Jahre nach einem Ereignis, über das der Held in der Geschichte nur Rätselraten kann, denn mittlerweile herrscht die Kirche wie im Mittelalter und hat alle alten Bücher für ketzerisch erklärt. Dennoch kommt der Held der Geschichte auf die Spur eines einst renommierten Wissenschaftlers, der aus der Überzeugung, dass der Crash des Systems bald kommen werde, die Folgerung zog: Dann muss man so etwas wie eine Arche bauen.
Drei Varianten eines möglichen Crashs zählt Harris auf. In dieser Geschichte ist es der Komplettausfall aller digitalen Netze, der dazu geführt hat, dass das globalisierte Distributionssystem binnen weniger Stunden zusammenbrach und in dessen Folge binnen weniger Tage auch die Zivilisation. So gründlich, dass die Menschen in England 600 Jahre später nicht nur wieder abgeschottet von der Welt leben, sondern auch in komplett feudalen Verhältnissen. Die Überreste unserer Technologie werden von den einen andächtig gesammelt, von anderen auf Scheiterhaufen verbrannt.
Es ist ein Buch, das auch zeigt, wie eng verzahnt Technologie, Mobilität und gesellschaftliche Freiheit sind. Und dass es in unserer Hyper-Vernetzung keine Rückfallebenen gibt, wenn die Systeme ausfallen. Das ist der offensichtlichste Fehler der „Globalisierung“, die in ihrem rücksichtslosen Niederreißen aller Regularien vergisst, innerhalb des Systems selbsterhaltende Zellen und Kreisläufe zu schaffen, die auch dann noch reibungslos funktionieren, wenn anderswo ein Netzwerk ausfällt. Oder eben ein bislang unbekannter besonders tödlicher Virus zu rigiden Abschottungsmaßnahmen führen muss.
Deswegen ist ja das Nationalstaatskonzept so verlockend, dessen Verfechter zu glauben scheinen, dass man innerhalb eines abgeschotteten Staates wieder die Souveränität über alles zurückgewinnt.
Was ich aber für einen Trugschluss halte. Denn damit wird auch das wieder gekappt, was an einer Globalisierung positiv sein könnte: Die Fähigkeit, auf globaler Ebene auf Katastrophen zu reagieren und gemeinsam zu handeln. Die hat in den vergangenen 30 Jahren sowieso gelitten, ganz so, als hätten die jüngeren Politikergenerationen nicht einmal die Grunderfahrungen der in Ost und West geteilten Welt und der Friedenspolitik vor 1989 verinnerlicht. Als könnte man einfach wieder genauso rücksichtslos agieren wie in der Frühzeit der Nationalstaaten.
Wie Staatsapparate reagieren auf Katastrophen, die sie nicht verstehen, hat ebenfalls 2019 Louise Erdrich in ihrem Roman „Der Gott am Ende der Straße“ beschrieben.
Hier tritt die Katastrophe dadurch ein, dass die neugeborenen Kinder regelrecht regredieren, also in der Evolution einen kompletten Schritt zurückgehen. Wobei man nicht so recht erfährt, was wirklich vor sich geht, ob die Babies bei der Geburt gleich sterben oder tatsächlich Kinder auf dem Stand des Vormenschen geboren werden. Denn einer der ersten Schritte, zu denen Staaten bzw. Regierungen in solchen Fällen immer greifen, ist die Zensur aller Nachrichten.
Die sich nicht nur in China durchsetzen lässt. Louise Erdrich kennt ihre USA nur zu gut, um zu wissen, dass auch die dortigen Verantwortlichen zu sehr diktatorischen Maßnahmen greifen können, wenn sie meinen, damit einer Entwicklung Herr werden zu können. Das muss keine Pandemie sein. Das kann – wie in diesem Fall – auch der Versuch sein, den vollen Zugriff auf alle Schwangeren und damit auch auf die möglicherweise nicht geschädigten Kinder zu bekommen.
Wie es Dystopien so an sich haben, enden beide Romane im Grunde tragisch, scheitern auch jene Helden, die versuchen, sich dem staatlichen Zugriff zu entziehen.
Denn auch wenn unsere Regierungen erstaunlich schwach wirken in ihrem Umgang mit der globalisierten Wirtschaft und den weltweit zu erlebenden Folgen der ausgeplünderten Natur, zeigen auch die jetzigen Reaktionen auf die Corona-Pandemie, dass die Staatsapparate selbst durchaus in der Lage sind, tief in den Alltag der Menschen einzugreifen. Sie sind nicht wirklich schwach.
Sie können – wie in Ray Bradburys „Fahrenheit 451“, sehr schnell selbst zum Teil einer Dystopie werden. Das ist in Bradburys Roman von 1953 ganz ähnlich wie bei Harris. Denn Dystopien bestärken eine Menschengruppe, die die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie per se verteufelt, gerade dann, wenn die fundierten wissenschaftlichen Erkenntnisse vorher regelrecht ignoriert oder verdrängt wurden.
Technologie an sich ist noch kein Fortschritt. Schon gar nicht, wenn die Gefahren der Technologie ignoriert werden und (gern aus „Effizienzgründen“ wie im deutschen Gesundheitssystem) Rückfallebenen und Sicherungssysteme eingespart oder gar nicht erst geschaffen werden.
Die erwähnten Autor/-innen haben nur mit großer Imaginationskraft beschrieben, was sie befürchten. Sie haben die nur zu berechtigten Besorgnisse unserer Gesellschaft aufgegriffen. Und sie lassen sich – glücklicherweise – nicht beruhigen oder sich gar ausreden, diese Besorgnisse hätten keine Grundlage. Das haben sie wohl. Und gerade die Corona-Folgen werden zeigen, wie elementar es ist, über die blitzblanken Schattenseiten der Globalisierung nachzudenken, über solche Dinge wie Regionalität, Kreisläufe, Sicherungen und auch die notwendigen Grenzen von Mobilität.
Denn hinter dem Gefühl, dass die globalen Prozesse aus dem Lot geraten, steckt ja auch die Erfahrung eines schleichenden Kontrollverlustes. Denn wenn immer mehr elementare Entscheidungen in irgendwelchen Konzernzentralen auf anderen Kontinenten getroffen werden, verstärkt sich beim „Endkunden“ das Gefühl, dass er von Strukturen abhängig ist, die er weder durchschaut noch beeinflussen kann.
Und darauf reagieren Menschen völlig unterschiedlich. Auch das spiegeln die politischen Entwicklungen der letzten Jahre.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache (Stand 24. Januar 2020): Eine steigende Zahl von Artikeln auf unserer L-IZ.de ist leider nicht mehr für alle Leser frei verfügbar. Trotz der hohen Relevanz vieler Artikel, Interviews und Betrachtungen in unserem „Leserclub“ (also durch eine Paywall geschützt) können wir diese leider nicht allen online zugänglich machen. Doch eben das ist unser Ziel.
Trotz aller Bemühungen seit nun 15 Jahren und seit 2015 verstärkt haben sich im Rahmen der „Freikäufer“-Kampagne der L-IZ.de nicht genügend Abonnenten gefunden, welche lokalen/regionalen Journalismus und somit auch diese aufwendig vor Ort und meist bei Privatpersonen, Angehörigen, Vereinen, Behörden und in Rechtstexten sowie Statistiken recherchierten Geschichten finanziell unterstützen und ein Freikäufer-Abonnement abschließen (zur Abonnentenseite).
Wir bitten demnach darum, uns weiterhin bei der Aufrechterhaltung und den Ausbau unserer Arbeit zu unterstützen.
Vielen Dank dafür und in der Hoffnung, dass unser Modell, bei Erreichen von 1.500 Abonnenten oder Abonnentenvereinigungen (ein Zugang/Login ist von mehreren Menschen nutzbar) zu 99 Euro jährlich (8,25 Euro im Monat) allen Lesern frei verfügbare Texte zu präsentieren, aufgehen wird. Von diesem Ziel trennen uns aktuell 350 Abonnenten.
Alle Artikel & Erklärungen zur Aktion „Freikäufer“
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
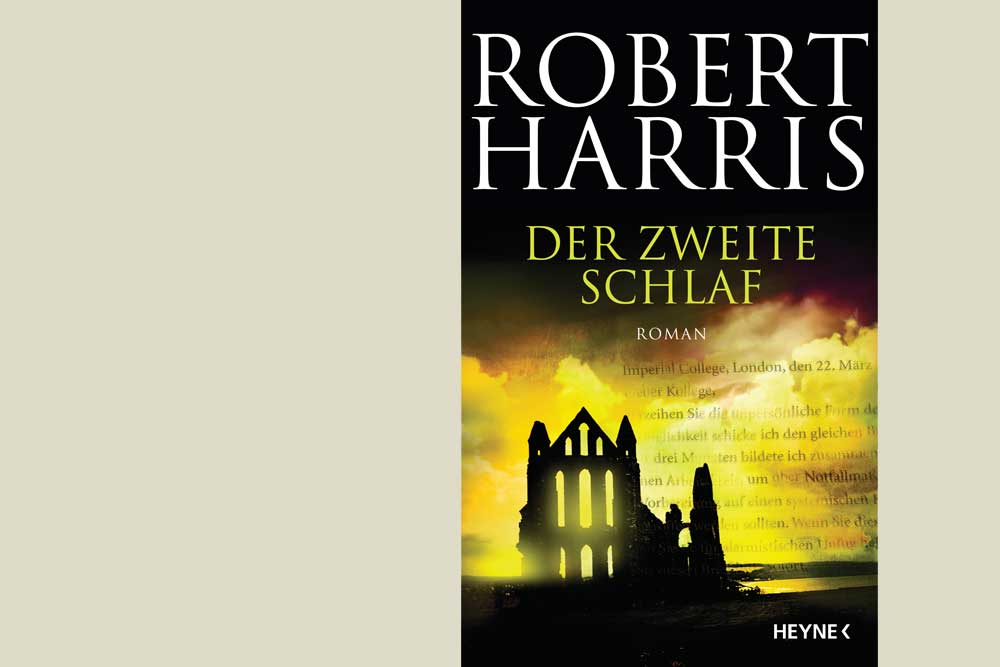












Keine Kommentare bisher