Es gibt Bücher, die sind auch drei Jahre nach Erscheinen so aktuell wie damals. So geht's auch John Lanchesters dickem London-Roman "Kapital", 2012 in erster Auflage auch auf deutsch erschienen, mittlerweile in der 12. Auflage verfügbar. Längst hat Klett-Cotta noch ganz andere Titel von Lanchester im Programm. Aber warum nicht noch einmal auf Anfang zurück?
Denn dieser 680 Seiten dicke Gesellschaftsroman war der belletristische Versuch des langjährigen Lektors und Kolumnisten John Lanchester, das Echo der Finanzkrise der Jahre 2007 / 2008 einzufangen. Denn auch wenn die Subprime-Krise ihren Ausgang in den USA nahm, wirkte der Finanzplatz London wie ein Verstärker und Brandbeschleuniger, gerieten auch hier reihenweise Banken in die Strudel der Krise. Wobei das schon falsch formuliert ist. Denn dass Banken wie die im Roman geschilderte Pinker Lloyd ins Trudeln gerieten, hatte ja vor allem damit zu tun, dass sie in den wilden Jahren zuvor das aufgeblasen hatten, was man heute so leger das Investment nennt, obwohl es eher hochgezüchtete Wettbüros auf allerlei strukturierte Papiere, Kurse und Derivate waren. Und sind. Da ist niemand blindlings irgendwo hineingestolpert. Hier waren die “winner” alle unter sich und haben Frettchenjagd veranstaltet. Wie schwer sich die international agierenden Banken bis heute tun, das klassische Bankgeschäft wieder strikt von den Investmentabteilungen zu trennen, zeigt ja bis in die Gegenwart die Deutsche Bank.
Man wird in diesem Buch viele Kapitel finden, die erinnern verblüffend an die Befunde von Joris Luyendijk in seinem erst in diesem Jahr erschienenen Sachbuch „Unter Bankern. Eine Spezies wird besichtigt”. Luyendijk hatte in einer aufwendigen Recherche hunderte Mitarbeiter der Londoner Finanzwelt befragt, wie das eigentlich war vor, während und nach dem großen Krach – und wie es dazu kommen konnte.
Roger Yount in Lanchesters Buch könnte durchaus einer dieser Finanzexperten gewesen sein, auch wenn er erst einmal nur eine fiktive Figur ist, quasi die Idealgestalt eines überbezahlten Abteilungsleiters in einer überbezahlten Finanzblase, die im Dezember 2007, mit dem dieser Roman beginnt, längst das Herz Londons ist. Hier verdient England sein Geld. Und die horrenden Gehälter im Finanzsektor plus die ausufernden Boni sorgen dafür, dass die Immobilienpreise in London astronomische Höhen erreichen.
Die Pepys Road, in der Lanchester seinen Roman handeln lässt, ist eine Art Modell dieses vom neuen Reichtum völlig verzerrten England, das die einen mit Millionen überschüttet und die anderen behandelt wie den letzten Dreck. Hier jobbt der Pole Zbigniew, der mit den vielen kleinen Umbau- und Verschönerungsaufträgen der Hausbesitzer ein Einkommen hat und für seine Rückkehr nach Polen spart. Hier findet die Ungarin Matya einen Job als Kindermädchen – natürlich bei den Younts, denn Rogers Ehefrau Arabella hält die Kinderbetreuung für unter ihrer Würde, verbringt die Tage lieber mit Shoppen, Barbesuchen mit ihrer besten Freundin oder tagelangen Ausflügen in Wellnesshotels. Liebe kann das nicht sein, was Roger und Arabella zusammenschweißt. Man lernt die beiden sehr gut kennen in diesem Roman. Aber lernt man sie so gut kennen wie die Heldinnen und Helden bei Balzac?
Englischer Balzac?
Immerhin hat der Verlag auf dem Cover eine entsprechende Buchkritik zitiert, die Lanchester zum “englischen Balzac” stilisiert.
Man darf sich wundern. Oder auch nicht. Augenscheinlich sind viele Rezensenten nicht mal mehr in der Weltliteratur sattelfest. Mit Balzacs Arbeitsweise hat Lanchesters Roman nichts zu tun. Gar nichts. Es wäre zwar herrlich, wenn es heute noch oder wieder einen Romancier mit der Begabung Balzacs gäbe, der die moderne Gesellschaft und die Leute, die sich dafür halten, so gründlich seziert. Aber Lanchester hatte nicht mal die Absicht, das zu tun.
Und für seine Leser hat er sogar extra ein Signal gesetzt, als er justament die Pepys Road zum Schauplatz seine Buches gemacht hat. Die Tagebücher des Samuel Pepys gelten heute als eine der reichsten Quellen zum gesellschaftlichen Leben im England des 17. Jahrhunderts. Und der Satz, den auch der deutsche Wikipedia-Artikel zu Pepys besonders erwähnenswert findet, den hätte auch Lanchester als Motto vor sein Buch stellen können: “Die meisten Männer, die es in der Welt zu etwas bringen, vergessen das Vergnügen während der Zeit, in der sie ihr Vermögen machen. Sie warten, bis sie es geschafft haben, und dann ist es zu spät, sich daran zu erfreuen.“
Das ist zum Beispiel Rogers Problem, in den ersten 80 Kapiteln des Buches eigentlich der typische Banker und arrogante Schnösel, der die eitlen Rollenspiele, die sein Job mit sich bringt, auch noch toll findet. Der auch noch ahnt, dass seinem smarten Stellvertreter Mark nicht zu trauen ist. Es gibt so einige Gestalten im Buch, die scheinen direkt Thackerays “Jahrmarkt der Eitelkeiten” entsprungen – von Gier und Neid geplagte Zeitgenossen, die nicht erst durch die Finanzblase der Nuller Jahre nach oben gespült wurden und in diversen Banken die Chance bekamen, mit Summen zu zocken, die am Ende ganze Staaten an den Rand der Pleite bringen sollten.
Mit Geld Geld machen
Die Geburtsstunde der Londoner City und aller ihrer Ausuferungen liegt in der Thatcherära, in der “Liberalisierung” zum Schlagwort für eine (Wirtschafts-)Politik wurde, die alles, was irgendwie an störenden Kontrollen und Verboten da war, gründlich abgebaut hat. Mit Geld Geld machen, das wurde die große Devise, die nicht nur haufenweise Mathematiker und Informatiker in die Invest-Abteilungen der Banken spülte, weil diese Leute in der Lage waren, die Algorithmen zu entwickeln, mit denen im Millisekundentempo auf elektronischem Weg gekauft und verkauft und gewettet werden konnte. Die Rogers wussten am Ende tatsächlich nicht mehr, mit welchen gewaltigen Hebeln sie da in den Märkten unterwegs waren – und wie sie genau mit den Unsicherheiten gigantische Geschäfte machten, die sich dann mit der Subprime-Krise und der Lehmanns-Pleite zum Sprengstoff für die gesamte westliche Finanzwelt entwickelten.
Mark ist nicht der einzige dunkle Held in dieser Geschichte, der von Neid zerfressen ist und mit üblen Methoden versucht, sich sein Stück vom Ruhm zu holen. Wenn Lanchesters Roman eine Analyse ist, dann eine indirekte. Er zeigt in vielen kleinen Szenen, wie sich eine Gesellschaft verändert, wenn nur noch das Geld zählt und die Werte einer solidarischen Gesellschaft mit Füßen getreten werden. Etwas, was ausgerechnet die aus Simbabwe emigrierte Quentina erfahren muss, die in Großbritannien kein Aufenthaltsrecht bekommt, weil der zuständige Richter meint, sie ohne Federlesen in das von einem Diktator wie Mugabe regierte Land zurückschicken zu können, obwohl ihr dort der Tod droht. Am Ende landet sie in einem Abschiebelager, wie es sich mittlerweile auch Politiker in Sachsen erträumen, einer Art Vorhölle, die es in England schon gibt und aus der es – wenn kein Wunder geschieht – nur einen Weg gibt: direkt in die Hölle zurück, aus der all die hier abgeschobenen Menschen geflohen sind.
Vereisung der Gesellschaft
Man könnte hier eine Klammer öffnen und fragen: Wie viel hat eigentlich die gnadenlose Abschiebepraxis der heutigen europäischen Staaten mit der Vereisung der Gesellschaft zu tun, die mit dem Aufkommen des Neoliberalismus unter Margaret Thatcher ein Land nach dem anderen erfasst hat? In England kann man die Folgen so einer Politik, die auch staatliche Aufgaben wie die Verkehrskontrolle oder die Flüchtlingsunterbringung privatisiert hat, schon in voller Ausprägung erleben.
Verschärft durch einen Aspekt, den man so gern als “Kampf gegen den Terror” bezeichnet. In diesem Fall ist es Shahid, der in die Mühlen der britischen Terrorbekämpfung gerät, weil er dummerweise einen alten Kumpel aus dem Tschetschenien-Krieg bei sich beherbergt hat und der sich nicht nur als mieser Gast erwiesen hat, sondern auch als Teil eines Netzwerks von wohl mittlerweile Berufsterroristen, die möglicherweise den Euro-Tunnel in die Luft sprengen wollen. Shahid sieht sich schon auf direktem Weg nach Guantanamo. Doch richtig Glück hat er, weil gerade die strenge und nie zufriedene Frau Kamal ihre Kinder in London besucht, so eine richtige Familienmutter aus Pakistan, immer kritisch und unzufrieden und eigentlich keine zwei Wochen auszuhalten. Aber sie beweist jene Beharrlichkeit, die ihre Kinder am Ende staunen lässt, weil darin all ihre Liebe versteckt ist.
Natürlich gibt es bei Lanchester diese herrlichen Stellen, die den Leser trösten, weil sich die Protagonisten noch als Menschen erweisen und eben nicht als nur noch von Geld und Konsum besessene Monstren. Dass es in diesem Roman eher die kleinen Leute sind – wie die Kamals mit ihrem kleinen Eckladen, Quentina, die sich einen Job als Politesse gesucht hat, obwohl sie als Geduldete eigentlich nicht arbeiten darf, oder Petunia, die 82-jährige Frau, die ihr ganzes Leben in der Pepys Road zugebracht hat und ganz am Ende noch einmal mitten im Strudel der Ereignisse steht und sich wundert, dass man 82 Jahre alt werden kann, ehe man wirklich ernsthaft an das Ende des Lebens zu denken beginnt – das überrascht eigentlich nicht.
Und die ganze Zeit geistert einem dieser falsch platzierte Balzac durch den Kopf. Nicht einmal die Erzählweise ähnelt dem großen französischen Sittenschilderer. Wer geistesverwandte Autoren sucht, findet sie eher in den ebenso zwischen Sarkasmus, Verständnis und Trauer pendelnden Autoren Julian Barnes und Roddy Doyle. Auch bei ihnen findet sich diese mitreißende Liebe zu den Düpierten, Gestrauchelten und Aussortierten und ihren manchmal klugen, manchmal verzweifelten Versuchen, sich aus den Tiefen der Armut zu befreien. Wenn man sich an einen Klassiker erinnert fühlen will, dann an einen englischen: Charles Dickens. Die Grundthemen, die John Lanchester hier verwebt, sind in verschiedener Weise auch als Grundmuster in der ernstzunehmenden Belletristik anderer Autoren von den Inseln anzutreffen. Und man spürt, wie sie es alle satt haben, dass die aalglatten Sunnyboys aus den Zockerbuden die Welt verbiegen, die Reichtümer der Gesellschaft an sich raffen und hinterher nichts, wirklich nichts Gescheites damit anzufangen wissen.
“Wir wollen was ihr habt”
Und das greift Lanchester auch auf, indem er die Bewohner der Pepys Road mit einer seltsam anonymen Aktion erschreckt, bei der Postkarten, DVDs und ein Internet-Blog fordern “Wir wollen was ihr habt”. Ist das noch Kunst oder reißt hier der gesellschaftliche Friede endgültig auseinander? Sind das Drohungen oder ist es nur ein politisches Statement?
Nach 680 Seiten weiß es der Leser. Er hat eine Menge Menschen kennengelernt, ihre Sorgen und Nöte geteilt, mitgelitten mit einem jungen begabten Fußballspieler aus Afrika, der bei einem Spitzenclub der Premier League seine Chance zum großen Durchbruch bekommt, Verständnis entwickelt für einen von Routine geplagten Polizisten, der genau weiß, dass Kriminelle irgendwann immer einen Fehler machen, Zbigniews Liebesleben kennengelernt – aber auch all seine Skrupel dabei. Er hat mit Petunias Tochter Mary erlebt, wie schwer ein Abschied sein kann.
Und dann bleibt nur noch der Titel übrig, der so tut, als hätte Lanchester wirklich vorgehabt, das große Buch zur Finanzkrise zu schreiben.
Das Problem ist: Das Wort Capital – so der englische Titel – ist doppeldeutig. Es bedeutet eben nicht nur Kapital, es bedeutet auch Hauptstadt. Und das Buch liest sich so, als hätte Lanchester die zweite Bedeutung immer im Blick gehabt. Denn mit seiner Pepys Road beschreibt er einen winzigen, aber typischen Ausschnitt der riesigen Kapitale Großbritanniens, die in einigen Passagen des Buches sogar mit immer wieder neuer Faszination beschrieben wird, letztlich aber unfassbar bleibt, selbst wenn man mit dem “LondonEye” ganz hoch hinaus fährt und die riesige Stadt von oben sieht.
Verantwortungsloses Leben auf der Sonnenseite
Im Grunde also ein durchwachsenes London-Buch. Aber die Londoner City war nun einmal auch mitten im Orkan, als 2008 die Finanzblase platzte. Etwas, was Roger in diesem Buch so lange ignoriert, bis er eines Tages aus heiterem Himmel gefeuert wird und von heute auf morgen gezwungen ist, sein Leben völlig zu überdenken. Am Ende denkt man über diesen Roger doch ein bisschen anders als in den ersten Kapiteln des Buches. Und man ahnt auch ein wenig, wie verlockend für viele Menschen das verantwortungslose Leben auf der Sonnenseite einer von Gier und Konsumrausch getriebenen Gesellschaft sein kann. Einer Sonnenseite, auf der man über Konsequenzen und Verantwortung nicht mehr nachdenken muss.
Doch was passiert mit einer Gesellschaft, die so eine geldgefütterte Verantwortungslosigkeit zum Erstrebenswertesten macht, was es auf dem Markt zu haben gibt?
Eine wichtige Frage, die natürlich stehen bleibt. Ungelöst. Auch bei Lanchester. Zumindest seinem Roger gibt er eine Chance und lässt ihn am Ende über die Möglichkeit, sich selbst zu ändern, nachdenken. Aber was nutzt das, wenn sich die Gesellschaft nicht ändert und wieder lernt, Menschen wie Menschen zu behandeln und nicht wie lästige Schmarotzer, als störende Kostenfaktoren in einem System, das am liebsten alle Kosten wegreformieren oder gleich ganz privatisieren würde? Das geht weit über das Symptom Finanzkrise hinaus. Die Krankheit sitzt viel tiefer.
Und Lanchester beschreibt in einem bunten, zuweilen faszinierenden, manchmal bedrückenden Kaleidoskop, wie krank die Kapitale eigentlich schon sind.
Was er in andren Büchern dann sogar ganz sachlich analysiert. Wie etwa in dem ebenfalls bei Klett-Cott erschienenen “Warum jeder jedem etwas schuldet und keiner jemals etwas zurückzahlt”. Nur so als Tipp am Rand, für alle, die die Welt nicht nur in großen Romanen suchen.
John Lanchester “Kapital“, Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2012, 24,95 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
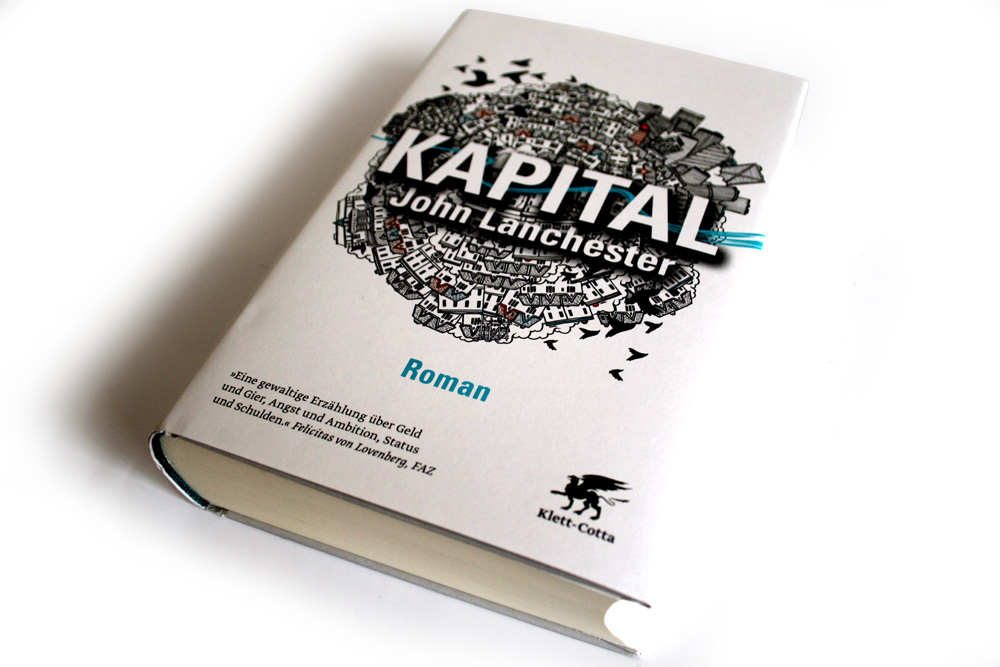









Keine Kommentare bisher