Warum die beiden Journalisten Lars-Broder Keil und Sven Kellerhoff ihr Buch „Lob der Revolution“ genannt haben, das erklären sie im Nachwort. Und sie haben recht. Aber vorher geht es auf 240 dichtgepackten Seiten auf einer furiosen Reise durch diesen Herbst 1918 und das halbe Jahr 1919. Der Bogen spannt sich also deutlich weiter als in Lothar Machtans „Kaisersturz“. Denn am 9. November 1918 war noch gar nicht alles zu Ende. Im Gegenteil: Da fing es erst so richtig an.
Und das Faszinierende ist: Die beiden gehen tatsächlich wie Zeithistoriker an den Stoff, tauchen ein ins Tagesgeschehen, gehen also auf die Ebene, auf der alle ihre Heldinnen und Helden damals tatsächlich agierten.
Denn viele promovierte Historiker machen einen entscheidenden Fehler: Sie „erklären“ Geschichte aus ihren Folgen, geben ihr also nachträglich einen Sinn. Das ist zwar menschlich – aber falsch. Denn so entsteht erst der fatale Eindruck, dass Geschichte einen „Sinn“ hat – und der Sinn sind ausgerechnet die paradiesischen Zustände, in denen wir gerade leben.
Journalisten – wenn sie denn wirklich journalistisch denken und arbeiten – wissen, dass für so einen allumfassenden Sinn die Motive und Handlungszwänge der Menschen viel zu komplex sind. Idealisten träumen davon, dass sie Geschichte in eine bestimmte Richtung treiben können. Oft sind sie so besessen vom „Sieg der Geschichte“, dass sie den Blick für die Wirklichkeit und die tatsächlichen Kräfteverhältnisse und die Wünsche der Menschen verlieren.
Das ist die Tragik einer kleinen Gruppe von Menschen, die in dieser ersten wirklich geglückten Revolution der Deutschen eine zutiefst kontroverse Rolle spielen.
Es sind nicht nur Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die schon am 10. November begannen, die Revolution weitertreiben zu wollen und einen blutigen Aufstand zu provozieren. Was dann zu den Schießereien im Zeitungsviertel und dem ersten Einsatz der Freikorps führte.
Immerhin beide auch heute noch Heldengestalten und Märtyrer – nicht nur bei den Linken. Aber vielleicht wäre es wirklich gut, wenn auch Linke das Buch aufmerksam lesen und auch diesen Märtyrerkult beenden. Denn er überschattet die Erinnerung an diese Revolution bis heute.
Sogar noch mehr als die „Dolchstoßlegende“ der Rechtsextremen, die am Ende des Buches auch noch eine Rolle spielt, wenn Keil und Kellerhoff den alten Feldmarschall Hindenburg in den ersten Untersuchungsausschuss des demokratisch gewählten Reichstags stolzieren lassen und dort genau jene Schrift vortragen lassen, die ab da zur Argumentationsschiene der Rechten werden sollte.
Und der Boden war in diesem Herbst 1919 schon fruchtbar, denn im Sommer hatte die Delegation der nun endlich demokratisch legitimierten Regierung in Paris die Friedensbedingungen der Alliierten entgegennehmen müssen – Bedingungen, die selbst von friedliebenden Menschen wie Käthe Kollwitz und Thomas Mann als hart und erniedrigend empfunden wurden.
Man muss kurz aus dem Buch aussteigen und sich mit der Rolle des französischen Präsidenten Georges Clemenceau beschäftigen, der für diese harte Linie der Alliierten stand und damit den Wunsch verband, Deutschland für alle Zeiten so zu schwächen, dass es nie wieder einen Krieg gegen Frankreich wagen würde.
Eine Politik, für die er auch in Frankreich bald umstritten sein sollte, denn damit erreichte er tatsächlich das Gegenteil. Es ist so ein kleiner Moment am Rande, der einem bewusst macht, wie sehr Politik von ganz persönlichen Gefühlen geleitet wird, wie Rache und Stolz das rationale Denken übertönen und zu Entscheidungen führen, von denen man eigentlich schon vorher weiß, dass sie neue, schlimme Folgen nach sich ziehen werden.
Clemenceau kommt nun freilich unter den vielen Zeitzeugen, die die beiden Journalisten direkt zitieren, nicht vor. Das würde das Buch sprengen und tatsächlich ein gewaltiges Epos nötig machen, das zeigt, wie vielstimmig und facettenreich auch die Außensicht auf den ersten Weltkrieg und Deutschland war. Auch hier hätte nichts zu genau den Folgen treiben müssen, die dann zu den Dramen in den 1930er Jahren führten.
Politik ist auch ganz offensichtlich immer ein „Learning by doing“. Und wahrscheinlich täten Länder gut, die Politiker mit festgefahrenen Vorurteilen in Krisensituationen lieber in den Ruhestand zu schicken. Sie halten ihre Sicht auf das Ganze für die einzig richtige – wofür ja in der Heeresleitung der Deutschen auch Hindenburg und Ludendorff standen, die beiden Generäle, die den Krieg nicht beenden wollten und am Ende auch noch sämtliche Chancen auf einen gerechten Frieden verspielten.
Beiden ist in diesem Buch eigentlich nur diese letzte Szene vorm Untersuchungsausschuss gewidmet. Denn ein Jahr lang spielten beide praktisch keine Rolle mehr in der deutschen Politik. Hindenburg war der oberste Feldherr einer Armee, die keinen Krieg mehr führen konnte, deren Soldaten fast alle kriegsmüde waren und auch müde der alten Feudalzeiten.
Überall im Land, wo sie zurückkehrten, mischten sie die Verhältnisse auf, gründeten Arbeiter- und Soldatenräte, besetzten Rathäuser und nahmen den Umbruch der Machtverhältnisse selbst in die Hand. Meist sehr dilettantisch. Deswegen ging das oft genug schief. Und deshalb wurde in der Frühzeit vor allem die USPD zum neuen Partner dieser Räte.
Wobei gerade die Vielstimmigkeit, die Keil und Kellerhoff wachrufen, zeigt, wie sehr gerade diese die Revolution vorantreibende USPD hin- und hergerissen war zwischen der radikalen Aktion, wie sie ihre Splittergruppe „Spartakus“ vertrat, und rationalem Regierungshandeln, wo sie sich mit ihrer alten Partei, der SPD, traf. Die beiden Autoren blenden immer wieder hinein in die unterschiedlichen Ereignisorte des deutschen Reiches, machen deutlich, wie sehr der Wunsch nach einem Umsturz der Verhältnisse mit dem noch viel größeren Wunsch der Bevölkerung nach geordneten Verhältnissen in Konflikt geriet.
Was schon die ersten freien Wahlen im Januar 1919 zeigten, wo nicht die USPD die Mehrheit errang, sondern die auf Ausgleich bedachte SPD von Ebert und Scheidemann. Die dann auch das Bündnis mit den größeren bürgerlichen Parteien suchte.
Was natürlich – aus radikaler linker Perspektive – als „Verrat“ empfunden wurde. Ein ganzes Kapitel ist am Ende mit „Verrat“ überschrieben. Und der Spruch ist ja heute noch gängig: „Wer hat uns verraten …“
Wer in Extremen denkt, vermag natürlich das, was dann in Weimar geschah, nicht zu würdigen. Denn dort tagte ja dann das erste frei gewählte Parlament der Deutschen und rang ein paar entscheidende Monate lang um die erste demokratische Verfassung für diese Republik. Nach Weimar war die Nationalversammlung ausgewichen, weil die in Berlin geschürten Unruhen den interimistisch regierenden SPD-Männern als nicht beherrschbar erschienen.
Nicht ahnend, dass es im Frühjahr noch mehrere solcher Radikalisierungsversuche geben würde. Die Münchner Räterepublik ist dabei die bekannteste. Aber auch sie wird oft überhöht und glorifiziert. Was die beiden Autoren auch hier mit vielstimmigen Äußerungen von bekannten und nicht so bekannten Akteuren sichtbar machen – auch der Stimme des dann so sinnlos ermordeten Kurt Eisner. Hier begegnen wir aber auch einem Erich Mühsam und einem Ernst Toller und einem Gefreiten Hitler, der zu dem Zeitpunkt immer noch nicht wusste, wo er hingehörte. Während andernorts ein Marineoffizier namens Bötticher, der sich als Dichter Joachim Ringelnatz nannte, genauso gut wusste, wo er hingehörte wie der ehemalige Soldat Erich Maria Remarque.
Es ist diese Vielstimmigkeit, die sichtbar macht, dass es den Menschen damals nicht viel anders erging als uns heute. Einige lebten auch damals in ihrer politisch eingefärbten Filterblase und sahen deshalb nicht, dass nur eine Minderheit ihre Ansichten teilte – was auf Luxemburg und Liebknecht natürlich zutraf. Andere tauchen hier als weitsichtige Vertreter der jungen Demokratie auf, auch wenn wir schon wissen, dass sie diese Tage nicht lange überleben werden – der Konzernmanager Walter Rathenau etwa oder der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger.
Man sieht Adenauer als Kölner OBM gegen die Separationsbestrebungen im Rheinland agieren und Theodor Heuss um sein erstes Reichstagsmandat kämpfen – das ihm freilich noch verwehrt ist. Aber man schaut auch in das Ringen in der Weimarer Nationalversammlung, wo hart um die von Hugo Preuß entworfene Verfassung gerungen wird.
Obwohl dafür eigentlich keine Ruhe ist – die Ebert-Regierung muss ja parallel fortwährend Probleme lösen, die Versorgung sichern, die Soldaten wieder in die Wirtschaft integrieren und immer neue Brandherde bekämpfen. Selbst der Blick auf Gustav Noske, den Kriegsminister der Regierung, ändert sich, obwohl man im Rückblick weiß, wie verheerend sein Zugriff auf die Freikorps-Truppen war.
Nur: Es standen ihm überhaupt keine anderen Truppen zur Verfügung, mit denen er die vielen Aufstände und Ausstände im Reich hätte bekämpfen können. Und dass die Offiziere und Freiwilligen in diesen Korps ganz bestimmt keine überzeugten Demokraten waren, wusste Noske, der ja mit dem Spruch in die Geschichtsbücher einging: „Einer muss der Bluthund sein.“
Wie gesagt: Die Perspektive ändert sich, wenn man diese Aktionen von der Warte der noch jungen Republik her sieht, die nun wirklich für alle, wirklich alle Akteure Neuland war. Und zu Recht staunen die Autoren, wie ernsthaft die zentral Beteiligten darangingen, diese Republik auf ein Verfassungsfundament zu stellen und zum Funktionieren zu bringen. Und das bis zum Sommer 1919 immer in der Hoffnung, sie würden von den Alliierten Kapitulationsbedingen bekommen, die die junge Republik nicht überfordern würden.
Gerade Friedrich Ebert verließ sich auf den 14-Punkte-Plan des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Und wurde dann bitter enttäuscht – so wie der größte Teil von Parlament und Regierung. Man schaut also auch zu, wie diese demokratisch gewählten Abgeordneten in einen sauren Apfel beißen müssen, obwohl sie ja für die Erfüllung der zentralsten Forderung von Wilson standen: die Entmachtung des Kaisers und die Schaffung einer demokratisch legitimierten Regierung.
Einer Regierung, die natürlich, als die harten, von Clemenceau formulierten Bedingungen bekannt wurden, die volle Wucht von Wut und Enttäuschung abbekam. Womit man schon an einem jener Punkte ist, die sich in der Geschichtsschreibung so lange gehalten haben. Denn dass die Deutschen so überhaupt keinen Stolz auf ihre Revolution haben, hat ja auch mit der vielfach gestörten Erinnerung an diese ersten Tage zu tun. Erst forciert durch die Nationalisten, die schon frühzeitig enormen Widerhall in den bürgerlich-konservativen Kreisen fanden und die Weimarer Republik (das war damals ein Schimpfwort!) verachteten und bekämpften. Und dann noch viel länger gefolgt von der Interpretation der Kommunisten, die das Handeln der Ebert-Scheidemann-Regierung als Verrat an der Revolution brandmarkten.
Sodass heute kaum noch bewusst ist, dass diese scheinbar so ruhmlose und in blutige Aufstände verstrickte Revolution in Wirklichkeit ein Erfolg war. Trotz alledem, um mal den letzten großen Aufschrei von Karl Liebknecht zu zitieren, der glaubte, die bolschewistische Revolution auch nach Deutschland tragen zu können.
Und es ist nicht der einzige Punkt, an dem man sich fragt: Was wäre eigentlich gewesen, wenn Liebknecht und Luxemburg ihre wiedergewonnene Freiheit nicht genutzt hätten, die Ebert-Regierung anzugreifen, sondern in der USPD geblieben wären?
Was wäre gewesen, wenn sich der Untersuchungsausschuss die Frechheit Hindenburgs nicht hätte bieten lassen und den Legendenerfinder mit Fragen wirklich gegrillt hätte? Was wäre gewesen, wenn Clemenceau das Angebot der deutschen Delegation angenommen hätte und dem besiegten Deutschland erträgliche Kapitulationsbedingungen zugestanden hätte?
Alles Fragen, die niemand beantworten kann. Die aber auch zeigen, unter welchen Handlungszwängen die neue Regierung stand. Und wie schwer es gerade überzeugten Revolutionären (auch in Leipzig) fiel, jetzt wieder Kompromisse mit den Bürgerlichen machen zu müssen. Aber möglicherweise war gerade dieser nüchterne Friedrich Ebert derjenige, der am klarsten sah, dass genau diese demokratisch verfasste Republik das Beste war, was diese Revolution erreichen konnte.
Aber selbst das scheint im Nachhinein zu verschwinden, wie Keil und Kellerhoff feststellen. Die Verfechter der Demokratie wurden mit jeder Krise in den nächsten Jahren immer weniger hörbar, während die Radikalen begannen, den öffentlichen Diskurs zu überschreien.
Und das ist nicht die einzige Parallele, die die beiden Autoren zur Gegenwart sehen. Aber es ist eine wichtige. Denn eine Demokratie geht nicht einfach so verloren. Sie wird gezielt angegriffen – und zwar laut, dreist und mit Lügen. „Fake news“. Wer am lautesten schreit, dominiert die Berichterstattung und sorgt dafür, dass Legenden am Ende wieder in eine irrationale Politik führen.
Es sei also wieder hochaktuell, dass wir uns dieser so schwer verleumdeten Revolution erinnern und sie feiern, wie es sich gehört, stellen die beiden Autoren fest. Ganz am Ende, wenn sie im Grunde das eine Jahr zwischen Herbst 1918 und Herbst 1919 in einer rasenden Berichterstattung absolviert haben, die an das Stakkato moderner Politik-Reportagen erinnert. Mit vielen, vielen originalen Stimmen von Beteiligten und von Beobachtern – etwa dem begnadeten Leipziger Philologen Victor Klemperer, den es ausgerechnet in der Zeit der Räterepublik an die Münchner Universität verschlagen hat. Ein wirklich unbestechlicher Augenzeuge.
Und gerade weil so viele Persönlichkeiten ins Bild kommen, die bei den üblichen Revolutions-Komprimaten nie zu Wort kommen, hätte man sich eigentlich am Ende auch noch über ein Personenregister gefreut. Die riesige Literaturliste, die die beiden Autoren durchgearbeitet haben, ist ja da.
Und was ihnen gerade durch das journalistische Stakkato gelingt, ist zu zeigen, dass wir hier ein markantes Kapitel unserer Geschichte sträflichst vernachlässigt haben. Auch weil viele Historiker sich von der Verachtung der Nazis für die „Weimarer Verhältnisse“ haben blenden lassen. Genau der Verachtung, die heute wieder nach Aufmerksamkeit schreit. Und da schaut man in diesen Herbst 2018 und sieht, dass kaum jemand irgendwo ernsthafte Festvorbereitungen getroffen hat. Das ist peinlich. Das hätten sich die Franzosen zu den Jubiläen ihrer Revolution nie und nimmer erlaubt.
Wir sollten feiern. Und wir haben – auch wenn wir heute so gern mit der lädierten SPD und den bürgerlichen Nachfolgeparteien der damaligen Parteien hadern – jede Menge Grund, gerade diese Revolution zu feiern. Das Buch erzählt, was es zu feiern und was es vor allem jetzt wieder zu verteidigen gilt.
Sven Felix Kellerhoff; Lars-Broder Keil Lob der Revolution, WBG Theis, Darmstadt 2018, 24 Euro.
Der Historiker Sven Felix Kellerhoff erzählt die durchaus lehrreiche Geschichte des Hitler-Buches „Mein Kampf“
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
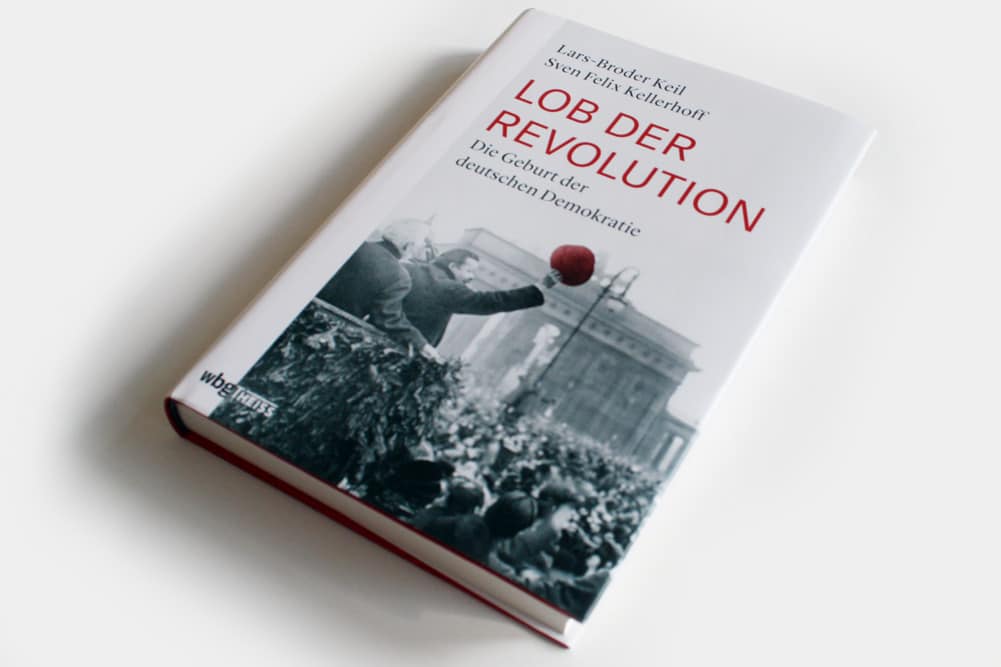












Keine Kommentare bisher