Es gibt Bücher über den Tod, das Sterben und das Abschiednehmen von geliebten Menschen. Meistens muss man ein bisschen danach suchen. Meist sind sie erschütternd, weil Menschen in ihrem Mittelpunkt stehen, deren faszinierende Persönlichkeit man mit diesen Büchern erst entdeckt – und dann endet das so traurig. Aber diese Bücher offenbaren auch eines: Wie sehr wir den Tod aus unserem Leben verdrängt haben. Als gehörte er gar nicht dazu.
Als lebten wir so völlig ziellos vor uns hin, als wäre all das, was uns umgibt, gar nichts wert. Seit dem 19. Jahrhundert, so schreibt C. Juliane Vieregge, ist diese Entwicklung zu beobachten: Damals wurden nicht nur die Friedhöfe vor die Tore der Stadt verlegt, auch die Großfamilien mit ihren drei Generationen unter einem Dach begannen sich aufzulösen. Die neue Wirtschaftsordnung zertrümmerte nicht nur die Familienverbände, sie unterwarf auch jeden Lebensbereich der Verwertbarkeit und der Nützlichkeit.
So weit geht die Autorin, Bloggerin und Online-Journalistin in ihren Einführungen zu den einzelnen Kapiteln ihres Buches nicht. Aber das steckt dahinter. Wir leben nicht mehr mit unseren Eltern in einem Haus. Wir erleben nicht mehr, wie sie alt werden. Oft überrascht uns ihr Tod mitten in einem hektischen Alltag, in dem wir glauben, für persönliche Gespräche, Besuche und Vertrauen keine Zeit und keinen Nerv mehr zu haben. Und hinterher stürzen wir in ein Loch, weil wir zu spät merken, was alles unausgesprochen geblieben ist.
Wenigen gelingt es, so wie der Autorin, noch kurz vor dem Tod dieses Schweigen ihrer Eltern aufzubrechen. Wenigstens ein paar der Fragen anzusprechen, die früher immer unter der Decke geblieben sind. Denn wir sprechen ja nicht nur nicht über den Tod, selbst die Geschichten unserer Eltern sind oft tabu, ihre Gefühle, ihre Liebe, ihre Verletzlichkeiten. Darüber redet man nicht. Aber darauf wollte es Vieregge nicht beruhen lassen. Sie fragte mehrere bekannte Persönlichkeiten an und bat sie, mit ihr über den Tod zu sprechen. Und zwar nicht nur abstrakt, sondern auch über die wichtigsten Menschen, deren Tod sie begleiteten und deren Tod ihr Leben beeinflusste.
18 Persönlichkeiten hat sie in den letzten Jahren getroffen, darunter auch einige in Ostdeutschland, was sie betont. Es ist kein typisch westdeutsches Buch geworden. Das ist ein Glück, denn es zeigt, dass wir da, wo wir Mensch sind, alle gleich sind, alle dieselben Ängste haben, dieselben Verletzlichkeiten und dieselbe Konsequenz. Sterben müssen wir alle. Der Tod gehört zum Leben wie die Angst, die Hoffnung und die Liebe. Und er räumt mit einem Mal mit all dem überflüssigen Schnickschnack auf, von dem wir glaubten, wir müssten ihn unbedingt besitzen.
Was aber bleibt?
Für viele der Befragten natürlich ein Gefühl des späten Beschenktwerdens. Denn die meisten Geschichten erzählen davon, wie das Sterben der geliebten Menschen die Tür geöffnet hat für eine Aussprache, die oft schon Jahrzehnte früher hätte erfolgen können. Auf einmal stehen Kinder ihren Eltern nicht mehr als Kinder gegenüber, die sprachlos hinnehmen, was ihre Eltern sagen und tun. Immerhin ist das eine Rolle, aus der die meisten Menschen ihr Leben lang nie herauskommen. Und so können sie sich ihre Mütter und Väter auch nicht als Suchende vorstellen, als ähnlich Ratlose, als Menschen, die in ihrer Jugend dieselben Irrungen und Wirrungen durchgemacht haben und oft als Erwachsene nur eine anerzogene Rolle spielten.
Was in diesem Buch sehr deutlich wird mit den Eltern der Kriegs- und der frühen Nachkriegsgeneration. Eltern, die so erzogen worden waren, dass sie über Gefühle nicht redeten. Oder die nach den traumatischen Erlebnissen von Krieg und Nachkrieg verhärtet waren, hinter der Gefühlskälte den Kindern gegenüber ihr eigenes Trauma versteckten. Oft steckt hinter der rauen Schale ein Mensch, der mit seiner Ruppigkeit seine Liebe und sein Selbstbewusstsein schützt – so wie der Vater von Boris Palmer, dem das Sterben des Vaters die Gelegenheit gab, den Alten auch in seiner Dünnhäutigkeit kennenzulernen. Und ganz ähnlich erging es Christopher Buchholz mit seinem Vater Horst Buchholz oder Jochen Busse mit seinem Vater Klaus Busse.
Manchmal ist es auch der frühe Tod des Bruders, der den Befragten aufwühlt (so wie bei Dieter Thomas Kuhn), das Sterben der Schwester (wie bei Gisela Getty) oder der nicht fassbare Tod des begabten Sohnes (wie bei Arsène Verny). Gerade wenn junge Menschen sterben, greift etwas in unser Leben ein, das uns wieder bewusst macht, dass es keine Sicherheit gibt, dass es uns jederzeit und überall ereilen kann. Das „memento mori“ steht gleich neben dem „carpe diem“. Denn das Leben, das man vor seinem Sterben nicht gelebt hat, lässt sich nicht nachholen. Die Chance ist vertan. Und man merkt zum bitteren Schluss, dass all die Jagd nach Besitz und Prestige nicht glücklich gemacht hast, weil das Wichtigste fehlte.
Wobei die Gesprächspartner, die C. Juliane Vieregge gefunden hat, natürlich für etwas anderes stehen – sie haben sich ja nicht ohne Grund bereiterklärt, mit ihr über Tod und Leben zu sprechen. Denn der Tod ihrer Nächsten hat sie zum Nachdenken gebracht, hat die Türen geöffnet, hat sie oft mit einer späten, aber auch schmerzlichen Nähe beschenkt, die in unserem von „Wachstum“ gepeitschten Alltag kaum Platz findet. Wir werden so abgestumpft im Jagen nach „Erfolg“, dass wir das Gefühl dafür verlieren, wie reich und wichtig die uns nahen Menschen sind.
Am Ende kommen auch noch ein Onkologe, ein Bestatter und ein Anstaltsarzt zu Wort – Menschen, die sich schon berufsmäßig mit dem Tod beschäftigen müssen. Und auch mit den Ritualen, mit denen wir Abschied nehmen von den Menschen, die uns wichtig waren. Und wichtig bleiben. Das ist das Erstaunlichste an den meisten Geschichten, wie sehr den meisten Befragten bewusst wird in diesem Prozess des Abschiednehmens, dass die geliebten Menschen gar nicht wirklich aus ihrem Leben verschwinden. Denn wir haben sie ja verinnerlicht. Sie sind Teil unserer Erinnerung, unserer Gefühle und unserer Träume. Sie begleiten uns weiter, auch wenn der eine Trauernde diese Nähe meist nur beim Besuch des Unfallortes wiederfindet, andere begegnen den Verstorbenen in Träumen wieder, wieder andere fühlen sie als ständige Begleiter.
Und gerade dann, wenn es gelingt, die Sterbenden wirklich auf ihren letzten Schritten zu begleiten, wird dieses Abschiednehmen auch tröstlich. So wie auch bei Katrin Sass, die über den Tod ihrer Mutter Marga Heiden erzählt, oder bei Monika Ehrhardt-Lakomy, die vom Sterben Reinhard Lakomys erzählt. Wobei natürlich in vielen Erzählungen deutlich wird, wie wichtig es ist, für diese oft schweren Abschiede Rituale zu finden, die einen nicht hilflos dabeistehen lassen. Denn die Trauer droht einen ja in solchen Momenten regelrecht hinwegzuschwemmen.
Doch gerade weil sich die Befragten der Konfrontation stellten, oft auch die Pflege der Sterbenden in den letzten Wochen übernahmen, wurde ihre Begegnung mit dem Tod auch zu einer intensiven Begegnung mit dem Leben. Denn natürlich gehen nicht alle Sterbenden in Verzweiflung oder mit dem Gefühl, ihr Leben völlig verpasst zu haben. Vielen gelingt, wenn sie darüber mit ihren Nächsten sprechen, noch ein versöhnlicher Abschluss. Sie können alte Irrtümer beseitigen, Dinge zum Abschluss bringen, sich mit den Menschen in ihrer Nähe versöhnen. Und manchmal können sie in diesem Moment auch endlich all das sagen, was ihnen ihr Leben lang unmöglich war, sie belastete und stumm machte.
Und manchmal entdecken Eltern und Kinder erst in diesem Moment, wie nah und ähnlich sie sich tatsächlich immer waren. Aber sage man das mal einem Menschen, den man liebt, dass man ihn liebt. Es sind viele berührende Geschichten, die auch zeigen, dass auch die oft genug „aus Film und Fernsehen“ Berühmten genau solche Menschen sind wie wir, vielleicht etwas neugieriger, offener und bereiter, sich auch auf die Begegnung mit dem Unausgesprochenen einzulassen.
Und damit auf das Wesentliche im Leben, dem wir ja oft genug mit unserem Geschäftigsein nur versuchen immerfort auszuweichen, es nicht an uns herankommen lassen wollen, weil es natürlich für die in uns steckende Lust am Leben unmöglich ist zu akzeptieren, dass wir eines Tages einfach wieder herausgerissen werden aus diesem Leben. Das ein Geschenk ist. Gerade der Tod macht deutlich, was für ein wertvolles Geschenk es ist. Und dass wir alle nur eine kurze Zeit da sind, um das zu erleben. Auch mit all den verwirrenden Gefühlen zu den uns nahen Menschen, die im Moment des Sterbens wieder aufbrechen. Auch davor haben wir ja Angst, vor dieser Flut nicht mehr zu bändigender Gefühle. Als würden sie uns völlig wegschwemmen, als wäre danach nichts mehr von uns da.
Auch weil wir glaubten, die geliebten Mitmenschen blieben immer da, wir könnten jederzeit wieder nach Hause fahren, zu ihnen in die Küche gehen und uns trösten lassen, wenn mal wieder was schiefgegangen ist. Mancher wird ja erst mit seinem Erwachsensein konfrontiert, wenn er dem Tod seiner Eltern begegnet.
Es gibt nicht für alle dieselben Antworten, wie sie mit dem Tod von geliebten Menschen umgehen können. Die 18 Befragten geben darauf völlig verschiedene Antworten. Aber auch das gehört dazu. Elementar scheint zu sein, dass man überhaupt eine Form, ein Ritual findet, wie man das Erinnern an die Gestorbenen in seinem Leben unterbringt. Das Ritual kann sehr persönlich und durchaus auch metaphysisch sein. Aber tatsächlich geht es dabei immer um uns, um dieses oft späte Gewahrwerden, wie viel uns ein Mensch im Leben bedeutet und gegeben hat, welchen Reichtum wir seinetwegen in uns tragen. Er ist dann wirklich ein Teil von uns, ein Bestandteil unserer Persönlichkeit. So leben Menschen, die uns geprägt haben, in uns fort. Und nur weil wir diese Beziehung zu ihnen hatten, leiden und trauern wir. Das wird in vielen der Geschichten deutlich. Genauso wie die Erfahrung, dass man das alles leichter bewältigt, wenn man es genau so akzeptiert oder sich dessen überhaupt erst einmal bewusst wird.
Es ist ein stellenweise sehr berührendes Buch und einige der Erzähler und ihre Verstorbenen werden einem auf neue Weise vertraut. Manchmal wird es traurig, oft aber auch ermutigend, weil es einen Teil unseres Lebens zeigt, den wir so gern ausblenden, weil wir uns vor dieser Flut von Gefühlen fürchten. Aber tatsächlich gibt es da gar nichts zu fürchten. Außer dieses dumme Gefühl, mit den Gestorbenen nie über all die Dinge geredet zu haben, die uns reineweg irre machen, weil wir sie immer wissen wollten und sollten. Und dann doch nie gefragt haben aus Angst, wir könnten die Schweigsamen mit unseren Fragen zutiefst verletzen. Obwohl meist das Gegenteil der Fall ist: eine große Nähe. Eine kleine Befreiung. Ein Gefühl, dass man doch nicht aneinander vorbei gelebt hat.
C. Juliane Vieregge Lass uns über den Tod reden, Ch. Links Verlag, Berlin 2019, 22 Euro.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
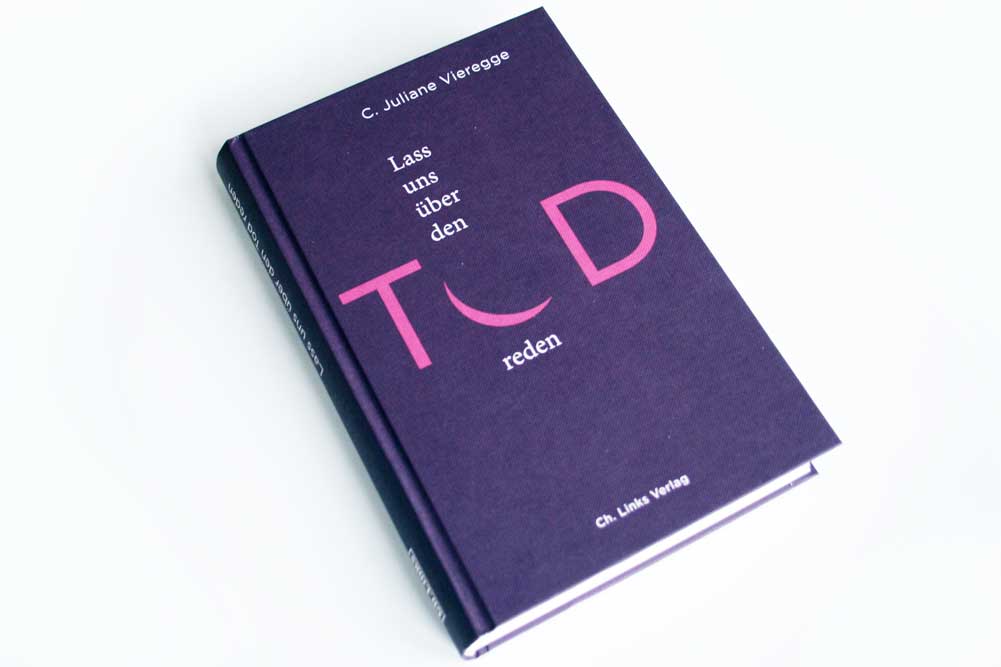










Keine Kommentare bisher