Worum geht es eigentlich im Leben? Ums Lernen? Ums Bravsein? Ums Angepasstsein? Ums Erfolghaben? Scheinbar denken alle so. Auch der Direx an der Schule, an der Iga ihre letzte Chance erhält. Denn wenn sie es hier nicht schafft, muss sie wieder nach Hause, nach Polen zurück. Es könnte eine ganz beliebige Eliteschule sein, irgendwo in Deutschland oder Österreich. Wären da nicht Igas rebellischer Geist und das Gerechtigkeitsempfinden ihrer kleinen Clique.
Denn wo anfangs alles danach aussieht, dass sie auch hier nicht passen wird und schon gar keinen Zugang zu den Schönen und Angehimmelten in ihrer Klasse finden wird, stellt sich bald heraus, wie sehr sie das scheinbar gut Eingespielte an dieser Schule durcheinanderbringt.
Nicht nur im pummeligen Ras findet sie einen weiteren Außenseiter, der bisher so gut wie möglich versucht hat, nicht aufzufallen und den anderen keinen Anlass zum Mobbing zu geben. Sie verwirrt auch die schöne Jess, die bisherige Schönheitskönigin der Klasse, die eigentlich zum schönen Rilke-Rainer gehörte, der mit seinen Kumpels eine Art Dichter-Club pflegt, in dem sie Rilke anhimmeln und selber ziemlich schlechte Gedichte verzapfen.
Und als Iga dann auch noch eine recht verwirrende Beziehung mit Franziska Fellbaum, der Französisch-Lehrerin, die alle Schüler und Schülerinnen anhimmeln, beginnt, scheint die Geschichte ganz und gar abzudriften in eine Beziehungsgeschichte, in der am Ende keiner mehr richtig weiß, wo das rettende Ufer ist.
Der Mut zur Nicht-Anpassung
Auch die Fellbaum nicht, von der man auch erst nach und nach erfährt, wie sehr auch sie eine Außenseiterin ist. Es ist dieser Blick der Autorin, die weiß, wie sich so etwas anfühlt, der durch diesen Roman trägt. Ein viel zu seltener Blick. Die meisten Romanschreiber/-innen wollen selbst viel zu normal sein, viel zu sehr Beobachter. Da geht oft gerade das verloren, was unser Leben wirklich verwirrend macht.
Denn die simple Wahrheit ist, dass wir alle Außenseiter sind und unsere Rollen spielen. Und dass wir meist die Falschen anhimmeln. Und uns viel zu wenig trauen, so wie Iga zu sein. Wobei das oft gar kein Mutwille ist, wenn sie sich kurzerhand entschließt, die Schule zu schwänzen und lieber mit dem Skateboard durch die Gegend fährt.
Also das tut, was so viele nur zu gern tun würden, hätten sie nicht Bammel vor den Strafen und Ausgrenzungen. Oder dem Schulverweis, der ja am Ende tatsächlich über Iga hängt, nachdem sie einen Berg von Fehltagen angesammelt hat. Mit ihren schulischen Leistungen hat das ja alles nichts zu tun. Die sind exzellent.
Aber natürlich geht es in diesem Buch nicht um unser Schulsystem und sein Versagen gerade bei den Kindern und Jugendlichen, die nicht ins eingetaktete Raster passen. Auch wenn von denen nur wenige diesen inneren Stolz haben, wie ihn Iga – auch zum Selbstschutz – an den Tag legt.
Dass sie auf diese Weise auch die zerrüttete Beziehung ihrer Eltern irgendwie überspielt, kann man ja ahnen. Genauso wie der dicke Ras mit seiner scheinbaren Plumpheit überspielt, dass er den Ansprüchen seiner Eltern nicht genügt. Und nicht genügen will.
Nicht alle Kinder, die durch den Rost fallen, fallen deshalb, weil sie Verlierer sind. Manche lernen gerade in diesen unveränderlichen Positionen des Draußen-Seins und Nicht-Akzeptierwerdens, wie man sein eigenes Ding macht, eigene Stärken und Widerstandskraft entwickelt.
Wer bestimmt die eigenen Lebensentscheidungen?
In diesem Fall fasziniert das auch Jess und die Jungen um Rilke-Rainer. Und am Ende die ganze Klasse, die sich dem feigen Versuch des Schhulleiters, Iga einfach wegen ihrer Fehltage von der Schule zu verbannen, widersetzen. Das könnte schon Stoff sein für einen Roman, der über das Wesen und das Entstehen von Widerständigkeit erzählt. Jener Widerständigkeit, ohne die eine offene und freie Gesellschaft nicht funktioniert.
Da ist auch die durchaus verwirrende Beziehung von Iga und der Fellbaum ein Spiel mit den Möglichkeiten der Normüberschreitung. Das am Ende eigentlich daran scheitert, dass die Lehrerin nicht wirklich auszubrechen vermag aus den Normen der Gesellschaft, die wir alle angelernt bekommen haben.
Aber die Leipziger Autorin Kaśka Bryla erzählt die Geschichte ja in der Rückschau. Iga und ihre Freunde haben sich nicht angepasst, sind nicht den leichten Weg gegangen, der sie zu „ordentlichen“ Mitgliedern unserer ach so versnobten Gesellschaft gemacht hätte.
Es wirkt wie eine Konsequenz ihres jugendlichen Aufbegehrens, dass sie sich in einer abgelegenen Urlaubsgegend ein neues Zuhause gesucht haben. Ein Campingplatz ist ihr Lebensmittelpunkt, im Sommer voller Gäste, im Winter völlig vereinsamt. Nur dass es diesmal anders ist, weil ein spät auftauchender Gast länger dableibt, anfangs schweigend und nach und nach durchblicken lassend, dass er um die Geschichte der Freunde weiß.
Denn damals endete alles nicht damit, dass Iga an der Schule bleiben durfte, sondern mit einem Brandanschlag auf eine Polizeiwache, bei dem zwei Polizisten ums Leben kamen.
Nicht ganz schuldlos, denn zuvor hatten sie das schwer misshandelte Mädchen Maja mitten in der Nacht bei Eis und Schnee einfach im Park abgelegt wie ein Stück Abfall. Eine noch Wehrlosere, als es die Jugendlichen selbst sind, die jetzt nicht nur Majas Rettung versuchen, sondern auch auf Rache sinnen. Natürlich beginnt es so. Das vergessen die Arrivierten und Behüteten nur zu gern. Denn sie erleben es ja nicht, dass sie von Polizisten schlecht behandelt werden.
Angepasste haben keine Geschichten zu erzählen
Das ist die Geschichte, die unter dem Eis liegt und über die natürlich nicht geredet werden darf. Über die auch all jene nicht reden, die so immer am Rand leben. Vom Rand aus sieht man mehr. Man muss nicht einmal darüber reden. Es ist einfach da. Was selbst Ras merkt, als er sich die Geschichte zusammenreimt.
Auf einmal merkt man, dass man auch nur aus dieser Position heraus erzählen kann. Wer im Zentrum der heilen und ordentlichen Welt lebt, hat nichts zu erzählen. Denn er sieht und erlebt nichts. Er lebt nicht im Widerspruch mit einer Welt, die gerade den Unangepassten immerfort zeigt, dass sie nicht passen. Und dass sie sich anstrengen können wie sie wollen – sie werden es niemals schaffen, so selbstverständlich dazuzugehören, dass sie aufgehen in der Gewöhnlichkeit.
Es bereitet immer Wunden und Schrammen, wenn man so nicht dazu gehören kann. Und Räume der Unsicherheit und der Entgrenzung sowieso. So wie Igas rasende Fahrt auf dem Skateboard, nachdem es geschehen ist und sie nicht mehr weiß, wohin mit dieser Last an Gefühlen. Als wäre ihre rasende Fahrt der Auslöser für das letzte Drama: Denn eigentlich hatte die Polizeistation leer sein sollen. Und die Fellbaum hätte nicht auftauchen dürfen, das alles zu verhindern.
Und was bleibt nach all den Jahren, als dieser so von sich überzeugte Mann namens Martin auf dem Campingplatz auftaucht? Mit ihm ist etwas Unheilvolles gekommen. Wahrscheinlich weiß er um die Vorgänge von damals. Und so langsam ahnt der Erzähler, dass es ihm und seinen Freunden an den Kragen gehen soll.
Auch das etwas verblüffend Vertrautes, denn diese eisige Rachsucht kennt man nur zu gut. Sie kommt aus den braven Wohnstuben, daher, wo Leute sich einbilden, das Recht zu besitzen und es hinbiegen zu dürfen. Ohne Rücksicht auf Gründe, Ursachen, Leid. Einfach so, weil sie in ihrem eigenen Leben eine riesige Leere haben, die sie füllen müssen.
Was sich dann in dem Bild der ausgeweideten Tiere wiederfindet, die auf einmal im Wald auftauchen. Als wäre da etwas Finsteres und Hungriges im Wald, vor dem sich eigentlich auch dieser Martin fürchten müsste. Aber er fürchtet sich scheinbar nicht, bereitet seine Strafaktion so schweigend und nüchtern vor, als hätte er alles Recht dazu.
Nicht ahnend, dass es in dieser Geschichte nicht auf diese Weise gerecht zugeht. Das ist die Macht der Erzählerin, die sich nicht nach dem Kleingeist der Paragraphen richten muss, die immer auslegbar sind, je nachdem, wer die Macht hat und wer sich irgendwie durchschlagen muss am Rand, immer gefährdet und in Misstrauen gehegt.
Woher kommt die Wut?
Und man bekommt so eine Ahnung, dass das durchaus mehr Menschen betrifft, als man gemeiniglich in den Schlagzeilen findet. Menschen, die sich viel zu oft abfinden und einspannen lassen, obwohl sie eigentlich mit den Igas und Ras’ und Majas fühlen. Mitfühlen, weil sie sich auch immer selbst getroffen und verletzt fühlen.
Und eigentlich auch nicht das genormte und kontrollierte Leben leben wollen, das uns für das einzig erstrebenswerte verkauft und eingeredet wird. Als dürften wir nicht unbändig sein, lebendig mit allen Sinnen und aller Wucht. Auch wenn man oft nicht begreifen kann, warum die Dinge so geschehen sind, wie sie geschehen. Woher kommt die Wut? Woher kommt die Verzweiflung?
Und nicht ganz ohne Grund spielt Kaśka Bryla motivisch mit Guy de Maupassants Geschichte „Der Horla“, der sich ja nicht nur in der brennenden Polizeistation spiegelt, sondert auch in den Ereignissen dann im Wald. Auch wenn sie die Geschichte natürlich anders bespielt.
Denn wie der Horla benehmen sich oft auch all jene Selbstgerechten, die einfach deshalb, weil sie sich für dazugehörend und auserwählt halten, gegen die scheinbar Schwächeren benehmen wie Quälgeister, niederträchtig und unberechenbar. Und das stets in der Maske der Biederen und Gesetzeswahrer.
Was jetzt vielleicht ein bisschen überinterpretiert ist. Vielleicht zu emotional gedeutet nach so einer Geschichte, in der viele Kapitel – nicht nur die, in denen Iga die Heldin ist – so geschrieben wirken, als wären sie mit der Musik der Cranberries im Hintergrund geschrieben – diesem Furioso des Lebenwollens und des Sich-nicht-unterbuttern-Lassens.
Des Sich-nicht-klein-machen-Lassens, das erst den Mut gibt, sich nichts mehr gefallen zu lassen. Und wenn es dann eine wie Iga gibt, bringt das all die schönen normalen Verhältnisse für immer durcheinander. „Erst ist man jemand, weil sie einen sieht. Je weniger sie einen sieht, desto weniger wird man. Bis man Gefahr läuft, ganz zu verschwinden.“
Gesehen werden wollen
Auch das steckt in der Geschichte: dieses Gesehen-werden-Wollen, das ja nicht nur den Erzähler umtreibt. Sondern letztlich alle Figuren, die um Iga kreisen. Denn gerade, weil Iga keine Rolle spielt und nichts anderes darzustellen versucht als sich selbst, wird sie authentisch, kann sie keiner übersehen und jeder muss sich selbst die Frage stellen, ob er oder sie tatsächlich das eigene Leben lebt.
Oder ob das hinter einer Kaffeehaustür wartet, und man verpasst es, übersieht es, wird es nie leben. Selbst dann, wenn es nur ein einfaches Leben in einem Dorf am Rand der Zivilisation ist, wo man sich nicht verstellen muss. Und auch nicht mehr will.
Am Ende holt den Erzähler die Vergangenheit ein. So sieht es aus. Aber tatsächlich war sie nie weg, stets präsent, nicht mal wirklich unter einer Eisdecke verborgen. „Manchmal denke ich dann, dass ich mir das alles nur einbilde. Dass nichts davon wirklich geschehen ist …“
Doch wir sind eben auch, was wir erlebt haben, getan oder nicht getan, verstanden oder nie begriffen. Wir zahlen – wie es der Erzähler ganz zuletzt ausdrückt – den Preis dafür. Denn erst dann wird das unser Leben.
Das stellt die Frage nämlich anders als bei Maupassant: Sind wir unserem Leben und unseren Albträumen ausweglos preisgegeben oder bestimmen wir das Tempo und den Weg selbst? Tauchen also auf aus dem eisigen Wasser und nehmen unser Leben in die Hand. Auch wenn es uns hinauf- und hinunterreißt?
Wirklich aus den Fugen gerät die Geschichte erst, als der Erzähler meint, ein Gefühl komme über ihn „wie der Horla über Ras“. Das ist der Schmerz, der über der Geschichte liegt und nicht heilen wird, weil es das sein wird, was am Ende auch nicht zu erklären ist. Und dennoch bleibt er – als Täter – aufgehoben in der Geschichte, hat seine Strafe verbüßt und die Erinnerungen verdrängt.
Oder hat jeder seinen eigenen Horla, den er nicht loswird, solange er – oder sie – sich nicht trauen, ihr eigenes Leben zu leben? Ohne darauf angewiesen zu sein, dass andere einen bewundern? Eine durchaus elementare Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss.
Kaska Bryla Die Eistaucher, Residenz Verlag, Salzburg/Wien 2022, 24 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
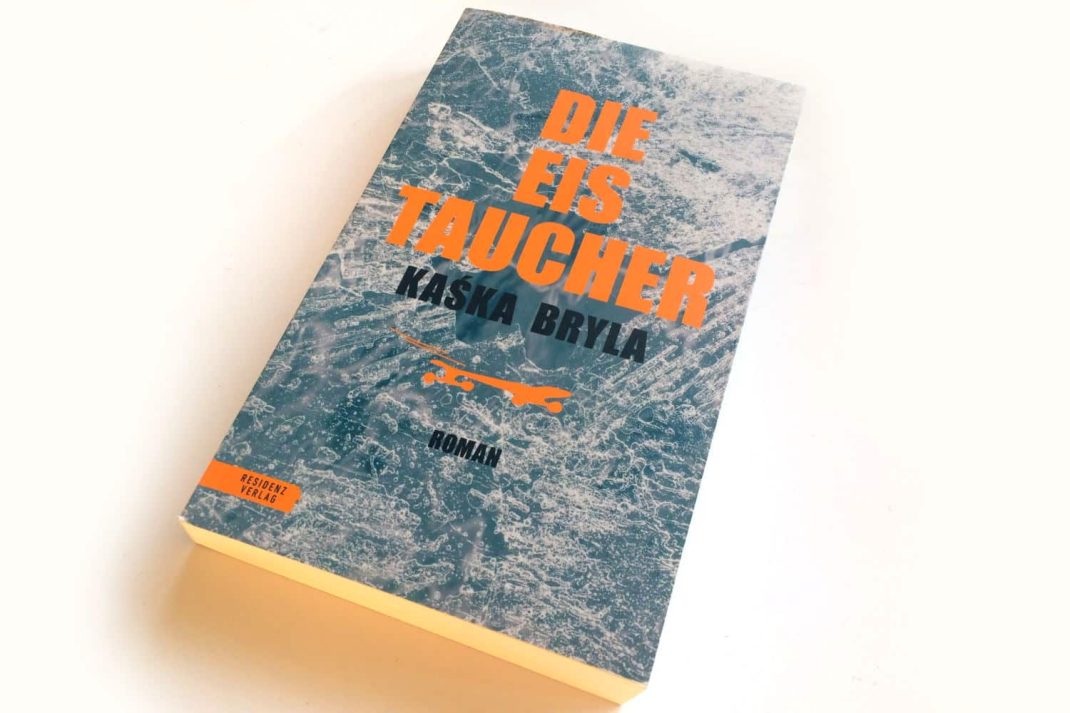












Keine Kommentare bisher