Manchmal erzählen Romane eine Wahrheit, die man eigentlich nicht hören möchte. Eine Wahrheit über eine Gesellschaft, in der sich viele Menschen nicht (mehr) zurechtfinden, sich hilflos und haltlos fühlen und keinen Sinn in ihr Leben bekommen. Nicht jedes Leben wird von selbst zu einem großen Abenteuer. Es ist die andere Seite der Freiheit, die, wo Freiheit zur Einsamkeit wird.
Es ist kein neues Thema. Der Verlag verweist explizit auf David Lynchs Film „Mulholland Drive“ von 2001. Man findet das Motiv der unausweichlichen Lethargie auch bei Simenon – etwa in seinem Afrika-Roman „Tropenkoller“. Man findet es auch in Lars Gustafssons Roman „Der Dekan“ von 2003. Motivisch scheint es in den Kurzgeschichten Raymond Carvers genauso auf wie in den dystopischen Erzählungen J. G. Ballards.
Und wenn ich jetzt so weitermache, lande ich irgendwann bei Dostojewski und Tschechow. Oft sind es eigentlich unaushaltbare Geschichten. Blicke in das banale Leben von Menschen, deren Existenz scheinbar kein Ziel, keinen Glanz, keine Tiefe hat. Oder wie es der Wikipediaartikel zur Verfilmung einiger Carver-Geschichten durch Robert Altman „Short Cuts“ von 1993 benennt: „unglamouröse Wirklichkeit“.
Und es ist ja auch so: Die meisten Leben sind unglamourös, banal, ohne Esprit. Man lebt so vor sich, tut, was alle tun, versucht irgendwie das Bild zu füllen von dem, von dem man glaubt, dass es so sein muss. Für viele Menschen ist das sogar die Rettung und der Anker.
So wissen sie wenigstens, was zu tun ist, füllen ihr Leben mit Versatzstücken, die ihm irgendwie Kontur geben, und sind zufrieden, auch wenn sie wissen, dass sie sich im eigenen Leben tatsächlich fremd fühlen.
Fremd im eigenen Leben
Boris Hoge-Benteler, in Marburg geboren und heute wissenschaftlicher Bibliothekar in Jena, gibt seinem Ich-Erzähler nicht einmal diese Chance. Einen Namen bekommt er erst gar nicht. Ganz so, als wäre er schon als Kind in der Anonymität verloren gegangen.
In der Wortkargheit sowieso. Aufgewachsen irgendwo in der Provinz, gefangen in den Erinnerungen an seine Schulzeit, in der er scheinbar immerfort mit dem praktisch leeren Schulbus unterwegs ist durch eine Landschaft, in der nichts passiert, aber auch keine Menschen existieren.
Tatsächlich spielen für ihn überhaupt nur zwei Menschen eine Rolle: C., der vielleicht mal sein Freund war, aber eines Tages aus unerfindlichen Gründen verschwunden ist, sodass der Erzähler sein träges Durch-die-Tage-Treiben vor sich selbst als Suche nach dem Verschwundenen kaschieren kann.
Obwohl er eigentlich gar nichts unternimmt, um C. tatsächlich zu finden. Geradezu zufällig trifft er dann eines Tages in der Berliner Philharmonie die andere Bekanntschaft aus seiner Schulzeit wieder, K., die ihn damals wenigstens irgendwie wahrgenommen hat, vielleicht auch offen wäre für ihn.
Doch auch wenn er sich mit ihr immer wieder trifft und durch die Berliner Nächte geht, kriegt er es nicht fertig, mit ihr wirklich zu sprechen. Ihre Kommunikation ist völlig reduziert auf beinah kryptische Sätze und Andeutungen, als gelte es, da ein großes Geheimnis zu lüften. Aber da ist kein Geheimnis. Und wirklich nah kommt er auch K. nicht, die für ihn grau und blass bleibt, beinahe kränklich wirkt.
Wie ein Schatten in der seltsamen Welt, die er wahrnimmt. Denn andere Menschen kommen in dieser Welt nicht vor. Er ist völlig auf sich allein fokussiert, selbst in der Freien Universität scheint er unterwegs zu sein wie in einem von Menschen völlig entblößten Computerspiel, in dem nur noch die Dinge davon erzählen, dass hier eben noch jemand gewesen sein könnte.
Was natürlich gespenstisch und albtraumhaft wirkt. Aber vielleicht auch tatsächlich so, wie viele junge Menschen die Welt erleben, in der sie sich nicht wirklich zu Hause fühlen, immer nur fremd, wie Außerirdische, die nicht verstehen, welche Regeln hier gelten und wie man mit den anderen Lebewesen in Kontakt kommt.
Im eigenen Ich verloren
Dann schrumpft die Welt auf das eigene Ich, verliert sich in Interpretationen und Mutmaßungen, wird wattig und letztlich nicht mehr entzifferbar. Und das ändert sich auch nicht, wenn der Ich-Erzähler am Ende versucht, den Spuren von C. irgendwo im Süden der USA zu folgen, in der Sonnenstadt, in der er es genauso wenig schafft, aus seiner Haut zu kommen.
Auch hier lässt er sich treiben, wacht eher verstört in immer neuen Motel-Zimmern auf, wird zu einer Geburtstagsparty eingeladen, die er dann doch nicht erlebt, nur wie verstört die wüsten Reste der Party begutachtet, ganz so, als geschehe ihm sein eigenes Leben nicht, als stoße ihm alles nur zu, während die Dinge, die passieren, sich seiner Wahrnehmung völlig entziehen.
Nur bekommt hier erstmals ein Protagonist einen Namen: Chris, irgendwie sein zugeteilter Begleiter im fremden Land, der möglicherweise auch etwas über den verschollenen C. weiß.
Nur gelingt es dem Ich-Erzähler nicht zu fragen. Als könne er das nicht. Als wäre er gezwungen, sich mit den vagen Hinweisen zufriedenzugeben, die scheinbar in seiner Umgebung auftauchen. So wie das Auto, das möglicherweise auf dem völlig leeren Boulevard auf ihn zuschießt.
Und dann doch verschwindet. Oder der Hinweis auf eine Unfallstelle am Straßenrand, die Bedeutung haben kann. Aber schon im Vorbeifahren ist das angehakt. Als gäbe es nichts weiter zu erzählen.
Und der Leser wird sich in dieser Erzählung immer wieder an Stellen wiederfinden, an denen ihm der so völlig in sich abgetauchte Erzähler wie beiläufig zu verstehen gibt, dass es nichts zu erzählen gibt.
Die Unmöglichkeit des Erzählens
Dass das freilich eher nichts mit mystischen Vorgängen zu tun hat, sondern mit der Unfähigkeit des Ich-Erzählers, zum Handelnden in seiner eigenen Geschichte zu werden und aus der Lethargie auszubrechen, macht eine Szene klar, in der K. ihn fragt: „Was nimmst du wahr?“
Und dann kommt: nichts. Wer Menschen kennt, die so reagieren, der weiß, wie verstörend das ist.
„Ich antwortete nicht. Ich nahm das alles, ausnahmslos alles wahr. Und dann, drüben, am Rande des Stegs, nahm ich auch das oder den wahr, vor dem wir die ganze Zeit über standen. Stets vor Augen. Und uns ängstigten.“
Doch nicht einmal das, wovor er sich ängstigt, wird tatsächlich greifbar. Denn das Problem ist nicht da draußen. Es steckt in ihm selbst: „Reglos bewegte ich mich, fast panisch an den Dingen haftend, dem vollkommenen Stillstand zu. Schließlich hatten wir auch die letzten Bewegungen eingestellt: das Heben und Senken des Brustkorbs beim Atmen.“
Alles, was er wahrnimmt, ist immer nur „als ob“, aufgeladen mit Bedeutungen, als stünde es für etwas anderes, Wichtiges. Nur erfährt man das nicht. Auch nicht in den Briefen an K., die Hoge-Benteler dem Roman angehängt hat, nachdem er seinen Nicht-Helden mit K. hat aus der Geschichte verschwinden lassen, Briefen, die noch einmal in immer neuen euphorischen Ansätzen andeuten, es gäbe ja eine Menge zu erzählen und nun würde der Schreiber die Gelegenheit nutzen, und es K. wirklich ausführlich erzählen.
Und dann verliert er sich jedes Mal in einer ziemlich banalen Beobachtung oder einem völlig unwichtigen Tun. Und mitten im Satz driftet er ab. „Hör zu. Denn anders bekomme ich es nicht hin.“
Überfordert von der Welt da draußen
Als wäre er wirklich unfähig, das, was ihm geschieht, in Sätze zu fassen. Als wäre es ihm unmöglich, aus sich herauszukommen und die Welt zu betreten wie einen Ort, an dem man handeln und sprechen und existent sein kann. Und das vage Gefühl schwingt natürlich immer mit: Geht es nicht einer Menge Menschen so?
Die sich völlig überfordert fühlen, am falschen Platz, in eine Welt geworfen, in der sie sich vollkommen fremd fühlen. Was unsere aktuelle Gesellschaft ja geradezu befördert. Denn das ist die Kehrseite eines völlig entfesselten Individualismus: die Einsamkeit derer, die mit diesem Ausgestoßensein nicht zurechtkommen. Die mit den vielen Möglichkeiten einer letztlich seelenlosen Konsumwelt gar nicht zurechtkommen, sich darin eher fühlen wie in einem Albtraum.
Denn deutlich wird zumindest diese schwere Suche nach Sinn. Sinn in der Welt, im eigenen Tun und Lassen. In der eigenen Lebensgeschichte, in der sich der Protagonist augenscheinlich auch noch in seinem fremden Leben als Student in Berlin immerfort im Bus sitzen sieht, der ihn in ewiger Bewegung durch die Landschaft fährt.
Nur ohne Ziel, denn das Schulgebäude ist – bis auf K. und den gesichtslosen Hausmeister – völlig leer, gespenstisch leer. Als wäre es genauso wenig ein Ort, um anderen Menschen zu begegnen, wie es das Dorf ist, in dem der Erzähler landet und wo er immer wieder vergeblich versucht, den Freund C. zu besuchen.
Mancher irrt ziemlich lange so durch sein Leben und findet den Punkt nicht, an dem er selbst zum Handelnden wird und das Leben nicht mehr als Rätsel begreift, in dem andere die Regeln bestimmen. Mancher erlebt diese Verwirrungen gerade in der Jugend, in der die Angebote der Welt einen manchmal schlichtweg überfordern.
Dass es nicht nur Jugendliche sind, die das Nicht-Erlebbare mit Bedeutung und Vermutung aufladen, wissen wir ja. Das bringt auch viele Ältergewordene dazu, die Welt als Mysterium und Illusion zu begreifen.
Strandgut im eigenen Leben
Denn natürlich konstruiert unser Gehirn die Welt so, dass sie irgendwie Sinn ergibt. Nur dass die meisten irgendwann anfangen, diesem Leben selbst einen Sinn zu geben. Und sei es aus der Grabbelkiste des großen Kaufhauses.
Aber manche schaffen das irgendwie nicht, fühlen sich immerfort wie Strandgut, das an einer unbekannten Küste angespült wurde. Und statt sich wie Robinson auf Entdeckungstour zu begeben, warten sie auf die nächste Welle, die sie vielleicht an einen anderen, besser begreifbaren Strand spült.
Und natürlich fühlen sich viele Menschen so in einer Welt, in der die alten, scheinbar nur engen Verhältnisse sich vor unseren Augen auflösen. Und den Bewohnern der Gegenwart etwas abverlangen, was ganz augenscheinlich viele überfordert, die mit dem Selbsterschaffen eines eigenen Lebens nicht zurechtkommen, sich abkapseln und nicht in der Lage sind, andere Menschen tatsächlich an sich heranzulassen. Selbst die Nähe zu K. ist diesem Ich-Erzähler zu nah.
Da ist es auch keine Überraschung, dass große IT-Konzerne längst an Meta-Universen basteln, in denen Menschen ihre Avatare handeln lassen können, während sie ihre heimischen Stuben gar nicht mehr verlassen müssen und damit die Gefahr vermindern, im Leben da draußen mit anderen, richtigen Menschen zu tun zu bekommen.
Eigentlich ein ziemlich trauriger Befund, der aber etwas Wesentliches über unsere Zeit und die Vereinsamung in einer Welt erzählt, in der Menschen verlernen, tatsächlich miteinander zu sprechen und Nähe und Gefühle auszuhalten. Jeder in seiner eigenen Welt eingesponnen und in die Vermutungen über die anderen und das, was wirklich sein könnte, wenn man denn nur in der Lage wäre, den eigenen (Alb-)Traum zu verlassen.
Boris Hoge-Benteler Sonnenstadt kul-ja! Publishing, Erfurt 2022, 15 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
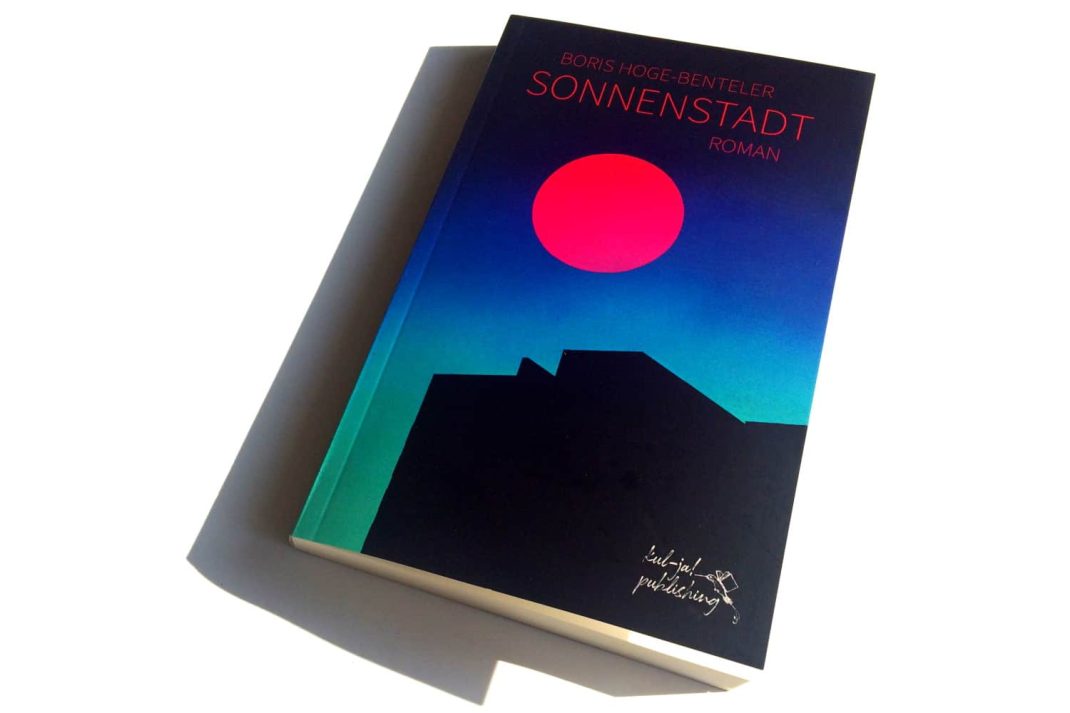




















Keine Kommentare bisher