Es ist nicht so einfach mit der Erinnerung. Was hat sich eingeprägt? Was bleibt an ganz besonderen Ereignissen? Was macht die eigenen Erinnerungen besonders? Wir leben in Zeiten, da sich immer mehr Menschen hinsetzen und aufschreiben, was ihnen (be)merkenswert erscheint. Das hat jetzt auch Lothar Kurth getan, der in diesem Buch versucht, seine Erinnerungen an Kindheit und Jugend in Lindenau zu ordnen.
Da geht es vor allem um die 1950er bis 1960er Jahre, bevor es den Autor auch mal in andere Leipziger Stadtteile wie Schönefeld verschlug. Was Rückkehr nicht ausschloss. Und auch nicht jene ausgedehnten Spaziergänge durch die Straßen der Kindheit, bei denen Menschen über 60 beginnen, in Erinnerungen zu schwelgen und die Enkel verrückt machen mit Erzählungen von Dingen, die gar nicht mehr da sind. Nur in der Erinnerung der Älteren sind sie noch so präsent, als wäre nicht ein halbes Jahrhundert vergangen.
Zeitungsverkäufer, Gaslaternen, Kohlemänner
Da ist der Zeitungsverkäufer mit seinem mobilen Stand auf der Merseburger Straße – lange bevor die gelben Zeitungskioske der Deutschen Post das Stadtbild prägten und den Jungen aus der Merseburger Straße 86 anlockten auf der Suche nach „Atze“, „Frösi“, „Mosaik“ und „Urania“. Was Jungen damals begeisterte, wenn sie nicht gerade mit den Nachbarkindern Fußball spielten, auf dem Hof und in den Kellern der zerbombten Häuser nebenan nach Abenteuern suchten.
Aber wer so alt ist wie Lothar Kurth, der weiß eben auch noch, wie viel noch in den 1960er Jahren ganz anders war. Wir Menschen erleben zwar den Fortschritt, vergessen aber schnell und willig, dass jeder neue Wohlstand zuvor kaum denkbar war. Kurth selbst holte noch die Milch im Milchtopf vom Milchhändler, der ihm schwungvoll einen Liter abfüllte. Er sah seine Mutter noch emsig an der Nähmaschine, der alten Singer mit dem Tretpedal, sitzen und Kleidung nähen und ausbessern für die Familie. Das war in den 1960er Jahren noch normal.
Genauso wie die Kerzenbeleuchtung am Weihnachtsbaum, der sich bei der kleinsten Unaufmerksamkeit in Flammen verwandeln konnte. Oder die Kohlelieferung vors Haus, bei der auch die Kohlenmänner froh waren, wenn das Kellerfenster gleich an der Straße lag.
Zeit für aufgeschriebene Erinnerungen
Natürlich kann und darf man sich dabei an die Erinnerungen anderer Autoren erinnert fühlen, die in ihren Büchern genauso leicht erstaunt sind, wie anders das Leben damals in Leipzig war. Man denke an Harald Stuttes „Wir wünschten uns Flügel“, der sich ebenso noch an die Gaslaternen im Straßenbild erinnerte. Oder an Eberhard Schröters „Walzerfahrt zum Mond“, wo die Kleinmesse noch in ihrer alten Faszination aufscheint.
Schröter lebte gar nicht so weit weg von Kurth. Und fast ist es so, als würden sich die Wege der damals in Leutzsch und Lindenau Aufgewachsenen alle in der Gaststätte „Gute Quelle“, der Taschentuchdiele in der Georg-Schwarz-Straße, kreuzen.
Gut vorstellbar, dass Kurth mit seinen Jugendfreunden an einem der Tische saß, während Gerhard Pötzsch, der seine Kindheit und Jugend in den Büchern „Taschentuchdiele“ und „Zwischenzeitblues“ poetisch verwandelt hat, mit seinen Kumpels am Tresen stand.
Alles gut vorstellbar. Man sieht den Zeitgenossen ja nicht an, welcher von ihnen sich später mal hinsetzt und seine Jugend in Literatur verwandeln wird. Oder wenigstens in hüpfende Erinnerungen, weil einem – wie bei Kurth – die Erinnerungen unterwegs aufploppen. An das Waschhaus im Hof etwa und den Weg zur Wäscherolle. Oder an das Auftauchen des Eismanns, der damals, als noch kaum jemand einen Kühlschrank besaß, ja tatsächlich richtiges Eis brachte und die Leute strömten mit Netzen herbei, um sich ihren neuen Vorrat für den Eisschrank zu holen.
Und da sich kaum einer mit Auto durch die Stadt bewegte, ist den damals Junggewesenen das alte Streckennetz der LVB noch eingebrannt – samt den O-Bussen, die damals bis in die Außenbezirke fuhren, am Bahnhof Plagwitz wendeten und am Adler oft die Leitung verloren, und den Doppeldeckerbussen, die auch den jungen Berufsstarter Kurth zur Arbeit brachten. Von den alten Straßenbahnen und den längst demontierten Streckenabschnitten ganz zu schweigen.
Gesucht: ein Wannenbad
Und natürlich fehlt auch da Kapitel zur Beatmusik und der Faszination von Radio und Tonbandgerät nicht. Die Musik der Kindheit prägte nicht nur, sie war der Sound einer Sehnsucht, die alle jungen Menschen damals fühlten. Und selbstredend lernt man mit Kurth auch wieder die durchaus bescheidenen sanitären Verhältnisse im damaligen Lindenau kennen – mit der längst sprichwörtlichen Toilette halbe Treppe tiefer, während er das Kapitel der fehlenden Sanitärzelle in der lauten und ofenbeheizten Wohnung beinahe auslässt.
Es entfleucht ihm erst später, als er mit seinen Lesern wieder zu einem seiner Erinnerungsspaziergänge durch Lindenau aufbricht, auf denen er sich an verschwundene Läden, Werkstätten und Kneipen erinnert. Und in der GutsMuthsstraße entrutscht es ihm dann: „Vorbei geht es am Wannenbad, das in den 1960er Jahren von mir und meinen Eltern regelmäßig besucht wurde …“
Mehr nicht. Da fiel dem Autor selbst nicht auf, dass das wieder so eine Stelle war, an der jeder neugierige Enkel fragen würde: „Opa, was ist ein Wannenbad?“
Wer heute da entlang spaziert, wird nicht mal einen Hinweis darauf entdecken, obwohl solche Wannenbäder damals überall im Stadtgebiet zu finden waren. Denn wenn es nun einmal in den Häusern der von Arbeitern und Angestellten bewohnten Ortsteile keine eingebauten Bäder mit laufend Warmwasser gab, dann mussten die Menschen, wenn sie sich mal gründlich schrubben wollten, in so ein Wannenbad gehen.
Im Adressbuch für 1929 steht zum Beispiel die genaue Adresse: GutsMuthsstraße 27, Lindenbad. Damals betrieb Walter Benn dieses Bad für die Menschen im Erdgeschoss des Hauses.
Im Adressbuch für 1949 findet man das Linden-Bad auch noch: „Medizinische Kur- und Wannenbäder“. Inhaber: Fritz Kühn.
Es verschwinden eben doch viel mehr Dinge, als einem so spontan einfallen. Und wenn es keiner aufschreibt, wird es tatsächlich vergessen – so wie die Telefonzelle vor den Häusern der Lützner Staße 74 und 76, wo auch Kurth einst die 20-Pfennig-Stücke im Schlund des Apparates verschwinden sah und sich kurzfassen musste, denn draußen wartete die Schlange aus Menschen, die allesamt zu Hause kein Telefon besaßen – das war Mangelware. Eingeweihte kennen auch noch das alte Fernsprechamt in der Schadowstraße und die Poliklinik West und das Abenteuer, in DDR-Zeiten zu einer eigenen Wohnung kommen zu wollen.
Die verschwundenen Landschaften der Kindheit
Manche waren auch dabei, als am Kulkwitzer See schon in Massen gebadet wurde, als sich das Tagebauloch gerade erst mit Grundwasser anfüllte. Manche haben – wie Kurth – im Westbad noch Schwimmen gelernt. Nur das Angeln war nicht so sein Ding, anders als bei Eberhard Diesner in „Fischwaid“. Trotzdem sind die Spaziergänge durch Lindenau voller Erinnerungen. Manchmal reichen sie bis in die 1990er Jahre, als auch Kurth erlebte, wie sein Berufs- und Familienleben durcheinander geschüttelt wurde.
Das war auch die Zeit, als das Lindenau seiner Kindheit zunehmend verfiel und auch das einstige Wohnhaus der Familie in der Lützner Straße 86 abgerissen wurde. Nur über die Mauer des Nachbargrundstücks ist noch ein Blick in den Hof möglich.
Wie schaut man so in die Landschaft seiner Kindheit? Ohne Wehmut wahrscheinlich nicht, denn das, was einen als Kind aufregte und begeisterte, ist als Echo immer da. So wie auch beim einst beliebten Kino „Film-Palast“ in der Georg-Schwarz-Straße, in dem Kurth die DEFA-Indianerfilme erlebte und mit seinen Freunden alte Damen mit großem Hut ärgerte.
Natürlich sind diese Erinnerungen nur wie Blitzlichter. Oder wie kleine Filme aus Kurths Zeit mit der Schmalfilmkamera. Jeder hat solche Szenen im Kopf, Blitzlichter der eigenen Geschichte, die natürlich irgendetwas erzählen darüber, wie man so wurde, wie man heute dasteht. Mit einem Leben, das mehr Fragment ist als logische Erzählung. Kurth versucht auch gar nicht erst, eine Heldenerzählung darüberzulegen.
Vielleicht sind Heldenerzählungen sowieso nur Selbstbetrug und am Ende bleibt nur das Gespinst aus Gefühlen, das einen mit seinen Eltern, den Freunden aus der Kindheit, den damals scheinbar immer präsenten Gestalten aus der Nachbarschaft und den Orten der frühen Abenteuer verbindet. Ein Gespinst, das auch 50 Jahre später noch da ist und jeden Gang durch die alten Straßen zu einer Begegnung mit Schatten und Namen und Erinnerungsfetzen macht, die sich mit der oft schablonenhaften Gegenwart überblenden.
Und wenn die Enkel nicht zuhören wollen, muss man es eben alles aufschreiben, so wie es einem einfällt. Es gibt gewiss genug Leser und Leserinnen da draußen, die sich selbst wiederentdecken in solchen biografischen Ausflügen in eine Welt, die es nicht mehr gibt.
In diesem Sinn auch wieder eine „Welt von gestern“, die die Ältergewordenen vor die Frage stellt: Soll man dem immerzu nachtrauern? Oder reicht es völlig, es ab und zu den Kindern und Enkeln zu erzählen, ohne ihnen das schauerliche Gefühl zu geben, früher sei alles besser gewesen?
Intensiver, das schon. Aber das liegt nur daran, dass man die Welt als Kind viel frappierender erlebt und noch fest daran glaubt, dass eine Unendlichkeit vor einem liegt. Bis man beim Spaziergang 50 Jahre später merkt, wie unbarmherzig die Zeit alles verändert. Wirklich alles.
Lothar Kurth „Lindenau. Erlebnisse in Kinder- und Jugendjahren“, Pro Leipzig, Leipzig 2023, 18 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
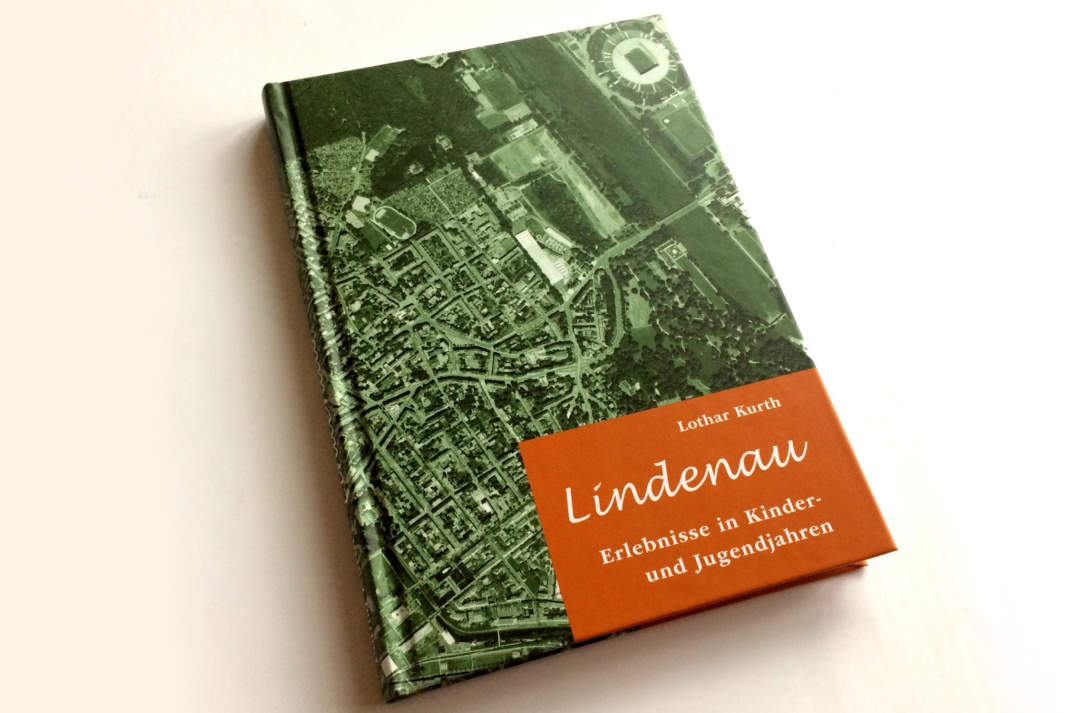




















Keine Kommentare bisher