LeserclubEs war gerade diese todtraurige Melodie in der Warteschleife, die Herrn L. auf die Idee brachte, die alten Chemikalien des Fotolabors herauszuholen, das sie mal betrieben hatten, als diese Zeitung noch schwarzweiße Fotos druckte und man Filme in Kameras legte. Filme, die sich im Archiv stapelten. „Was soll denn das, Herr L.?“
Wenn er sich ärgerte, griff der Ressortchef zum unbekömmlichen Sie. Dann wurde auch sein Gesichtsausdruck gelblich und L. lag jedes Mal die Frage auf der Zunge, ob er ein paar schlimme Probleme mit der Leber hatte. Oder der Galle. Oder den Nieren. Aber er fragte lieber nicht. Er mochte den Alten ja irgendwie. Und gerade weil er so ein Stacheltier sein konnte, war das Leben mit ihm berechenbar.
Hinter der grimmigen Fassade lauerte ein grimmiger Geist, der das Kämpfen noch in Zeiten gelernt hatte, als man blöden Politikern auch noch blöde Fragen stellen konnte.
Und blöde Antworten bekam. Aber zitierfähige.
Heute bekam man meistens nur noch freundlichen Mulch, der gut als Orchideendünger dienen könnte. Aber wenn man ihn zitierte, verärgerte man nur die Leser. Sie glaubten dann, dass man sie verarschen wollte und mit den Glattgestriegelten unter einer Decke steckte. Oder sie vermuteten, dass man nicht richtig gefragt hatte. Sie wussten nicht, dass Politiker und Manager und Fernsehmoderatoren dieselben Pflichtkurse besuchten: „Wie rede ich mich raus und keine Sau merkt es?“
Wenn solche Antworten in die Redaktion flatterten, setzte sich das liebenswerte Stacheltier dann meist selbst ans Telefon und ließ sich mit dem Windbeutel persönlich verbinden. Was heutzutage kaum noch gelang. Man landete meistens bei der „Leiterin Kommunikation“, einer klugen Dame mit drei Abschlüssen und zwei Doktortiteln und der Arroganz einer Königskobra – und natürlich bestens geschult, neugierige Stacheltiere auf Distanz zu halten.
Nur dass Stacheltier sich die schöne Strategie ausgedacht hatte, dann eben die netten Königskobras zu zitieren. Und weil er ihnen schon mal ankündigte, dass er sie zitieren werde, verboten sie es ihm natürlich. Weshalb er sie erst recht zitierte. War ja sein gutes Recht. Die Damen waren ganz offiziell als Sprechorgan ihrer Herren eingestellt und zumeist vom steuerzahlenden Fußvolk bezahlt. Sie konnten sogar Faxe schicken mit der geharnischten Drohung, man werde sich juristische Schritte überlegen, wenn die angedrohten Zitate erschienen.
Natürlich erschienen die angedrohten Zitate. Und dann blieb es still.
Es schadete nur irgendwie dem Geldbeutel, hatte Stacheltier mal erzählt. Denn die Königskobras und ihre goldlockigen Herren waren ja aufs Engste verbandelt mit ihren Parteifreunden in diversen Unternehmen, Gesellschaften, Demokratiebeglückungsvereinen. „Verwandtschaft ist nichts dagegen …“
Aber was hatte das jetzt mit seinem grämlichen Knurren zu tun, weil L. die Dunkelkammer wieder in Betrieb nahm?
Eine Menge. Das roch auch Stacheltier mit feiner Nase. Wenn er so grämlich fragte, dann war das seine alte, unerschütterliche Neugier. Ohne Anlass landete niemand in diesem Metier und tat es sich an, über all die Jahre lauter Leute zu verärgern, die so nachtragend waren wie Mufflons. Wer lieber in einer Welt lebte, in der alle nett und entgegenkommend waren zu einem, der verkaufte wohl besser Brötchen oder Fußballwimpel. Aber nicht seine kostbare Zeit für uralte Geschichten.
Und diese hier waren ja uralt.
Und Herr L. war froh, dass er sich früher, als die Welt noch nicht ganz so hektisch war, immer die Zeit genommen hatte, alle seine Filme säuberlich zu beschriften – mit Datum und Anlass. Und weil die Fotos damals auch immer gleich – hübsch gerastert – in die Zeitung kamen, brauchte er nicht lange zu suchen. Der Zeitraum war längst klar. Es war dieser seltsame Sommer, als sich die Ereignisse ballten und ein Jungspund namens L. nicht mal ahnte, dass das auch im Zeitungsleben etwas Seltenes ist: ein Mord im Zoo, eine lebenslustige junge Frau, die der ganzen Stadt den Kopf verdreht hatte und die tot in einem Hotelzimmer gefunden wurde. Und ein Jubiläum, über das er sich schon deshalb nicht wunderte, weil er in einer Zeit lebte, in der alle Welt es für etwas Besonderes hielt, wenn ein Unternehmen seinen ersten Geburtstag feiern konnte und nicht schon wieder pleite war.
Im Gegenteil. Die FUCHS BAU GEMEINSCHAFT hatte nicht nur den ersten Geburtstag gefeiert, sondern galt an diesem etwas wärmeren Frühlingstag schon als das große geglückte Experiment hiesiger Unternehmungslust. Woran ja keiner so recht glaubte. Gerade wurde ringsum alles abgewrackt, verschickt, eingedampft, entsorgt und verscherbelt, was nicht niet- und nagelfest war, was niemandem gehörte oder den Falschen. Oder über Nacht auf einmal die Besitzer und die Nationalität gewechselt hatte.
Als stünde die ganze Stadt zum Ausverkauf. Und wer die besseren Beziehungen hatte und in sonnigeren Weltgegenden seinen Schulabschluss geschafft hatte, der konnte sich eindecken mit billiger Ware, leckeren Stücken von der Stadt, die dann in vielen Fällen in großen dunklen Schränken verschwanden, wo sie vor sich hin gediehen, um auf bessere Zeiten zu warten. Denn jeder wusste ja: So billig würde es das ganze Zeug nie wieder geben.
Und wenn die anderen alle aufwachten, würden sie dumm dastehen, denn dann würden die Emsigen und Fleißigen bestimmen, was das Filetstückchen Stadt kostete. Sie würden es den eingeborenen Schlafmützen mit Zins und Zinseszins zurückverkaufen.
Wenn die es sich leisten konnten.
Was ja nicht zu erwarten war.
Und eigentlich hätte L. schon munter werden müssen, als ihm der Name FUCHS BAU GEMEINSCHAFT unterkam. Damals schon, als er im selbst gekauften blauen Anzug mit seiner besten Krawatte und der besten Kamera der Redaktion losflitze. Vielleicht war es sogar Stacheltier selbst, der ihn losgeschickt hatte. Damals machten sie noch solche Geschichten, rannten los, wenn die ganzen tapferen Nigelnagelneu-Unternehmen ihre ersten Geburtstage, Einweihungen und Domizileröffnungen feierten.
In diesem Fall in einem der prächtigen Häuser. Na wo wohl? Natürlich am Herrmannkai. Genau da, wo sie heute alle immer noch saßen. Nur dass der Name ein klein bisschen anglisiert wurde, denn aus einem kleinen Unternehmen mit „heimischen Wurzeln“ (wie L. selbst damals schrieb – der Artikel musste ja schnell fertig werden) war ein international agierender Developer geworden. Oder irgendetwas anderes Englisches. L. las diese ganzen Selbstbeschreibungen schon gar nicht mehr, weil er davon Pickel bekam.
Und der Film war genau da abgelegt, wo er hingehörte. Es war fast der Erste. Und damals war L. so stolz gewesen, weil er – trotz aller Aufregung – den ganzen Film verknipst hatte und die meisten Fotos tatsächlich etwas geworden waren. Lauter fröhliche Gesichter.
Fröhlich?
Vielleicht wirkte der Bildausschnitt so, den sie damals für den Text gewählt hatten. Doch als L. die ersten Abzüge ins Entwicklerbad tauchte, merkte er schnell, wie sehr die Erinnerung trog.
Diese Leute schauten ganz und gar nicht so, wie man sich freundliche und fröhliche Menschen vorstellt, die den Erfolg ihres gemeinsamen Unternehmens feierten.
Das Lächeln lag bei einigen nur um den Mund herum. Die Augen – ja – was erzählten die Augen? Mit ihm selbst hatte das wenig zu tun. Er störte nur. Er sollte seine Fotos machen, die sollten ordentlich werden, morgen wollte man sich stolz in der Zeitung sehen. Dass einer ihn damals auch voller Verachtung ansah, das wusste L. ja noch. Den Burschen hatten sie beim Einpassen in das Zeitungsraster einfach abgeschnitten. Der hatte ganz rechts gestanden. Eigentlich ideal für eine schöne Bildkomposition. Mit seinem schwarzen Anzug, der selbst auf diesem Foto etwas ungebügelt aussah, rahmte er die hübsche Szene im Hintergrund ein, wo der eigentliche Held der Party mit seiner neuesten Flamme stand. Genau der jungen Dame, die kurz zuvor an seiner Seite aufgetaucht war, nachdem die Sache mit Belinda …
Ja, da passten die Geschichten ineinander.
Und sie passten noch besser, als L. genauer hinschaute, denn auch das war dann abgeschnitten worden, als das Bild in den Satz ging: Die junge Dame war schwanger. Und der Held der Geschichte hatte seine Hand auf diesen formidablen Bauch gelegt. Besitzergreifend, wie sich das gehört für erfolgreiche Männer, die zeigen wollen, was ihres ist.
Muss man noch erklären, wer dieser besitzergreifende Bursche war? Der natürlich nicht Fuchs hieß. Wo kämen wir da hin, wenn wir das behaupten wollten. Aber er wusste, warum er in dieser Stadt so genannt wurde. Und warum ihn selbst Leute, die ihn näher kannten, so nannten.
„War da nicht was“, grummelte Stacheltier. Er stand tatsächlich neben L. über die Wanne gebeugt und griff behutsam zu, als das Bild in aller Klarheit zu sehen war, um es abtropfen zu lassen und dann sachte ins Fixierbad zu tauchen.
„Natürlich. Darum geht es doch die ganze Zeit. Der Fuchs hängt mit drin bei diesen Grundstückecken am Herrmannkai.“
„Das meine ich nicht. Ich meine diese junge Dame da …“
„Ich dachte, die hat er geheiratet?“
„Kann ich mich nicht dran erinnern. Hast du dir die Namen aufgeschrieben?“
„Natürlich.“ Sein altes Notizbuch, das er erst tags zuvor ausgegraben hatte, lag ja aufgeschlagen neben dem Fixierbad.
Fein säuberlich standen die Namen da. Natürlich auch der des Mammuts, ganz rechts, dieses ungebügelten Mannes mit seinem Lebendgewicht, dem man nicht zutraute, dass es sich unverhofft bewegen und zur rempelnden Materie werden konnte. Hatte er das damals ausgelöst, fragte sich L. Hatte er irgendetwas falsch gemacht? Bis heute war sich L. darüber nicht im klaren, nur dass er nach einigen Minuten der völlig überreizten Fröhlichkeit, in denen er diese stocksteife Gesellschaft zu etwas lockereren Posen hinzubiegen versuchte und dabei immer wieder hin und her flitzte, um eine bessere Perspektive hinzukriegen, dass ihn da auf einmal irgendetwas aus den Schuhen hob. Manchmal passiert das. Ein Moment der Unachtsamkeit. Man sieht nicht, wo man hintritt, stolpert über etwas, ist aber völlig auf den kleinen Ausschnitt im Sucher konzentriert. Und auf einmal begegnet man der Erde in all ihrer Pracht, versucht irgendwie die Kamera zu bewahren, knallt deshalb mit dem Kinn auf das gewienerte Parkett.
Und dann hat man ein paar hübsche Begegnungen mit vorbeisausenden Sternen.
Und dann denkt man: Jetzt stehst du wieder auf.
Und kann nicht, weil ein blank gewienerter Schuh auf seinem Schlips steht. Und von oben spricht eine Stimme: „Da hab ich wohl nicht aufgepasst.“
Ohne besondere Betonung. So wie ein viel beschäftigter Rechtsanwalt die Paragraphen herunterleiert, nach denen er gedenkt, den Herrn L. jetzt einmal tüchtig zur Kasse zu bitten.
Rasselte irgendwo eine Registrierkasse?
Vielleicht.
Zumindest musste sich Mammut tief herunterbeugen, um L. ins Gesicht zu sehen. Und da war kein Blinzeln und auch keine Verachtung. Nicht mal die. Er hatte gesagt, was zu sagen war.
Und dann nahm er den Fuß von L.s Schlips und L. konnte aufstehen.
„Den Typen ganz links hast du aber nicht aufgeschrieben.“
„Doch“, sagte L. Und zeigte Stacheltier den Pfeil, den er damals noch dazugemalt hatte. Vielleicht war das der Grund gewesen, warum sie ihn so schnell wieder loswerden wollten. Denn gerade dieses zierliche Männlein mit der Knollennase wollte seinen Namen nicht nennen. Hatte er so etwas gesagt wie „Ist doch nicht wichtig?“
Möglich. Vielleicht hatte L. einmal zu viel gefragt. Und den Namen, den er in dem ganzen partylaunigen Gerede aufgeschnappt hatte, später hingeschrieben, vom Hörensagen also. Vielleicht hatten sie das Bild auch deshalb beschnitten. Der kleine Pfeil zeigte auf die Worte „Müller? Möller? Miller?“
Deswegen belichtete er diesen Bildausschnitt noch einmal extra und versuchte, das Gesicht so groß wie möglich zu bekommen.
„Müller? Ist dir nichts Besseres eingefallen?“
„Ich denk mir sowas nicht aus“, sagte L.
„Manchmal hab ich aber so ein Gefühl, weißt du?“
„Sowas kann man sich nicht ausdenken. Hat die Polizei damals übrigens Phantombilder von dem Toten im Zoo geschickt?“
„Kann ich mich nicht erinnern.“
„Oder wenigstens eine Beschreibung?“
„Glaub nicht.“
„Ist doch seltsam, findest du nicht?“
„Och nö“, sagte Stacheltier. Und machte sich dann selbst daran, eine Person aus dieser illustren Runde zu vergrößern.
„Na hoppla, kennst du sie doch?“
Aber darauf erwiderte Stinktier nichts, er schaute nur mit erstaunlicher Faszination auf das Bild, das sich langsam entwickelte unter seinem strengen Blick. Als wollte er es mit Blicken bändigen.
Und dann ließ er es tatsächlich im Entwicklerbad, das Bild wurde immer schwärzer. Stacheltier war augenscheinlich ganz weit weg in Gedanken.
Und dann schüttelte er sich kurz, als wäre er mal kurz im Wasser gewesen. Wie ein Hund, der sich bereit macht für frische Taten. „Weißt du, L. Diese Geschichte da, die hab ich sogar selbst geschrieben.“
„Welche Geschichte?“
Aber darauf sagte Stacheltier nichts mehr, ging einfach aus dem Kabuff und ließ L. mit seinen Rätseln allein. Nur draußen klingelte das Telefon. Und das tat es schon eine geraume Zeit.
Alle Teile der Serie zum Nachlesen.
In eigener Sache – Wir knacken gemeinsam die 250 & kaufen den „Melder“ frei
https://www.l-iz.de/bildung/medien/2016/10/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
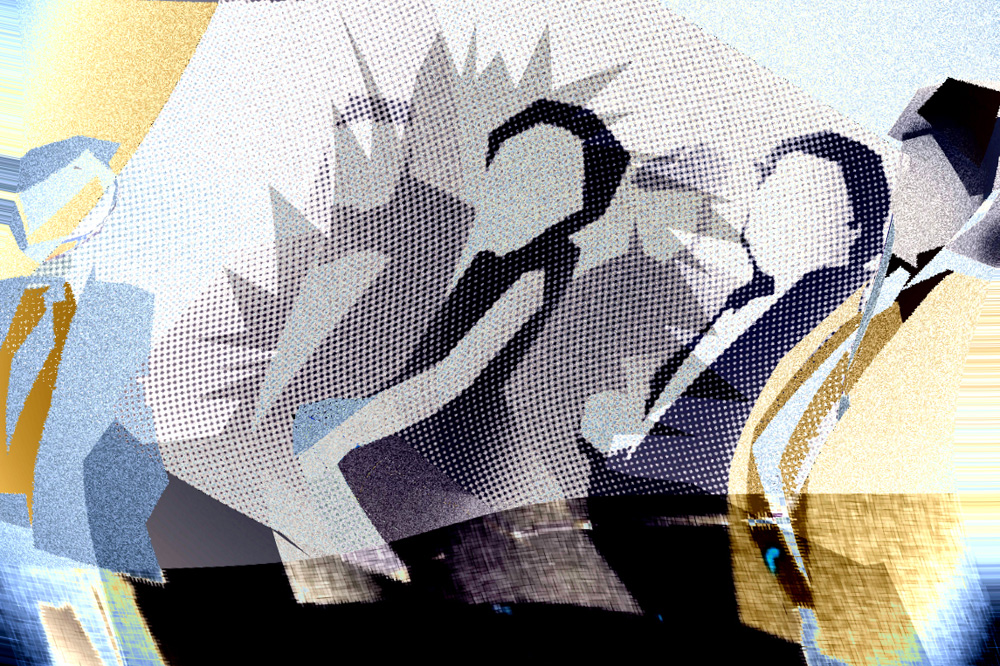








Keine Kommentare bisher