Der Teufel scheißt auf den größten Haufen, auch wenn es ein Haufen Viren ist. Scheißegal. Der Teufel sagt sich: Geschäft ist Geschäft – und legt los. In diesem Fall plumpsen die Goldtaler, die aus der Berichterstattung über die Coronakrise entspringen, auf Google, Facebook und die großen Medienhäuser darnieder, derweil Lokalzeitungen nur ein paar Spritzer abkriegen.
Es ist eines der großen Paradoxa dessen, was man gemeinhin die Coronakrise nennt. Gerade jetzt, wo die Berichterstattung über die Ereignisse und Entwicklungen vor Ort besonders wichtig ist und vertrauenswürdige Informationen gebraucht werden, gerade jetzt kommt in den USA der Teufel daher und lässt die Lokalzeitungen abkacken. Das ist in den Vereinigten Staaten gewiss nicht anders als in Deutschland, nur ist die Entwicklung in den USA noch eine Spur schneller, größer und durchschlagender als hierzulande.
Dabei ist der Zeitpunkt ohnehin schon beschissen genug. Die Gesamtauflage der amerikanischen Tageszeitungen hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren von knapp 60 Millionen auf rund 29 Millionen Exemplare halbiert. Die Werbeeinnahmen sind im gleichen Zeitraum sogar um mehr als 70 % gefallen.
Viele Tageszeitungen sind hochverschuldet, manche werden nur noch von mehr oder weniger verrückten Philanthropen aufrechterhalten, während andere – manche sagen 40 % – am Tropf großer Investmentfunds hängen, denen „Einsparung“ schon immer das liebste Krisenwort war. Denn eines ist klar: Die Corona-Pandemie wird das seit Jahren grassierende Zeitungssterben noch weiter verstärken.
In hunderten amerikanischen Counties gibt es inzwischen keine einzige Tageszeitung mehr, ganze Landstriche sind zur lokaljournalistischen terra incognita geworden, und wer das nicht zu glauben vermag, für den macht eine Karte die Lücken in der Landschaft auf einen Blick sichtbar. Für den Rest gibt es Zahlen: Seit 2004 sind mehr als 2.100 amerikanische Zeitungen pleitegegangen. Zwischen 2008 und 2018 wurde in den Vereinigten Staaten ein Viertel der Journalisten entlassen, die meisten von ihnen waren bei Lokalmedien angestellt. Allein in Kalifornien hat zwischen 2004 und 2019 ein Viertel der Tageszeitungen dichtgemacht.
Die Coronakrise beschleunigt diese Entwicklung nur noch. Manche Zeitungen schließen, weil sie die Sicherheit ihrer Leute nicht mehr garantieren können, weil die Druckereien den Betrieb eingestellt haben oder sich die Lieferketten nicht mehr aufrechterhalten ließen. Bei anderen sind die ohnehin schon spärlich fließenden Werbeeinnahmen dermaßen weggebrochen, dass sie Mitarbeiter entlassen mussten oder nur noch jeden zweiten Tag eine Ausgabe produzieren. Selbst die viel gelobte Seattle Times, die in der besonders hart von Corona betroffenen Stadt ihre Auflage steigern konnte und seit Wochen zu journalistischer Hochform aufläuft, tut dies mit der Hälfte der Beschäftigten, die es noch vor nicht allzu langer Zeit hatte.
Es ist eine ebenso klassische wie traurige Ironie der Geschichte: Während die Zahl der Zeitungen und Journalisten wegbricht, sind ihre Berichte so wichtig wie seit Langem nicht mehr. Es sind schließlich die lokalen Medien, die die Meldungen über Erkrankungen und Todesfälle sammeln und publizieren, die die Fakten vor Ort gegenchecken und sie in einem regionalen oder nationalen Kontext verorten. Aber auch die Behörden, allen voran die Zentren für Seuchenbekämpfung und -prävention, sind auf Lokaljournalisten angewiesen und profitieren von ihrem Wissen.
„Wenn die Städte ihre Zeitungen verlieren, beginnt für die Analysten der Krankheit der Blindflug“, hat der Scientific American vor wenigen Tagen getitelt und die Situation damit treffend zusammengefasst. Denn klar ist: Das Bild der Krise mag nahtlos erscheinen, tatsächlich aber setzt es sich aus vielen, oft winzig kleinen Puzzleteilen zusammen, von denen einige schon gar nicht mehr existieren.
Über all das von der Trump-Regierung kein Wort. Ob von dem gigantischen 2,2-Billionen-Dollar-Hilfspaket etwas bei den Lokalzeitungen, den Community-Radios und kleinen TV-Stationen ankommt, ist unklar, auch wenn die Demokraten 300 Millionen Dollar zur Unterstützung des öffentlichen Rundfunks gefordert haben. Seitens der Trump-Regierung aber so gut wie kein Wort dazu, und auch sonst gibt es von der Regierung bislang keine Hilfsangebote.
Aber was will man auch erwarten? Donald Trump hat während seiner Präsidentschaft die Worte „Lokalzeitung“ und „Lokaljournalismus“ nicht ein einziges Mal in den Mund genommen. Weder in seinen Reden noch in seinen Interviews oder in einer sonstigen Verlautbarung ist darüber etwas zu finden, und auch in den tausenden Twitternachrichten ist nichts zu entdecken. Aber wie auch? Die lokalen Lebenswelten haben Donald Trump noch nie interessiert. Für ihn muss alles groß sein. Amerika ist für ihn eine Gigantomachie. Es zählt das heroische Schlachtgemälde, nicht seine einzelnen, hässlichen Teile.
Abseits von Washington, New York und L. A. bitten die Zeitungsmacher derweil um Spenden oder einfach nur ein Abonnement. Nur wenige Politiker unterstützen sie bisher darin, und bei denen, die es tun, macht allein schon der Wortlaut klar, wie tief der Karren im Dreck steckt. In Amerika, dem Land der Siegesgewissheit, starten sie nur noch Almosenaurufe: „Wenn Sie es sich leisten können, bitte, denken Sie darüber nach, ihre Lokalzeitung zu abonnieren“, schreibt der Gouverneur von Vermont, während Donald Trump weiter gegen die Medien wütet.
Gewiss, Trumps Angriffe gelten den Big Playern wie CNN, der New York Times und der Washington Post, aber indem Trump – seit nunmehr über drei Jahren schon – die Medien angreift und sie zu Feinden des Volkes erklärt, desavouiert er auch den Lokaljournalismus. Das ist umso schmerzlicher (und falscher), als es gerade die lokalen Medien sind, die von den Amerikanern bisher als besonders vertrauenswürdig eingestuft wurden.
Es ist ein bizarres Bild, und wenn es nicht so traurig wäre, könnte man lachen: Den meisten Lokalzeitungen steht das Wasser bis zum Hals, zugleich aber sitzen die verbliebenen Journalisten in lauter kleinen Booten und treiben auf einem See umher, der ihnen kaum mehr genug Wasser unter dem Kiel lässt, um weiterzufahren, sich vielleicht sogar auf Entdeckungsreise zu begeben.
Google und Facebook haben ihnen den Hahn abgedreht. Sie haben die vielen kleinen Zuläufe aus Werbegeldern weitgehend kanalisiert und in Form eines großen Stroms zu sich geleitet. 60 % des Online-Werbegeschäfts läuft in den USA über sie.
Die dailies dümpeln dagegen dahin. Und Corona trocknet ihnen das Konto noch weiter aus. Jetzt, wo viele Geschäfte geschlossen haben und sämtliche Veranstaltungen abgesagt sind, versiegen die Werbeeinnahmen fast vollends. Und da hilft es auch nicht viel, dass die Leute wie verrückt auf die Online-Angebote zurückgreifen. Klick-klick mit der Maus macht nicht Klack-klack in der Kasse.
Gelesen wird trotzdem. Oder gerade deswegen. Und Facebook saugt erneut alles auf – und kann sich dabei sogar noch zum großen Krisenaufklärer stilisieren. Bereits am 19. März hatten fast 50 % aller Artikel, die via Facebook in den USA gelesen wurden, mit dem Coronavirus zu tun. Überhaupt werden Nachrichten und journalistische Beiträge in Zeiten von Corona immer wichtiger. Das ist auch auf Facebook zu sehen. Jahrelang war der Anteil der News dort rückläufig, jetzt steigt er wieder.
Aber da ist noch mehr, denn Umfragen und zahlreiche andere Daten zeigen, was und wen die Leute in Krisenzeiten lesen, welchen Medien sie am ehesten zutrauen, im Falle von Corona verlässlich und faktenbasiert zu berichten: Es sind die sogenannten Qualitätsmedien und ihre Online-Angebote, sind die großen Nachrichtenportale und die kleinen Lokalzeitungen. Wobei Lokalnachrichten laut den vorliegenden Daten besonders häufig gelesen werden. Die Leute wollen eben wissen, was vor ihrer verschlossenen Haustür passiert.
Die Abrufzahlen der Artikel schießen jedenfalls raketenartig nach oben, aber die Einnahmen bleiben weitgehend am Boden und gleichen nur zu einem Bruchteil die Verluste des Printgeschäfts aus, zumal eine Reihe von Unternehmen inzwischen darauf verzichtet, Online-Werbung zu schalten, da sie ihre Produkte nicht neben einem Artikel über Corona-Tote angepriesen sehen wollen.
Aber das ist im Grunde nur ein marginales Problem, denn das generelle liegt tiefer – und ist auch ein anderes. Es besteht in dem schlichten Fakt, dass das Online-Geschäft den Medien nur einen Kleckerbetrag bringt. Amerikanische Zeitungen erwirtschaften im Schnitt nur ein Drittel ihres Umsatzes mit Online-Werbung, zwei Drittel der Erträge entstehen durch die Anzeigen in den Druckausgaben sowie anderweitige Geschäfte wie Ticketverkäufe. Aber auch die gibt es nicht mehr.
Bei Lokalzeitungen ist der Einnahmeanteil aus dem Online-Geschäft oft sogar noch geringer und liegt nur bei 20 %. Den großen Rest ihres Umsatzes machen sie noch immer mit den Anzeigen, die sie in der Printausgabe platzieren. Das meiste davon geht auf lokale Geschäfte und Unternehmen zurück – aber die sind jetzt zum Großteil geschlossen.
Kein Wunder, dass Journalisten und Branchenverbände erste Forderungskataloge und Wunschlisten verfassen, und was darin angemahnt wird, ist nicht nur richtig, sondern auch um ein vielfaches günstiger als die Milliarden und Abermilliarden, die in den kommenden Wochen und Monaten in die Ölindustrie, die Flugunternehmen und Autohersteller gepumpt werden. Zumal die „public media“ in den USA – vergleicht man sie mit anderen Industrieländern – seit Jahrzehnten massiv unterfinanziert ist.
Die Vereinigten Staaten geben pro Jahr nur drei Dollar pro Kopf für den öffentlichen Rundfunk aus. Der Spitzenreiter Norwegen investiert mit 180 Dollar pro Kopf sechzig Mal so viel, und auch Deutschland steht mit seinen 143 Dollar ganz ordentlich da. Es ist daher mehr als verständlich, dass die Journalisten und Branchenverbände in den USA wenigstens eine Verdoppelung der Bundesmittel verlangen, damit auf lokaler Ebene Zeitungsmacher, TV-Leute und Radioreporter eingestellt werden können.
Die Gesamtinvestition würde in diesem Falle 930 Millionen Dollar pro Jahr betragen – eine geradezu lächerliche Summe angesichts dessen, was damit für die Allgemeinheit getan werden kann. Und noch lächerlicher wenn man bedenkt, was für aberwitzige Summen sonst so im Raum stehen und für was für Luft(verunreinigungs)blasen sie ausgegeben werden.
Aber vielleicht ist genau das das Problem: Je höher die geforderte Summe, umso wichtiger scheint die dahinterliegende Industrie. Nur ist das eben ein Trugschluss. Das sollten wir spätestens jetzt wissen, wo angesichts von Corona klar wird, dass der Großteil der Leistungsträger der Gesellschaft nicht in den Chefetagen sitzt und auch sonst nirgends im oberen oder auch nur mittleren Bereich der Gehalts-Skala zu finden ist.
Die datengesättigten Analysen, die im Zuge von Corona in den vergangenen Tagen publiziert worden sind, zeigen, dass in Deutschland, den USA und anderen Ländern die systemrelevanten Jobs häufig diejenigen sind, die am schlechtesten bezahlt werden, deren Träger über wenig gesellschaftliches Ansehen verfügen und nicht selten ohne Tarifverträge oder andere Absicherungen auskommen müssen.
Und als sei das alles noch nicht genug, werden 75 % dieser schlecht bezahlten und wenig prestigeträchtigen Jobs von Frauen gemacht, die – dem Gender Pay Gap sei „Dank“ – selbst am unteren Ende der Lohnskala nochmal Abstriche hinnehmen müssen. Wobei (und weshalb) eines nicht übersehen werden darf: Die Forderung nach einer Gleichbezahlung der Geschlechter mag in den mittleren und oberen Gehaltsklassen als ein Akt der Emanzipation betrachtet werden. In den unteren Einkommensgruppen ist sie vor allem ein Teil des täglichen Existenzkampfes.
Aber Corona macht noch mehr deutlich – und das Beispiel der lokalen Zeitungen dient auch in diesem Falle der Illustration. Denn während die Grenzen zwischen den Ländern wieder dichtgemacht werden, haben viele große Medienhäuser in den USA ihre geschleift und die Bezahlschranken bis auf Weiteres niedergerissen. Bei zahlreichen großen Zeitungen und Nachrichtenportalen sind seit einigen Tagen alle Artikel kostenlos zu haben.
Andere haben dagegen nur ihre Berichterstattung über Corona vom Bezahlen befreit, während wiederum andere – mit genug Geld in der Hinterhand – längerfristig denken können und mit Kampfpreisen versuchen, Kunden dauerhaft an sich zu binden. Die New York Times offeriert aktuell Jahresabos für etwa drei Dollar im Monat. Studenten bekommen es sogar noch günstiger. Warum also für ein lokales Produkt 10 oder 20 Dollar ausgeben, wenn das globale so billig zu haben ist? Es ist das altbekannte System …
Und die Lokalzeitungen? Die dümpeln weiter in ihren langsam verlandenden Teichen dahin. Den Rest erledigen Corona und der Teufel vom Anfang. Denn der ist immer noch da. Er war nie weg. Er scheißt nach wie vor auf den größten Haufen. Sogar mehr als er es jemals getan hat.
Nur eine Sache ist neu, denn der Teufel ist auch ein Krümelkacker geworden. Aber das stört ihn nicht. Im Gegenteil, die Krümel gehören inzwischen dazu. Mit ihnen lassen sich die großen Haufen aufs Schönste verzieren. Sie krönen sein herrliches Werk.
Alle Auszüge aus dem „Tagebuch eines Hilflosen“.
Direkt zum „Tagebuch eines Hilflosen“.
Ein Spiel auf Zeit: Die neue Leipziger Zeitung zwischen Ausgangsbeschränkung, E-Learning und dem richtigen Umgang mit der auferlegten Stille
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Natürlich werden auch die L-IZ.de und die LEIPZIGER ZEITUNG in den kommenden Tagen und Wochen von den anstehenden Entwicklungen nicht unberührt bleiben. Ausfälle wegen Erkrankungen, Werbekunden, die keine Anzeigen mehr schalten, allgemeine Unsicherheiten bis hin zu Steuerlasten bei zurückgehenden Einnahmen sind auch bei unseren Zeitungen L-IZ.de und LZ zu befürchten.
Doch Aufgeben oder Bangemachen gilt nicht 😉 Selbstverständlich werden wir weiter für Sie berichten. Und wir haben bereits vor Tagen unser gesamtes Archiv für alle Leser geöffnet – es gibt also derzeit auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de ganz ohne Paywall zu entdecken.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere selbstverständlich weitergehende Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
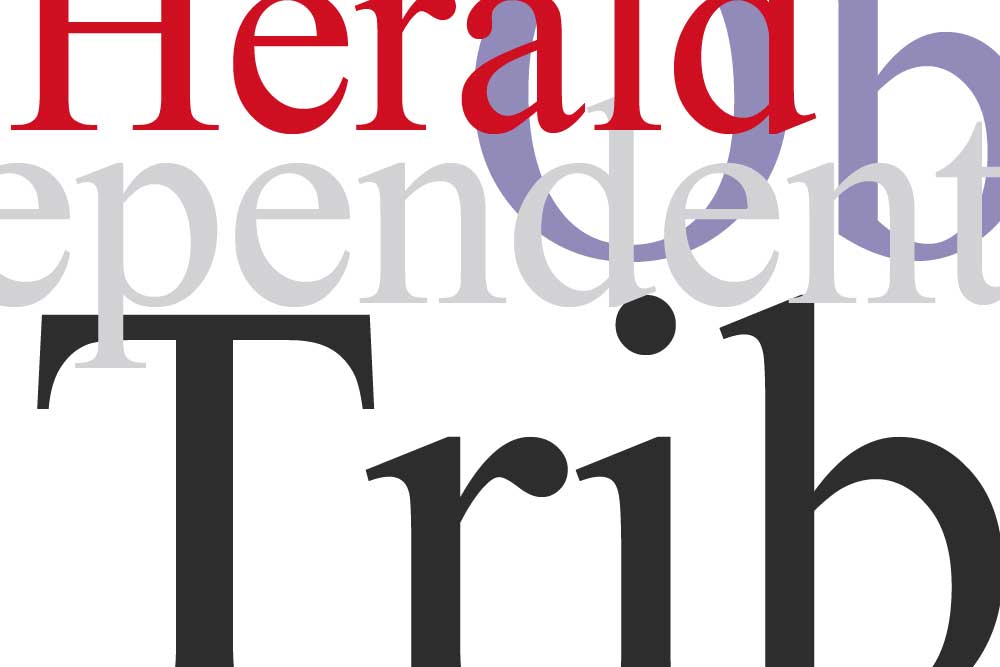









Keine Kommentare bisher