Manche schimpfen wie die Rohrspatzen, manche versuchen die anderen Kommentierenden auszuknocken, wieder andere fühlen sich übergangen und beklagen Nichtbeachtung. Manchmal wirken die Kommentare unter den Artikeln der L-IZ wie der Beginn einer Therapiestunde. Aber stets gibt es auch diese schönen Momente, wo uns ein nachdenklicher Kommentator ein bisschen klüger macht. Ein kleiner Schritt beiseite – und auf einmal sieht man etwas, was einem bei all der Aufregung fast entgangen wäre.
So wie gerade in der Diskussion zu unserem Artikel „Demo von Pandemie-Leugner/-innen: Ein fröhlicher Spaziertanz wie in der DDR“, zu dem „J.“ auf den Kommentar von „Frank“ so reagierte:
„Ich finde auch, den Sommer über wurde sehr viel demonstriert, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen diverser anderer Dinge. Ich denke, es könnte schlicht daran liegen, dass viele Menschen einsam sind, und bei so einer Demo ist es dann doch sehr gesellig. Manche werden auch versuchen, sich zu orientieren, und in so einer Menschengruppe mag man vielleicht eine solche Orientierung finden, wie auch immer diese dann aussieht (und wie andere die dann finden ist dann noch eine andere Kiste).
Vor allem wird jemand, der demonstrieren geht (für was auch immer, Klima, BLM, Corona oder Nichtcorona), zumindest eine kurze Zeit das Gefühl haben, aktiv etwas zu tun, also etwas gestalten zu können im Leben, in einer Zeit, wo man doch recht hilflos den Abläufen von Gesellschaft, Natur und Umwelt gegenübersteht und gegen solche Geschehnisse nicht wirklich viel tun kann. Dieses ,Nichts tun können‘ ruft sicher bei manchen dann Gefühle der Hilflosigkeit hervor.“
Ich halte das für eine gute These. Natürlich vermischt sich bei diesen Demos alles Mögliche, wirkt Corona wie ein Vorwand, als würde das in den Köpfen und Herzen dieser Menschen schön länger rumoren, schon länger ein Gefühl vor sich hinköcheln, man könne nichts tun. Man könne an den Dingen nichts ändern, habe keinen Einfluss auf das, was anderswo entschieden wird.
Die Corona-Schutzmaßnahmen wären dann nur der letzte Tropfen, der Auslöser, der dann auch noch eine ganz wunde Stelle traf.
Denn dass sich immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft zunehmend einsamer fühlen, ist ja keine Erfindung. Und das betrifft nicht nur die alten Leute oder die Singles. Es betrifft auch alle so bereitwillig Arbeitenden, die lieber Überstunden schrubben, als ihren Job zu riskieren. Es betrifft alle Menschen in wachsenden Leistungsanforderungen, die mit immer mehr Aufgaben zugeschüttet werden und sich zunehmend überfordert fühlen. Die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt zu.
Und mit Corona waren dann oft auch noch die wenigen sozialen Beziehungen gekappt, die manche Menschen überhaupt noch mit anderen verbanden. Da half auch kein Homeoffice, wo man dann die Chefs und Kollegen vielleicht mal in der Videokonferenz sah.
Und wie stark das Bedürfnis nach Menschen zu – auch körperlicher – Nähe zu anderen Menschen ist, wurde ja im Sommer sichtbar, als gerade junge Leute nach draußen drängten und sich aus Sicht der besorgten „Erwachsenen“ einfach unvernünftig benahmen und feierten.
Und jetzt die ganzen Hochzeiten und Familienfeiern, die zu neuen Super-Spreader-Ereignissen werden.
Aber schon Forschungen im 19. Jahrhundert hatten gezeigt, dass Menschen, die keine Kontakte mehr zu anderen Menschen haben, krank werden. Richtig krank. Wir brauchen diese Kontakte – nicht nur zum Kuscheln und Knuddeln, sondern auch um dieses elementare Gefühl zu bekommen, dass wir in unserer Gruppe akzeptiert sind, dass wir nicht ausgestoßen und verbannt sind.
Und wenn man darüber ein wenig nachdenkt, merkt man schnell: Das ist mit Corona für viele erst richtig deutlich geworden. Es war aber vorher schon da.
Denn eine Gesellschaft, die so beharrlich das Ego forciert und die Menschen zu Konkurrenten macht und alte soziale Gemeinschaften zerstört (wenn auch als Kollateralschaden), die produziert lauter „lonely people“, Menschen, die sich nirgendwo aufgehoben und geborgen fühlen. Nicht in einer Familie, schon gar nicht in einem Familienverband oder einer Dorfgemeinschaft. Denn nichts haben wir ja in den letzten Jahren so zerstört wie die Dorfgemeinschaften.
Und dazu kommt noch, was „J.“ ja auch andeutet: dieses Ohnmachtsgefühl. Diese stets anwesende Ahnung, dass man nicht einmal das eigene Leben im Griff hat und über die Dinge bestimmen kann, die es ausmachen. Denn auch die alten Versorgerstrukturen wurden ja gründlich ramponiert. Kaum einer lebt noch in einem Umfeld, von dem er sagen könnte: Das würde sich auch selbst versorgen und erhalten können, wenn die großen Konzerne und Verwaltungen zusammenbrechen.
Wir leben in einer Gesellschaft, die ganz unübersehbar in großen Teilen keine Gemeinschaft mehr ist. Und die auch nicht resilient ist, in keiner Dimension – nicht in der psychologischen, der sozialen und auch nicht in der ökologischen.
Und das spüren wir alle. Es ist permanent da als stille Angst, bei manchen auch als echte Zukunftsfurcht oder tiefsitzender Pessimismus. Denn wenn man so als kleiner Mensch gar nichts mehr machen kann, dann ist eh alles verloren. So fühlt sich das wohl an. Dann kann man nichts machen gegen die Klimaerhitzung, das Artensterben, die aufkommenden Autokraten, Pestizide, Waldzerstörung oder auch nur die Unvernunft der vielen anderen, die einfach so weitermachen in ihrem irrsinnigen Rennen nach Geld, Karriere, Macht und Geliebtwerden.
Und dann liest man diese kleine Meldung im „Spiegel“ über die Wahlempfehlung der „New York Times“ und merkt: Nein, so einsam und hilflos sind wir nicht wirklich.
Der „Spiegel“ zitiert dort die „New York Times“ mit den Worten: „Aber in der Politik geht es nicht um Perfektion. Es geht um die Kunst des Möglichen und darum, Amerika zu ermutigen, seine besseren Engel zu umarmen.“
Den orginalen Beitrag „Elect Joe Biden, America“ findet man hier.
Und die englische Version des Zitats: „Mr. Biden isn’t a perfect candidate and he wouldn’t be a perfect president. But politics is not about perfection. It is about the art of the possible and about encouraging America to embrace its better angels.“
Da steht tatsächlich „to embrace“, also zu umarmen. Solche Worte fallen einem auch als Journalist nicht zufällig ein. Es sind Worte, die summen die ganze Zeit im Hinterkopf. Journalisten sind ja auch nur Menschen, die auf Abstand bleiben müssen, Mund-Nasen-Schutz tragen und Menschenansammlungen meiden, wo es geht. Auch sie merken, dass Arbeit verdammt einsam machen kann, wenn man nicht mehr unter Menschen kommen darf.
Und natürlich sieht man dann auch die ganzen Menschenansammlungen um Trump etwas anders. Denn: Was ist stärker in dem Moment? Die Vernunft, die einem sagt, dass man da lieber nicht mittendrin sitzen sollte? Oder dieses kribbelnde Gefühl, wieder lauter Leuten nah zu sein, die man kennt, vielleicht sogar mag und lange nicht gesehen hat?
Gefühle, die jeder kennt.
Aus seiner Gruppe.
Denn auch wenn einem die Corona-Solidarität vernünftigerweise nur zu verständlich ist, ist das urmenschliche Bedürfnis des Menschen, anderen Menschen, die ihm vertraut und nah sind, auch wirklich nah sein zu dürfen, nicht einfach weg. Corona stellt unser Ellermentarstes auf eine harte Bewährungsprobe.
Gefühlsmäßig gibt es also eine Menge Gründe für Protest. Auch wenn der Protest dann eher von Hilflosigkeit erzählt, von diesem anderen Gefühl, auf die Welt, die einen umgibt, keinen Einfluss mehr zu haben. Oder zu wenig, weil viel zu viele Dinge irgendwo „da oben“ entschieden werden. Was ja keine falsche Wahrnehmung ist. Wir leben in lauter künstlich geschaffenen Systemen, in denen Entscheidungskompetenz und damit auch Macht extrem zentralisiert ist – und zwar sehr weit oben.
Es wird zwar gern von Subsidiarität gesprochen in der Politik – aber kaum etwas wird so ungern auch umgesetzt. Denn das hieße: Eigenverantwortung stärken, die Menschen dort wieder selbst entscheiden zu lassen, wo es um ihr direktes Lebensumfeld geht. Sie sehen schon: Das hat sehr viel mit Resilienz zu tun – und mit Dezentralisierung. Und mit Rückgabe und Teilung von Macht.
Und – das Wort muss hier natürlich fallen – Ent-Monopolisierung. Was eben nicht nur Monopol bedeutet, sondern auch Monotonie und Monokultur – ein Thema, das in einer der nächsten Buchbesprechungen eine Rolle spielen wird.
Denn warum verändern die Demonstrierenden nicht einfach die Welt bei sich zu Hause? Wäre das nicht der Ort, die Dinge zum Besseren zu wenden und sich zu engagieren? Ist dieses ewige Fordern von der Regierung nicht eine heftige Schippe sehr kindisch? Als wären wir alle unmündige Untertanen, die heute eben Plakate hochhalten, statt Eingaben ans ZK zu schreiben?
Und sich so seltsam in ihren Freiheitsrechten beschnitten sehen. Geht es wirklich darum? Ist das wirklich das Problem unserer Ego-Gesellschaft, dass jeder meint, sich permanent gekränkt und eingeschränkt fühlen zu müssen? Fehlt da nicht etwas?
Möglicherweise genau das, was die „New York Times“ auch beim Super-Egomanen Trump vermisst: die Fähigkeit zu Empathie und Kooperation.
So funktioniert Demokratie nun einmal nicht, so geht sie kaputt.
Bei Biden sieht die NYT diese Fähigkeit zu einem anderen Miteinander, das auch einstige Gegner mitnimmt: „His campaign has been reaching out to a wide range of thinkers, including former rivals, to help craft more dynamic solutions.“ Also Potenziale heben, die ja da sind: So ein Land kann man nur gemeinsam auf Vordermann (oder Vorderfrau) bringen.
Aber es hört sich eher nicht nach Blümchen und Yoga an, sondern nach schweineviel Arbeit, zähem Verhandeln und vielen frustrierenden Gesprächen mit Leuten, die gelernt haben, dass ihr Ego wichtiger ist als das Wohlergehen der Gemeinschaft.
Die – das muss man zugeben – nun einmal in den meisten Fällen ziemlich demoliert und entsolidarisiert ist. Und nebenbei: völlig von der Rolle und immer öfter zutiefst beleidigt ist. Immerfort gekränkt, wie es der Philosoph Jürgen Große in seinen Büchern „Der gekränkte Mensch“ analysiert hat.
Aber wie frei können permanent gekränkte Menschen eigentlich sein in der Welt, wenn jedes Nichtgeliebtwerden neue Kränkungen hervorruft?
Nur so als Frage.
Ein Philosoph im Großstadtdschungel: Jürgen Großes „Der gekränkte Mensch“
Ein Philosoph im Großstadtdschungel: Jürgen Großes „Der gekränkte Mensch“
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
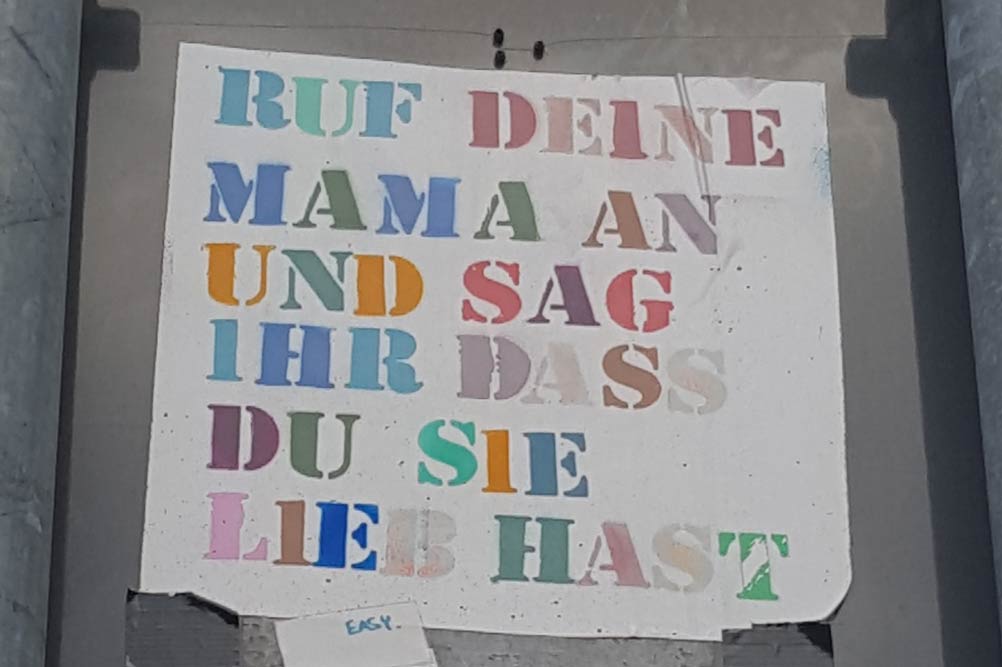










Keine Kommentare bisher