Während diese Zeilen entstehen, geht die Münchner Sicherheitskonferenz 2022 zu Ende – das seit 1963 existente Format findet diesmal ohne offizielle Delegation aus Russland statt. Und angesichts einer mächtigen Zusammenballung russischen Militärs nahe der Grenze zur Ukraine scheint der für die meisten von uns so selbstverständliche Zustand des Friedens in Europa fragil wie nie.
Jenseits der aktuellen Krise mit ihrem ungewissen Ausgang – eine schnelle Lösung, welche die Konfrontation entspannt und zugleich gesichtswahrend für die Konfliktparteien wirkt, scheint nicht in Sicht – könnte der momentane Zustand Anlass bieten, ein paar Gedanken spielen zu lassen: Ist der jetzt drohende Krieg vielleicht mehr als nur ein Betriebsunfall im Lauf der Geschichte? Stellt er ein Symptom tieferliegender Probleme dar, mit deren Folgen westliche Staaten in Zukunft öfter konfrontiert sein werden?
Mit anderen Worten: Wohin driftet die westliche Staatengemeinschaft eigentlich und muss sie sich in Zukunft öfter auf weltpolitische Kraftmeierei einstellen, so wie jetzt? Und welche Auswirkungen könnte das auf uns haben?
Der Kalte Krieg und die eiserne Scheinstabilität
Niemand von uns kann die Zukunft vorhersehen. Doch um einer Antwort auf derlei Fragen zumindest näherzukommen, lohnt sich ein Rückblick in die Historie. Schaut man auf die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, so wurde die internationale Ordnung seinerzeit wesentlich durch zwei Militärblöcke geprägt, die NATO unter US-Führung und dem Warschauer Pakt unter sowjetischer Hegemonie.
Über mehrere Dekaden war es die Logik der wechselseitigen Abschreckung, die im Kalten Krieg paradoxerweise für eine gewisse Stabilität zwischen den Lagern sorgte: Jeder Angriff auf den anderen Block, so die Überlegung, würde einen noch folgenreicheren Vergeltungsschlag des hochgerüsteten Gegners nach sich ziehen.
Man musste dieses System nicht mögen – doch man konnte sich mit ihm arrangieren, zumal gerade in den Staaten des Westens, bei allen Unterschieden zwischen ihnen, unter der Decke des militärischen Patts doch ein wachsender Wohlstand gedeihen konnte.
Das „Wirtschaftswunder“ der alten Bundesrepublik, das eigentlich – oh Wunder – kein Wunder war, ist für die Deutschen vielleicht das geläufigste Beispiel. Auch die Unsicherheiten und Verwerfungen seit den siebziger Jahren mit dem Ende des Booms und den Ölkrisen änderten an Prosperität und Konsumverhalten, ganz allgemein gesprochen, eher wenig.
Illusionen vom „Ende der Geschichte“
Schlagartig änderte sich die Lage mit dem Kollaps der Sowjetunion. Das überdehnte Imperium konnte seine eigenen Kosten am Ende nicht mehr decken, das Wirtschaftssystem war marode und schwach, ein Großteil der Bevölkerung lebte in Armut. Mit ihrer völkerrechtlichen Auflösung Ende 1991 verschwand die vermeintliche Supermacht endgültig in der Geschichte. Die USA, Symbol für schier grenzenlose Freiheit und das westlich-liberale Staatsmodell, gingen in der allgemeinen Wahrnehmung als Sieger aus dem Ost-West-Konflikt hervor.
Die Folge: Nicht wenige Menschen glaubten, dass das Ende der Sowjetunion und des Ostblocks zugleich den automatischen Siegeszug von Demokratie, Rechtsstaat und freier Marktwirtschaft mit sich brächte. Diesen allgemeinen Optimismus der neunziger Jahre verkörperte vor allem der US-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama mit seinem Buch The End of History and the Last Man – ja, das „Ende der Geschichte“, Sie haben richtig gelesen, war in dieser Lesart gekommen. Es wurde geradezu zum geflügelten Wort.
Zwar werde es demnach weiterhin Kriege und Konflikte geben, aber auf Dauer gäbe es keine Alternative zum westlichen Modell, denn nur dieses könne die Sehnsucht nach einer Existenz in Frieden, Wohlstand, Sicherheit und Selbstbestimmung erfüllen.
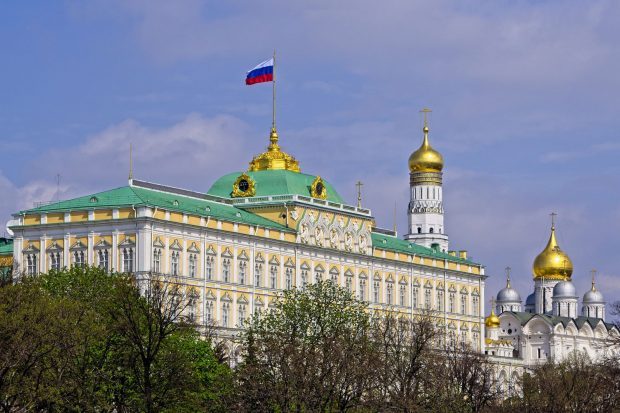
Neue Player auf der Bühne
Welch westliche Hybris, möchte man heute meinen. Zur Ehrenrettung Fukuyamas sei gesagt, dass er selbst seine These in den letzten Jahren zumindest stark relativiert hat, heute gilt sie generell als überholt. Ob China, Russland, die Türkei, Singapur oder andere – die Realität bewies, dass Wirtschaftswachstum auch ohne Menschenrechte und freiheitliches System vonstattengingen.
Zudem offenbarten sich neue Herausforderungen für den Westen, von denen die terroristische Bedrohung nur ein Beispiel darstellt. Die Anschläge am 11. September 2001 in den USA, die darauf folgenden Kriege gegen den Irak und Afghanistan, welche millionenfaches Leid hervorriefen und zudem schlicht zermürbend waren – all dies ließ die Risse im Gefüge einer westlich geprägten Weltordnung immer stärker hervortreten.
Parallel dazu drängten auch Staaten wie China und Russland immer mehr auf die Weltbühne. Peking präsentierte sich bereits bei den Olympischen Sommerspielen 2008 als starker Player, Russland profitierte von hohen Rohstoffpreisen.
Als Moskau im Sommer 2008 in Georgien intervenierte und Teile von dessen Territorium einnahm, vermochte der Westen dem nichts entgegenzustellen. Auch mit dem Konflikt um die Ukraine bereits vor acht Jahren und der Krim-Annexion wurden die USA und ihre Verbündeten letztlich überrumpelt.
Zerwürfnisse im Westen
Hinzu kamen die immer stärkeren Gräben innerhalb des Westens, die sich in den Krisen um das Finanzsystem, den Euro und die eigene Wirtschaft offenbarten. Augenfällig wurden die Zerwürfnisse besonders im Sommer 2015, als auf einmal viel mehr geflüchtete Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Afrika Richtung Europa drängten als all die Jahre zuvor.
Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Regierung sahen sich dem Vorwurf europäischer Partner ausgesetzt, eigenmächtig und ohne Rücksprache eine Entscheidung zur Aufnahme der Menschen getroffen zu haben. Die deutsche Strategie, zunächst Zeit zu gewinnen und dann eine gesamteuropäische Lösung auszuhandeln, schlug damals fehl.
Daneben zeigte sich auch die Rückkehr nationalistischer und rechtspopulistischer Tendenzen. Schien das Brexit-Referendum von 2016 noch irgendwie verkraftbar – manche kommentierten, mit ganzem Herzen hätten die Briten sowieso nie zur EU gehört – so war die Wahl Donald Trumps in den USA mit seinem „America first“ offensichtlich ein weiteres Symptom der Entzweiung.
Hatten sich bereits unter Trumps Vorgänger Barack Obama Risse in der transatlantischen Allianz gezeigt, die den Streit um die Verteidigungsausgaben betrafen, so wurde die damalige Kanzlerin Merkel 2017 in ihrer aufsehenerregenden Münchner Rede sehr deutlich, als sie die Europäer dazu aufrief, ihr Schicksal mehr in die eigene Hand zu nehmen: „Die Zeiten, in den wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei.“
Der „Abstieg des Westens“
Zugegeben, es ist schwer nachzuweisen, inwieweit diese Signale aus dem Westen unmittelbar zu einer aktiven Kräfteverschiebung in der Weltpolitik führten. Ersichtlich ist aber doch, wie eine alte Ordnung an ihr Ende gekommen schien und im Zustand der Fragilität nicht nur Russland und China, sondern auch kleinere Player wie Saudi-Arabien, die Türkei, Indien oder Brasilien an der Ausweitung ihres Einflusses arbeiteten.
Angesichts der hier nur sehr grob skizzierten Entwicklungen seit dem Mauerfall macht schon seit Jahren der mögliche „Abstieg des Westens“ die Runde. In seinem gleichnamigen Buch vor wenigen Jahren sprach der deutsche Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne) auch nüchtern aus: „Die Sowjetunion kollabierte, der Westen hingegen steigt ab, Schritt für Schritt.“
Krise festigt Zusammenhalt
Als dieser Text zu seinem Abschluss kommt, schwelt die Krise weiter, in der es längst um mehr als nur die Ukraine geht. Immerhin: Leichte Hoffnung, die – vermutete, von Moskau dagegen bestrittene – Invasionsabsicht seitens Russlands zu ändern, keimt auf, weil Bereitschaft zu einem Gipfeltreffen zwischen Wladimir Putin und seinem US-Kollegen Joe Biden angesetzt worden ist.
Und außerdem haben die Bewegungen des russischen Militärs dazu geführt, dass die Reihen im westlichen Bündnis wieder geschlossener auftreten, was eben auch die USA unter Biden mit einbezieht. Ob das aber auch dauerhaft eine Rückkehr des Westens mit sich bringt, bleibt eher zweifelhaft.
2022 als Wegscheide und Weckruf?
Und um damit auf die Ausgangsfragen einzugehen: Nein, was wir jetzt sehen, ist kein Zufall und kein Betriebsunfall der Geschichte. Vielmehr – so sehen es jedenfalls manche Kommentatoren dieser Tage – könnten wir in der Welt auf eine neue Ära von Anarchie und Regellosigkeit zusteuern, was angesichts wirtschaftlicher Verflechtungen auf dem Globus auch fatal für unseren immer noch scheinbar selbstverständlichen Wohlstand sein könnte.
Komplett teilen muss man die pessimistischen Prognosen nicht. Vielleicht wird das Jahr 2022 auch als Weckruf in die Geschichte eingehen, als der Westen zusammenrückte, weil er seiner eigenen Verwundbarkeit und Erpressbarkeit wie nie zuvor gewahr wurde. Es ist Aufgabe der Politikerinnen und Politiker, diese Erkenntnis in eine vernünftige Politik zu übersetzen.
Eine Frage der Zeit
Keine Frage, das braucht Zeit, Zusammenhalt angesichts einer antizipierten Bedrohung allein reicht nicht aus. Das globale Kräftespiel hat sich gewandelt und dies wird sich, auch das scheint sicher, nicht so schnell ändern. Von einer „neuen Weltordnung“ zu reden, ist gar nicht so unzutreffend – wobei dieser Terminus durch Verschwörungsideologien stark überzeichnet ist.
Fest aber steht: In der Welt von morgen sind Vertrauen und kooperative Beziehungen nötiger denn je, wenn die Menschheit die sie insgesamt betreffenden Fragen – Klimawandel, Migrationsbewegungen, Umweltzerstörung, künftig mögliche Pandemien und vieles mehr – vielleicht irgendwie in den Griff bekommen will. Gerade hier wird der Westen auch künftig gefragt sein. Schauen wir nach vorn: Ein Zurück in die Gemütlichkeit von früher – die es so übrigens auch nicht gab – ist ausgeschlossen.
„Krisen und kein Ende: Wohin driftet der Westen eigentlich?“ erschien erstmals am 25. Februar 2022 in der aktuellen Printausgabe der Leipziger Zeitung (LZ). Unsere Nummer 99 der LZ finden Sie neben Großmärkten und Presseshops unter anderem bei diesen Szenehändlern.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:























Keine Kommentare bisher