Natürlich darf man sich ärgern, wenn man in deutsche Buchhandlungen geht. Richtig laut, denn was da das Angebot dominiert, ist in manchen Monaten einfach nicht mehr auszuhalten. Massenware stapelweise. Vielfalt? Fehlanzeige. Das betrifft auch das feine, liebevolle Segment der englischen Literatur. Früher war das mal in Verlagen wie Haffmans zu Hause. Ein Bursche namens Kipling zum Beispiel.
2001 meldete Gerd Haffmans Konkurs an für seinen Verlag, in dem auch liebevolle Neuübersetzungen der großen Alten der englischen Literatur erschienen – neben Arthur Conan Doyle und Laurence Sterne eben auch Kipling – in der farbenfrohen Übersetzung von Gisbert Haefs. Die Titel tauchen heute in anderen Reihen in anderen Verlagen ab und zu wieder auf – aber nicht alle. Haffmans Erbe ist wie ein großes Bergwerk. Manches darin blieb aber unbeendet – so wie die engagierte Kipling-Ausgabe.
Aber wer interessiert sich schon für Kipling, könnte man fragen. Ist der nicht endgültig im “Klassiker”-Regal gelandet und damit tot? Wer liest noch “Klassiker”?
Kinder tun es. Denn wer in seinem frühen Lesealter nicht Mowgli in den Dschungelbüchern begegnet ist, der hat was verpasst.
Anglisten lesen ihn – das sind die Wissenschaftler, die sich ganz speziell mit der englischen Literatur beschäftigen. An der Uni Leipzig sind sie ganz stark. Jüngst hat sich Maria Fleischhack mit einer anderen Legende der englischen Literatur beschäftigt: Sherlock Holmes.
Jetzt hat Prof. Stefan Welz seinen “Klassiker” am Schlafittchen gepackt. Zu seinem Lehrstoff gehört Rudyard Kipling schon lange. Er unterrichtet Englische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Da kommt man an Kipling nicht vorbei. Und auch nicht an der Tatsache, dass es bislang keine deutsche Kipling-Biografie gab. Im englischsprachigen Raum gibt es dutzende. Und die Briefe. Und mehrere Werkausgaben und literaturwissenschaftliche Arbeiten. Vielleicht sind es nur die Deutschen, die so närrisch sind, dass sie jeden Autor, der länger als 10 Jahre tot ist, ins “Klassiker”-Regal abschieben. Das Ergebnis ist, dass von den großen Alten immer wieder dieselben Titel dort herumstehen – eine aktuelle Auseinandersetzung aber nicht mehr passiert. Dafür heißen im platzenden Belletristikregal mittlerweile die meisten Autoren Jones, Miller, Williams, gibt es dieselben bräsigen Stoffe in unzähligen ungenießbaren Varianten.
Dabei gibt es auch und gerade bei den Alten jede Menge zu entdecken. Und Kipling ist selbst heute kein Alter, auch wenn Mowgli auch schon 120 Jahre auf dem Buckel hat und keine Notiz zu Kipling ohne den Verweis auf seinen unübersehbaren Imperialismus auskommt. Auch Welz kommt um das Thema nicht herum. Aber man begreift Autoren nun einmal nur, wenn man sie in ihrer Zeit sieht, in ihrem Lebensumfeld und in ihren Themen.
Kann man Kipling seine imperialistischen Töne ankreiden? Kann man. Wenn man ignoriert, dass der englische Imperialismus bis 1902 die vorherrschende Geisteshaltung im Empire war, die große politische Politur, mit der das damals mächtigste Weltreich sich sonnte im Glanz seiner Macht. Kipling erlebte ja weite Teile seiner Kindheit in Indien, der damals wertvollsten englischen Kolonie. Und zeitgleich dominierte der Traum von der imperialen (Welt-)Herrschaft auch in anderen Ländern. In Deutschland nahm er mit der Reichseinigung von 1871 preußisch-kriegerische Züge an, die auch die deutsche Literaturelite vorm 1. Weltkrieg in imperialistischen Tönen schwelgen ließ. Auch Frankreich war – trotz der 1871er Niederlage – nicht frei von imperialem Gedöns. Noch hatte man auch dort gewaltige Kolonien. Und die Konkurrenz mit dem aufstrebenden Deutschen Reich bestimmte die Berichterstattung immer mehr, die Töne verschärften sich, die Rüstung wurde angekurbelt. Und bei seinen Reisen in die USA konnte auch Kipling entdecken, dass mit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 auch die USA begannen, sich als imperialistische Macht zu definieren.
Dass man die meisten Bücher, die in diesen Tonlagen geschrieben wurden, heute in keiner normalen Bibliothek mehr findet, hat auch damit zu tun, dass dieses Denken in den meisten Ländern spätestens seit der Katastrophe des 1. Weltkrieges in Verruf gekommen ist. Unlesbar ist das Meiste eh.
Literarischer Rabauke
Und deshalb ist es umso überraschender, dass gerade Kipling noch präsent ist. Und zwar nicht nur mit den beiden Dschungel-Büchern, die ihn weltweit berühmt gemacht haben, sondern auch mit zahlreichen Erzählungsbänden aus seiner Frühzeit, mit dem großen Indien-Roman “Kim” oder seinen launigen “Genau-so-Geschichten”. Denn der junge Autor, der in einem weltumspannenden englischen Empire nicht nur die Zukunft sah, sondern auch die Grundlage für den zivilisatorischen Fortschritt, war auch gleich mit seinen frühen Geschichten ein moderner Erzähler. Einer, der im viktorianisch geprägten London anfangs durchaus als literarischer Rabauke, regelrecht als Hooligan betrachtet wurde.
Seine Geschichten, die sich nicht nur am reichen Reservoir der als durchaus exotisch empfundenen Welt des kolonialen Indiens bedienten, sondern auch freimütig mit dem Slang der Einwohner und der britischen Soldaten umgingen, wirkten auf die Einen wie ein Frontalangriff auf die dominierende, ästhetisierende Literatur der Zeit, auf die anderen erfrischend neu, lebendig, phantastisch und ehrlich. Denn Kipling hatte keine Scheu, auch die einfachen Soldaten, Dienstboten, Arbeiter und Dirnen auftreten zu lassen. Berührungsängste kannte er nicht. Im Gegenteil: Nicht umsonst gelang es seinem Vater, den 17-Jährigen schon bei einer der maßgeblichen englischsprachigen Zeitungen in Indien unterzubringen: Der junge Mann konnte plastisch beschreiben, beherrschte die lebendigen Dialoge, und was er noch nicht konnte, lernte er in der direkten journalistischen Praxis, wo er oft genug übers Ziel hinausschoss und Kontroversen auslöste.
Imperiale Visionen
An mehreren Stellen des Buches versucht Stefan Welz, das nicht ganz so einfache Verhältnis von Kipling zum Empire zu klären. Und das gelingt ihm auch recht anschaulich. Denn wenn wir ehrlich sind, dann ist auch unsere Gegenwart im 21. Jahrhundert noch immer vom imperialen Weltverbesserungsdenken des 19. Jahrhunderts geprägt. Es schwingt auch in der täglichen Berichterstattung noch mit, dass man sich aus eurozentristischer Sicht noch immer als Zivilisationsbringer begreift, als Vertreter einer höheren technischen und politischen Kultur. Eine Grundhaltung, die mit verantwortlich ist dafür, dass es keine Kommunikation auf Augenhöhe mit all den Ländern gibt, die wir heute so snobistisch Dritte Welt, Schwellenländer, Entwicklungsländer oder ähnliches bezeichnen.
Die Wahrheit ist: Es steht uns nicht zu, Kipling für seine imperialen Visionen zu verurteilen. Er hat sie nur laut und unzensiert veröffentlicht. Und die damalige Presse, auch die damalige Regierung, nahm diese Schützenhilfe eines Autors, der den weißen Mann als großen Zivilisationsbringer feierte, dankend an.
Der Bruch kam erst mit dem 1. Weltkrieg. Einen ersten Riss gab es schon im zweiten Burenkrieg von 1899 bis 1902, als den Briten in Südafrika die Grenzen ihrer Herrlichkeit gezeigt wurden und Lord Kitchener als blutiger Schlachter in die Geschichtsbücher einging. Das waren die Jahre, mit denen die Glorifizierung des British Empire, die das ganze lange Viktorianische Zeitalter dominierte, einen Knacks bekam. Und das blutige Gemetzel des 1. Weltkrieges war zumindest in England eine Zeitenwende. Danach fielen die alten imperialen Töne Kiplings, der noch immer glaubte, es wären die englischen Ingenieure, Erfinder, Offiziere und Kolonialbeamten, die berufen wären, eine weltumspannende Zivilisation nach englischem Muster zu schaffen, sehr unangenehm auf. Welz beschreibt es als Niedergang, den der alternde Autor noch zu Lebzeiten miterlebte.
Aber tatsächlich konnte Kipling immer dann an seine besten Geschichten anknüpfen, wenn er sich wieder auf das reiche Material seiner Kindheit und Jugend beziehen konnte, das zwar immer in die Erfahrungen des englischen Kolonialreiches eingebettet war – aber das auch immer von der intensiven Begegnung der Kulturen berichtet, der Faszination des Anderen, der fremden Lebenswelt und der fremden Religion. Tatsächlich hat er mit seinen Geschichten den Reichtum der Welt in die englischen Lesestuben gebracht. Und seine besten Geschichten schlagen Brücken, nehmen die Leser in diese Welt mit, die sich aus anderen Traditionen, einer anderen Geschichte, anderen religiösen und kulturellen Wurzeln speist.
Welz geht auf mehrere Widersprüche in Werk und Leben Kiplings ein. Der wesentliche ist für ihn, dass dieser Mann, der in seiner imperialen Denkweise im hohen Alter wie ein Fremdkörper wirkte in seiner Heimat England, dennoch einer der modernsten und lebendigsten Erzähler der Zeit war, Vieles vorweg nahm, was sich erst Autoren der nächsten und übernächsten Generation an neuen Erzählweisen aneigneten.
Und es ist diese ursprüngliche Neugier, die seine (guten) Geschichten so vielschichtig und lebendig macht. Und dort ist sie auch immer mit dem Respekt vor seinen Figuren verbunden, auch wenn er die “Macher” stets besonders ehrfürchtig schildert – auch das ein Wesen der Zeit, die gerade besessen war vom Glauben an die Technik und die Wunder der Zivilisation. Immerhin waren es die Kolonialmächte, die überall, wo sie tätig waren, Eisenbahnstrecken bauten, Staudämme und gigantische Kanäle. Der imperialistische Zugriff auf die Welt war – neben dem kriegerischen – auch immer ein technischer und ein wirtschaftlicher, denn am Ende ging es immer um “Märkte”, Rohstoffe und billige Arbeitskräfte.
Und auch da sollten wir ehrlich sein: Daran hat sich bis heute auch nichts geändert.
Nur dass die Apologeten dieses Denkens heute nicht mehr so offen schwadronieren würden, wie es Kipling in seinen, vor allem politischen Artikeln, Gedichten und Geschichten tat. Die Entfremdung von seinen Lesern passierte – ausgelöst durch die englischen Kriegserfahrungen – eher schleichend. Und der gealterte Kipling, der sich eher den (alten) Eliten zugehörig fühlte, machte die Entwicklung nicht mehr mit. Das ist seine Tragik.
Aber gerade das macht die Lebendigkeit seiner frühen Geschichten und auch noch einige seiner späten so verblüffend. Seine Fähigkeit, mit Phantasie und Atmosphäre zu erzählen, hat er nie verloren. Es ist eher eine Aufgabe für Literaturdetektive, herauszufinden, warum er nach 1918 die Kurve nicht mehr kriegte, welche Rolle dabei seine persönlichen, teils sehr leidvollen Erfahrungen spielten, seine Freunde und jene Menschen, die er vielleicht dafür halten wollte, denn als berühmter Autor war er auch eingewoben in die Welt der Mächtigen seiner Zeit.
Manches ist nicht mehr zu entschlüsseln, weil er im hohen Alter selbst daran ging, die Dokumente seines Lebens zu vernichten, um die Deutungshoheit über seinen Nachruf zu behalten. Auch das ist verständlich, aber eben auch ein Grund dafür, dass sich Forscher an ihm die Zähne ausbeißen.
Da aber die Forschung in den englischsprachigen Ländern trotzdem weiterging, kann Stefan Welz auf eine Menge Material zurückgreifen, mit dem er das Leben dieses Autors neu beleuchten kann, einige Fragen beantworten, andere zumindest andeuten kann. Und am Ende steht natürlich die Erkenntnis, dass weder dieser Autor ins “Klassik”-Regal gehört, noch das Denken seiner Zeit so tot ist, wie gern behauptet wird. Die Tragik dabei war eher, dass keine der damaligen imperialen Mächte jemals eine ehrliche gesellschaftliche Debatte über das imperiale Erbe geführt hat. Bis heute nicht. Und das ist leider die Ursache für viele Flächenbrände, die uns heute so beschäftigen.
Stefan Welz “Rudyard Kipling. Im Dschungel des Lebens“, Lambert Schneider, Darmstadt 2015, 29,95 Euro
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
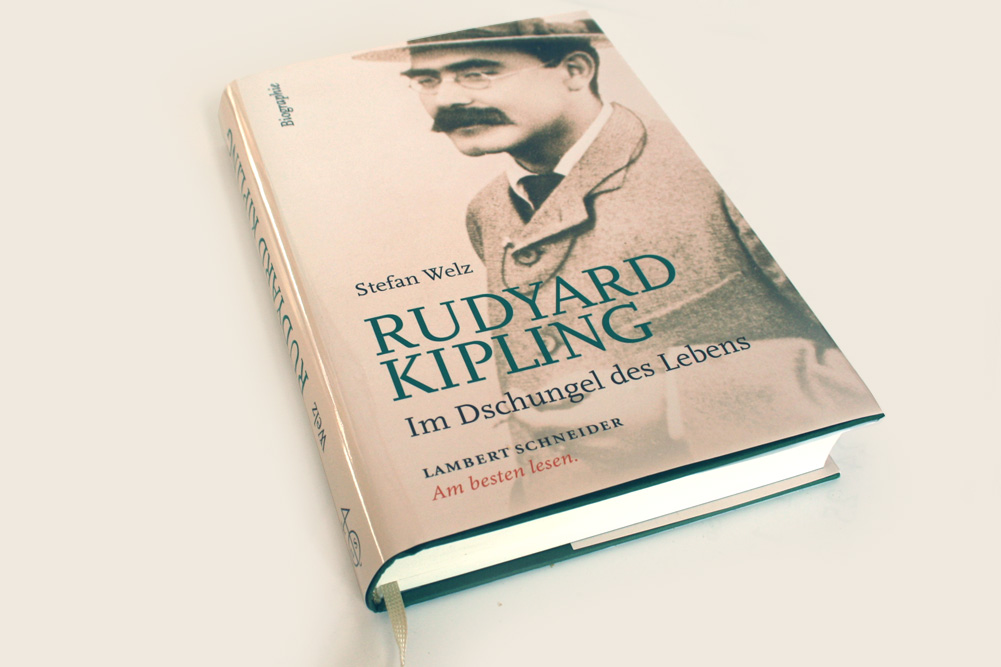











Keine Kommentare bisher