Upps, da ist man beim Hineinlesen doch erst einmal erstaunt: Den Ton kennst du doch? Dieser Sound klingt vertraut. Zumindest, wenn man die Bücher Selma Lagerlöfs kennt, nicht nur den „Gösta Berling“ und den „Nils Holgersson“. Aber auch da taucht man ein in diesen erzählerischen Sound, der selbst einem Roman etwas Sagenhaftes gibt. Und der Untergang der „Vasa“ ist ja schon ganz von allein sagenhaft.
Am 10. August 1628 sank das damals größte Schiff seiner Zeit gleich nach der Ausfahrt aus dem Mälarsee in die offene Ostsee. Ein einziger Windstoß genügte, um dieses mit 64 Kanonen bewaffnete Prachtschiff umkippen und sinken zu lassen. Über 300 Jahre lag die „Vasa“ auf dem Grund der See, bevor sie aufwendig geborgen wurde und heute im Vasa Museum bewundert werden kann. Eigentlich das herrlichste aller Kriegsschiffe, weil es niemals in einem Krieg zum Einsatz kam.Erstaunlich ist natürlich trotzdem, dass sich die portugiesische Autorin Cristina Carvalho des Stoffes angenommen hat. Und das in jenem erstaunlichen Sound, der einem von Lagerlöf her so vertraut klingt. Was schon verblüfft: Geht das überhaupt? Denn das Schwedische hat ja eigentlich einen völlig anderen Klang als das Portugiesische.
Und trotzdem erweckt diese Übersetzung ins Deutsche alte, wohlige Gefühle, als würde man sich mit Lagerlöfs „Der Kaiser von Portugallien“ (auch als „Jans Heimweh“ im Antiquariat zu finden) in seinen Lesesessel setzen und eintauchen in die Welt eines dicht und bedeutungsvoll geschilderten Nordens, in dem die Natur gleich vor der Hütte des alten Kaufmanns beginnt und alte Bräuche sich mit protestantischer Frömmigkeit verbinden.
Ein wenig hat das, wie es aussieht, mit der doppelten Liebe der Autorin zur portugiesischen und zur skandinavischen Küste zu tun. Aber nicht nur. Denn gerade diese Geschichte aus dem schwedischen Sommer 1628, die eben nicht nur die Geschichte des klugen Katers erzählt, der hier zum stillen Lebensretter wird, ist auch die Geschichte einer großen Liebe.
Aber eben keiner ungewöhnlichen. Das überrascht ja auch in Selma Lagerlöfs Erzählungen, dass ihren Heldinnen und Helden „nichts besonderes“ sind, ganz normale Menschen aus zumeist weltabgelegenen schwedischen Nestern: Pfarrer, Holzfäller, Dientsmägde, Prostituierte, eigentlich die ganz normale schwedische Lebenswelt abseits des glänzenden Stockholm um 1900 oder noch etliche Jahre und Jahrhunderte davor.
Denn wenn man an das heutige Schweden denkt, hat das wenig bis nichts mit dem alten Schweden zu tun, das Lagerlöf und auch Strindberg noch erlebten – Strindberg mit einer riesigen Portion Wut im Bauch, weil ihm das alte, bäuerliche und christlich vermuffte Schweden einfach nur auf die Nerven ging und allen seinen Vorstellungen von Emanzipation widersprach.
Während Lagerlöf dieses alte Schweden ja in der Regel mit Liebe beschrieb. Ein Schweden, das selbst zu Ingmar Bergmans Zeiten noch nicht völlig verschwunden war. Das war ja das Genie Bergmans: Sichtbar zu machen, wie lange sich altes, beklemmendes Standesdenken und Geschlechterdenken erhalten könnte selbst in einem Land, das seinerzeit in Europa als freiestes und sexuell experimentierfreudigstes galt.
Davon erzählt Carvalho natürlich nicht. Obwohl sie sich natürlich mit Bergman beschäftigt hat. Und natürlich auch mit Lagerlöf.
The Vasa Museum – promotional film
Und das bis heute Faszinierende an Lagerlöf ist ja ihre hohe Kunst, das Einfache und Alltägliche, das, was die ganz gewöhnlichen Leute in den ganz gewöhnlichen kleinen Orten im Hinterland als Lebensdrama erleben, mit einer Liebe zur seelischen Genauigkeit zu erzählen, die einen als Leser eintauchen lässt in eine dicht erzählte Landschaft, die einem schon nach wenigen Sätzen zutiefst vertraut wirkt. Ganz so, als könnte es einen, wenn man jetzt aus dem Buch auftaucht, genau dorthin verschlagen.
So, wie es in dieser Geschichte den Weber Elvis aus dem im hohen Norden gelegenen Kiruna nach Uppsala verschlägt, das in dieser Geschichte keine stolze schwedische Universitätsstadt ist, sondern eigentlich nur ein kleines Dorf, vielleicht ein bisschen größer als Kiruna, wo die Väter ihre Töchter verstecken, weil die Mädchen dort in menschenarmer Gegend hochbegehrt sind als Bräute. Also geht Elvis los, um sich anderswo eine Frau zu suchen. Und selbst wie er sie in Uppsala findet und bei ihrem Vater um Agnetta wirbt, ist eine Geschichte, die alles Zeug dazu hat, noch Generationen in der Familie weitererzählt zu werden – mit einem Bären darin, einem weißen Uhu und dem alten Anders, der den jungen Man aus dem Norden lieber erst einmal auf eine Mutprobe in den Wald schickt.
Denn wer seine kluge Tochter Agnetta haben möchte, muss schon beweisen, dass er es auch mit einem Bären aufnehmen kann. Wobei die Geschichte auch hier in jenen stillen Raum ausläuft, in dem man nicht recht weiß: Ist das jetzt wirklich passiert? Oder tauchen die Tiere eher wie in indianischen Erzählungen auf: als Symbol, geistige Gefährten? Steckt in den Menschen nicht die Aura der Tiere?
Nuja, nee, sagt das moderne Denken. Seit wir mit den Tieren so lumpig umgehen, wie wir das seit 200 Jahren tun, dürfte das eigentlich nicht mehr der Fall sein. Keiner von uns lebt mehr so im Einklang mit der Natur. So gesehen ist es eine doppelte Sehnsuchtsgeschichte, die Carvalho hier erzählt. Eine, in der nicht nur die Lagerlöfsche Freude am phantasievollen Erzählen steckt, sondern auch die einstige Nähe der Menschen zur lebendigen Natur, als in der Angst und Ehrfurcht vor den tiefen Wäldern auch die Achtung vor den darin lebenden Lebewesen steckte. Man wusste noch um seine Abhängigkeit und war entsprechend ehrfürchtig der Mitwelt gegenüber.
So gesehen ist aber auch die „Vasa“, deren erste Ausfahrt die Menschen in Carvalhos Geschichte nach Stockholm pilgern lässt, ein Symbol – auch für den Bruch mit der Natur und für die menschliche Hybris, die die Naturgesetze missachtet. Und dabei wollen Elvis und Agnetta ja tatsächlich mitfahren auf diesem riesigen Schiff, ihr Leben in der Hütte in Uppsala hinter sich lassen.
Hier wird das Schiff zum Symbol einer neuen Zeit, ein Aufbruch zu neuen Horizonten, hinaus auf das Meer, das in den Augen der beiden Wandernden noch voller Sagen und Wunder ist, so groß und unendlich, dass sie sich auch das Leben auf einem Schiff nur märchenhaft ausmalen können.
Dass das nicht einmal auf der gerade fertiggestellten „Vasa“ so war, erzählt Cristina Carvalho ganz am Ende ihrer Geschichte, nachdem sie den Schock geschildert hat, der die Schaulustigen am Ufer erfasste, als das Schiff vor ihren Augen versank. Nur erzählt sie die Geschichte eben nicht, wie sie heutige Boulevard-Medien erzählen würden mit ihren vollkommen falschen Vorstellungen von Drama und Dramaturgie.
Denn so geschehen die Dinge im Leben der meisten Menschen nicht. Oft setzt die Verblüffung sogar erst viel, viel später ein, wenn sie tatsächlich begreifen, was sie erlebt haben. Und an diesem Tag haben Agnetta und Elvis tatsächlich eine viel größere Aufregung, weil ihr Kater, den Elvis extra im Korb mitgebracht hat aus Uppsala, verschwunden ist. Finde man mal einen Kater in so einer Stadt wie Stockholm.
Allein schon diese Verschiebung lässt ahnen, dass wohl die meisten Dinge, die uns die Boulevard-Korrespondenten als wichtig und sensationell zu verkaufen versuchen, eigentlich nicht die Rolle erfüllen, die ihnen die Sensationsmacher zuschreiben. Für Liebhaber der Militärgeschichte mag die „Vasa“ eine Sensation sein. Aber für die armen Halunken, die als Matrosen und Soldaten angeheuert wurden, war sie das wohl eher nicht.
Die müssen in der Regel ausbaden, was größenwahnsinnige Strategen und Konstrukteure sich ausgedacht haben. Und Agnetta und Elvis sind nicht einmal wirklich erschüttert, dass sie nicht auf dem Schiff waren. Es war eine Geschichte, die nicht für sie gedacht war. Ihren Kindern werden sie später von diesem Tag in Stockholm erzählen, ganz bestimmt. Und diese Geschichte wird genauso märchenhaft sein wie die Geschichte des alten Anders von den 20 Forellen, die er mit der Hand gefangen hat.
Und da kehrt man dann zurück zum Ausgangspunkt. Denn so wie Lagerlöf erzählte, knüpfte sie an ein Erzählen an, wie es noch möglich war in Zeiten, als Familien noch ihre Familiengeschichten bewahrten, mit Vorfahren, die zu Legenden wurden, voller wundersamer Dinge, erstaunlicher Ereignisse, die letztlich unerklärlich bleiben, weil sie sich in Akten und Zeitungen nicht nachweisen lassen. In „Die dreizehn Leben des Richard Rohde“ greift ja auch Henner Kotte so ein Erzählen auf – mit einer großen Portion Wehmut, weil mit dem Verlust der Dörfer, in denen Familien jahrhundertelang lebten, auch ihre Familiengeschichten verschwinden. Wenn niemand mehr da ist, der zuhört, enden die Geschichten.
Dieses Moment steckt auch in Carvalhos Erzählung, die auch ein wenig das längst vergessene Staunen darüber artikuliert, wie neue Menschen in unser Leben kommen können und auf einmal wie selbstverständlich Teil unserer eigenen Erzählung werden, die die Erzählung des alten Anders weiterspinnt in die nächsten Jahre, die nächsten Generationen. Manchmal richtig märchenhaft. Aber das ist in solchen Erzählungen nicht verboten. Im Gegenteil.
Es ist das ursprüngliche Recht der ganz gewöhnlichen Menschen, die an den üblichen Sensationen so überhaupt keinen Anteil haben, ihrem Leben einen Hauch Sagenhaftes beizufügen, so eine kleine Wendung, die dem Ganzen einen märchenhaften Ausgang oder Zugang gibt, wo auch die wortlosen Gefährten an unserer Seite ihre Rolle spielen dürfen. Mit Elvis’ Worten zu Agnetta, als sie am Ende aufbrechen: „Ja, kehren wir zurück. Gehen wir nach Uppsala. Ich, du und der Kater im Korb.“
Andere kommen auf solche Weise nach Bremen. Aber selbst in den „Bremer Stadtmusikanten“ geht es ja untergründig genau darum: Sich selbst erzählen zu können, wie besonders das eigene Leben ist. Dazu muss man nicht überall dabeigewesen sein. Das schafft man auch in einem kleinen Nest, an dem andere achtlos vorbeiwandern können. Ob es ein Leben voller Abenteuer und erstaunlicher Begebenheiten war, das entscheiden wir alle selbst – indem wir das Erzählenswerte auch weitererzählen.
Was längst schon eine seltene Tugend geworden ist, weil die meisten von uns gar nicht mehr wissen, wie einzig das Selbsterlebte ist. Es sind diese Erzählungen, die vor die Hunde gehen im Geschnatter einer von Informations-Häppchen gefluteten Welt, in der am Ende niemand mehr weiß, was überhaupt noch wirklich ist oder erstunken und erlogen. Und wenn einer nach Hause kommt, ist nichts mehr da, das ihn erdet, keine alten Geschichten, keine Erinnerung an einen weißen Uhu oder einen Bären, der bis ins Dorf kam und den alten Anders erschreckte.
Cristina Carvalho Der Kater aus Uppsala, Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2021, 16,95 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
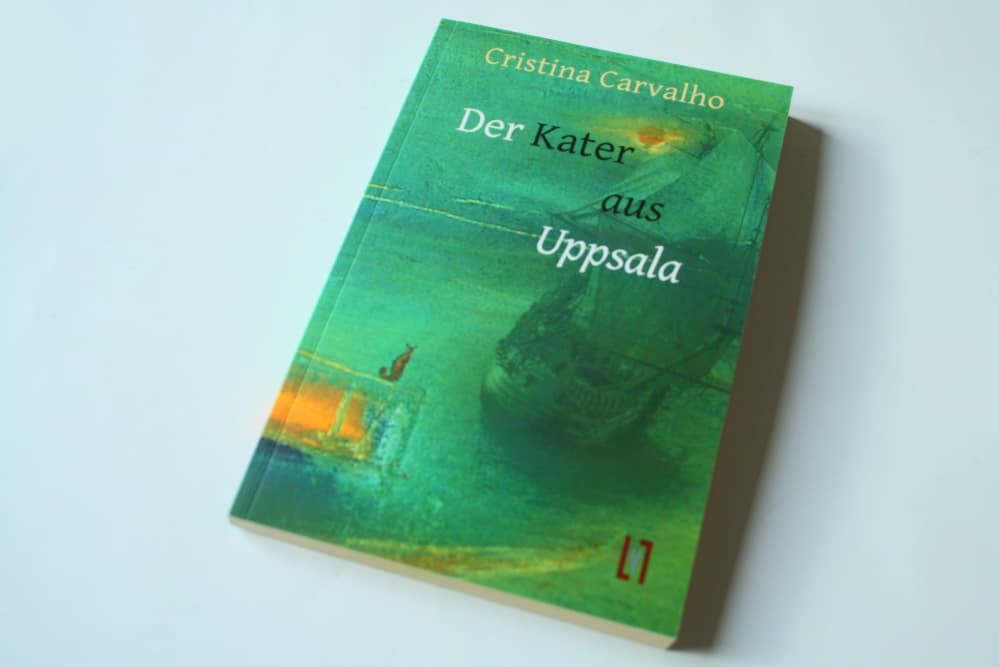















Keine Kommentare bisher