Es gibt Menschen, die würden auf die Frage, die Robert Macfarlane stellt, sofort mit „Ja“ antworten. Weil sie noch naturbelassene Flüsse kennen, ihre Urgewalt, ihren Lebensreichtum, ihre Kraft. Auch Kinder würden oft mit „Ja“ antworten. Und viele Bewohner der gezähmten Flusswelt Mitteleuropas würden wohl eher ins Grübeln kommen, weil die kanalisierten, eingedeichten, schwer belasteten und fast toten Flüsse die Frage geradezu sinnlos machen. Diese Flüsse leben nicht. Aber von ihnen hängt unser Leben ab. Was man wohl wirklich erst merkt, wenn man wie Robert Macfarlane dorthin reist, wo Menschen um ihre Flüsse kämpfen.
Drei Flüsse hat er zum Ziel seine Reisen gemacht: den Rio Los Cedros in Ecuador, den Ennore Creek in Indien und den Mutehekau Ship in Kanada. Klingt nach Flüssen, die nicht allzu berühmt sind. Aber gerade das macht sie zum Reiseziel, wenn einer wie der Naturschriftsteller Robert Macfarlane die Frage beantworten will, ob Flüsse Lebewesen sind.
Im Grunde startet seine Reise daheim, an den Quellen gleich hinter dem Ort, an dem er lebt. Quellen, die ein kleines englisches Flüsschen speisen. Die Quellen sind in diesem Sommer 2022 fast versiegt. Über Europa brütet die Hitze. In Italien ist der Po fast ausgetrocknet. Der Klimawandel macht sich überall auf der Welt immer stärker bemerkbar.
Dabei prägten Flüsse seit der letzten Eiszeit die Landschaften. Sie speisen die Grundwasserleiter, schaffen in ihrem verzweigten Lauf ein unendlich reiches Leben. Als die Menschen kamen, besiedelten sie zuerst die Flusstäler. Hier fanden sie ihr Nahrung, gründeten ihre Städte. Und begannen dann nach und nach, die Landschaft zu verändern und die Flüsse zu zähmen, sie dienstbar zu machen als Wasserstraße, Wasserdynamo, als Kloake für die Abfälle der wachsenden Zivilisation.
Wie stark die Flusssysteme im Lauf der Jahrhunderte verändert wurden, merkt man oft erst, wenn ein kenntnisreicher Autor wie Michael Liebmann in „Wasser, Wald und Menschen“ einmal die „Zivilisations“-Geschichte der Elster-Luppe-Aue beschreibt. Man ahnt trotzdem nur, wie sehr sich diese künstliche Flusslandschaft vom Ursprungszustand unterscheidet.
Haben Flüsse Rechte?
Aber es gibt noch die Flüsse, die in ihrer ursprünglichen Wildheit die Berge hinabrauschen. Solch einen Fluss besucht Robert Macfarlane in Ecuador. Ein Fluss, der dort für Furore sorgte, weil die Menschen darum kämpfen, dass der Fluss und sein Einzugsgebiet vom wilden Bergbau verschont bleiben. Und sie haben in Ecuador sogar die Gerichte hinter sich, denn Ecuador war eines der ersten Länder, die ein Recht der Flüsse auf Unversehrtheit und Lebendigkeit in die Verfassung aufnahmen.
Was erst einmal gut klingt – bis die Gnadenlosigkeit kapitalistischer Rohstoffausbeute zuschlägt und sich riesige internationale Bergbauunternehmen Abbaurechte von der Regierung zusagen lassen, selbst in den noch unversehrten Höhen der Bergwälder. Was immer bedeutet, dass sie nicht nur ins Flusssystem eingreifen, sondern die komplette lebendige Landschaft am Fluss zerstören.
Eine Landschaft, deren Reichtum man nur begreift, wenn man – wie Macfarlane es getan hat – tatsächlich hinauffährt in diese Bergregion und die frappierende Vielfalt des Lebens am Fluss mit eigenen Sinnen erkundet. Was er im ersten Teil dieses Buches auch tut und so farbenreich schildert, dass man sich die Welt, in die er da vordrang, beim Lesen geradezu vorstellen kann. Mitsamt ihrer Bedrohung.
Denn auch Ecuador kennt schon längst die Beispiele, wo Flusssysteme dem Bergbau geopfert wurden, die Berge regelrecht kahlgeschlagen und aufgerissen wurden und aus lebendigen, klaren Flüssen stinkende und vergiftete Müllableiter wurden. Vorgänge, die besonders die indigene Bevölkerung auf den Plan riefen, denn diese Zerstörungen vernichteten nicht nur den Wald, der ihnen Heimat war und Nahrung gab, sie vergifteten auch Wasser und Erde. Aus einer reichen, lebendigen Natur wird wüstes Land.
Wenn Flüsse von Landkarten verschwinden
Was geschieht, wenn den rücksichtslosen Konzernen kein Einhalt geboten wird, zeigt Macfarlane im zweiten Teil des Buches, in dem er einen Flussaktivisten in der Stadt Chennai am Golf von Bengalen besucht, der dort mit anderen Mitstreitern darum kämpft, die zur Kloake gewordenen Flüsse in der Stadt wieder ins Leben zurückzuholen.
In diesem Fall leben diese Flüsse sogar noch, bevor sie ins Gebiet der Millionenstadt Chennai hineinfließen. Aber dort werden sie tatsächlich als Kloake missbraucht und verwandeln sich sofort in eine tote und stinkende Brühe ohne Leben. Der Name des Flusses Cooum gilt sogar als schlimmsten Schimpfwort, so vergiftet, tot und stinkend ist er.
Während dem Ennore gar droht, regelrecht zur Industriekloake zu werden, weil Regierungsbehörden und Konzernbesitzer ihn offiziell einfach von der Landkarte getilgt haben, um hier ungehindert weitere Industrieanlagen bauen zu können und die Abwässer in den dann toten Fluss verklappen zu können.
Wer hier wagt zu fotografieren, bekommt es mit der Polizei zu tun. Und die Pläne bedrohen auch noch eine letzte wertvolle Lagune. So nebenbei erfährt Macfarlane aber auch, wie hier ein über Jahrtausende entstandenes System des Wasserückhalts zerstört wird, denn Chennai liegt im Monsungebiet. Hier kommt in den heißen Monaten kein einziger Tropfen Wasser vom Himmel, während es in der Monsunzeit dann wie aus Kübeln schüttet.
Die Bauern, die hier einst lebten, haben deshalb ein ganzes System kleine und großer Teiche und Seen geschaffen, die das Wasser sammeln und zurückhalten, sodass auch in der Trockenzeit noch genügend Wasser da ist. Im Grunde kann Macfarlane hier geballt an einem Ort besichtigen, wie uralte, sinnvolle Wassersysteme durch das rücksichtslose Wachstum moderner Städte nach und nach zerstört werden.
Und er tut es mit offenen Augen. Denn wer so wie Macfarlane die lebendige Welt bereist, der sieht auch all die Lebewesen, die diese Welt beleben. Der spürt, wie alles miteinander zusammenhängt. Und so beschreibt er die Flüsse eben auch, die eben nicht nur rinnende Gewässer sind, sondern undenkbar sind ohne die intakten Wälder aus denen sich ihre Quellen speisen. Beim Rio Los Cedros wird es regelrecht spürbar, wie der Wald den Fluss hervorbringt und der Fluss den Wald.
Beide Systeme sind untrennbar miteinander verflochten. Wer das eine zerstört, tötet auch das andere. Dazu kommen dann auch noch all die unterirdischen Flüsse, die wie ein Spiegelbild des oberirdischen Flusses sind. Und die Wolkenflüsse, die Macfarlane ebenfalfs beschreiben kann. Mit dem Ecuardor-Kapitel führt er die Leser sofort mittenhinein in die komplexe Welt, die gesunde Flüsse in Wirklichkeit darstellen.
Eine Welt, die die modernen Flussregulierer regelrecht demoliert haben, weil ihnen das Verständnis für diese Komplexität fehlte. Sie waren Spezialisten, sahen nur die Schiffbarkeit des Flusses oder seine Rolle als Wasserableiter. Mit jedem neuen Bauwerk am oder im Fluss zerstörten sie ein Stück der Vielfalt, die die Flüsse einst lebendig machte.
Dem Fluss ganz nah
In Chennai sieht Macfarlane, wie unbarmherzig die Herren der modernen Industrie eben nicht nur in die Natur eingreifen, sondern alle Natur glauben ausnutzen und regulieren zu können. Das Ergebnis: tote Flüsse, sterbende Seen, vergiftete Lagunen. Und der Verlust einer lebendigen Welt. Wobei in Chennai besonders deutlich wird, dass diese Zerstörungen vor allem die Ärmsten treffen, die Wohngegenden jener Menschen, die sich nicht wehren können, und wo die Menschen dann bald mit schweren Lungenkrankheiten und Krebs leben und sterben.
Dazu ist dann die Reise in den hohen Norden Kanadas wie ein Kontrastprogramm. Auch dort sind die Flüsse bedroht. Nicht von einer Industrie, die alles verseucht, aber von einem Energieunternehmen, das die noch unkontrollierten Flüsse am Sankt-Lorenz-Strom in Kraftmaschinen verwandeln will – jeden einzelnen Fluss gespickt mit riesigen Staudämmen, die das Wasser weit bis ins bewaldete Hinterland aufstauen. Einige Flüsse sind derart schon ins Korsett geschnürt, der einstige Reichtum ihres Einzugsgebietes gründlich zerstört.
Auch für den Mutehekau Shipu gibt es schon solche Pläne. Aber diesmal gibt es auch vehementen Protest der hier lebenden Menschen. Und Macfarlane lässt sich mit ein paar mutige Begleiter auf ein richtiges Wagnis ein, denn mit ihnen will er den wilden Fluss von seinem Ursprung im Lac Magpie bis zur Mündung im Kajak hinunterfahren.
Er ahnt, dass das eine echte Herausforderung wird. Nicht nur körperlich. Denn für die tagelange Reise sind die Kajakreisenden ganz auf sich allein gestellt. Hier gibt es weit und breit keine Straße und keinen Ort, wo sie um Hilfe bitten könnten, wenn unterwegs etwas passiert. Und der Fluss hat es in sich. Er ist wirklich noch ungezähmt und wartet mit großen Stromschnellen und Wasserfällen auf. Er verlangt den Reisenden alles ab, stürzt sie aber auch in tiefes Nachsinnen.
Denn Ablenkung gibt es hier auch nicht. Sie sind tagelang nur mit See und Fluss in Gesellschaft, treffen auf die wilde Gewalt des Wassers. Eine Gewalt, die die Elektrizitätsgesellschaft unbedingt zähmen will. Aber der Stausee wäre so riesig, dass er im Grunde das komplette Flusssystem verschlingen würde.
Alles fließt
Aber noch mehr als am Rio Los Cedros spürt Macfarlane hier, dass der Fluss ein lebendiges Wesen ist, eigensinnig, unerbittlich. Nur dass Menschen seine Sprache nicht verstehen können. Und natürlich beschäftigt ihn auch hier die Frage, ob ein Fluss eine selbstständige juristische Person sein könnte. Und genau darum kämpfen auch die Flussaktivisten in Kanada, während er mit seinen Begleitern den Fluss hinunterfährt.
Am Ende fühlt er sich „sich selbst verflusst“. Denn wer sich so dem tosenden Element aussetzt, der spürt natürlich, wie alles fließt. Und wie berechtigt das Fluss-Bild für so vieles ist, was auch wir Menschen erleben. Denn wir sind immer Teil des Ganzen. Und nicht nur die Pilzforscherin Giuliana Furci, die den Autor bei der Exkursion in den Zedernwald in Ecuador begleitet, findet Heilung in diesen noch heilen Wäldern.
Gerade die beiden noch unversehrten Flüsse, die Macfarlane besucht, machen spürbar, wie sehr die Bewohner der modernen Welt schon den Kontakt zu einer lebendigen Natur verloren haben. Sie spüren das Leben nicht mehr. Und die Flüsse, die durch unsere Städte fließen, können uns das Gefühl auch nicht geben. Sie erzeugen eher Trauer und Beklemmung. Sie bilden keine Muster mehr, eingezwängt in Deiche und Mauern, abgeschnitten von ihren einstigen Wäldern.
Auch als Leipziger liest man das Buch mit Gefühlen, die von Begeisterung bis Schnappatmung reichen. Denn wenn jetzt um die letzten noch lebendigen Flüsse in den abgelegenen Gegenden der Welt gekämpft werden muss, weil riesige Konzerne auch dort ihre Profitinteressen rücksichtslos durchsetzen wollen, was wird dann aus unserer Welt? Sehen wir doch vor unserer Nase, wie unendlich schwer und teuer es ist, die Verwüstungen der Vergangenheit aus den Flusstälern zu entfernen und ihnen wieder ein bisschen Leben zurückzugeben.
Strom des Lebens
Was auch deshalb schwer ist, weil wir jedes Gefühl für eine lebendige Natur verloren haben, die künstlichen Gewässer für etwas Normales halten und nicht einmal ahnen, wie unsere eigenen Flüsse einmal ausgesehen haben müssen. Natürlich scheint auch bei Macfarlane die Hoffnung mit, dass immer mehr Flüsse in der Welt juristische Rechte bekommen und jeder Eingriff in ihr komplexes System auch vor Gericht beklagt werden kann. Denn hier geht es längst um die letzten noch intakten Flüsse.
Während verbaute und verdreckte Flüsse enorme Anstrengungen verlangen, wenn wir sie wieder beleben wollen. Beleben müssen. Denn Flüsse beeinflussen eben nicht nur ihr eigenes Flussgebiet. Sie beeinflussen den Wasserhaushalt einer ganzen Region, sorgen für lebendige Wälder und für Wolken und Regen, wie am Rio Los Cedros direkt zu erleben war.
Es geht um unsere Zukunft. Unser Schicksal fließt mit dem unserer Flüsse zusammen. In den drei Geschichten, die Robert Macfarlane erzählt, wird das greifbar. Von „fließender Prosa“ spricht der Verlag. Recht hat er. So bildgewaltig hat lange niemand die Schönheit, die Urgewalt und Eigenwilligkeit von Flüssen geschildert. Und vielleicht – so deutet Macfarlane an – erleben zumindest unsere Kinder, dass sich etwas ändert und auch die Mächtigen in unserer Welt begreifen, dass man die Flüsse schützen muss, wo sie noch unzerstört sind, und wieder beleben muss, wo sie zum toten Abflusskanal geworden sind.
Was etwas voraussetzt, was Vielen heute verloren gegangen zu sein scheint: ein Gefühl für die lebendige Welt und dafür, dass wir alle nur Teil des riesigen Stroms des Lebens sind.
Robert Macfarlane „ „Sind Flüsse Lebewesen?“ Ullstein, Berlin 2025, 29,99 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
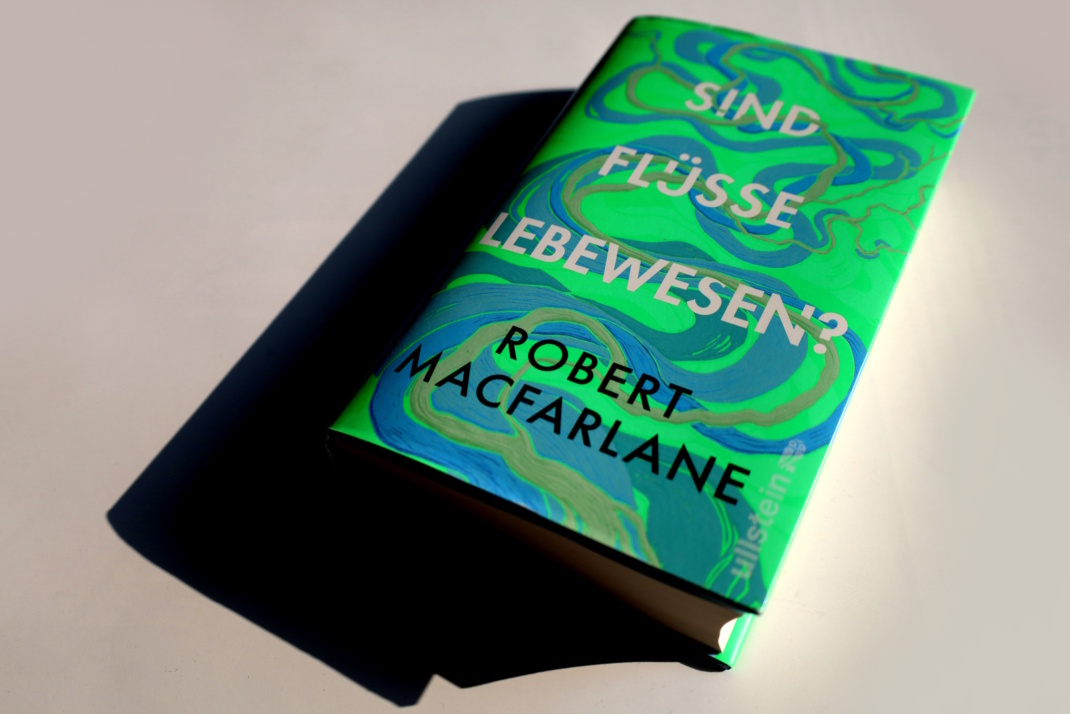


















Keine Kommentare bisher