Am morgigen Dienstag, 10. Mai, ist Friedrich-Gerstäcker-Day. Bislang nur in Arkansas. Aber warum nicht auch in Leipzig, wo Friedrich Gerstäcker 1846 seinen berühmten Roman „Die Regulatoren von Arkansas“ veröffentlichte? Und 1848 „Die Flußpiraten des Mississippi“? Der ideale Tag, mal wieder einen der dicken Abenteuerromane aus dem Regal zu holen.
Aber kann man die überhaupt noch lesen? Oder gehören die Bücher nur noch ins Kinderzimmer – zusammen mit Karl May und James Fenimoore Cooper? Man kann. In dutzenden Auflagen sind sie auch heute noch präsent. Und die Leute von Arkansas lieben Gerstäcker natürlich, weil er eine frühe Phase in ihrer Landesgeschichte sehr bildhaft und sehr kenntnisreich beschrieben hat. Wer wissen will, wie es damals um 1846 auf dem Mississippi war, der ist bei Gerstäcker richtig. Der erfährt so nebenbei eine Menge über Flatboats und die frühen Dampfer auf dem Fluss, die so leicht zur Explosion neigten, über einen unregulierten Fluss, der immer wieder sein Gesicht veränderte. So wie zwanzig Jahre später Mark Twain als Lotse auf dem Mississippi fuhr (und 1883 in seinem Buch „Leben auf dem Mississippi“ darüber schrieb) hat Friedrich Gerstäcker den Fluss als Heizer kennen gelernt. Aber auch das Leben der Trapper, Händler, Farmer und Hoteliers am Fluss hat er beobachtet. Die Menschen in seinem Buch sind Leute vom Fluss. Sie kennen die Gefahren, sie nutzen trotzdem diese gewaltige Wasserstraße, auf der die im Norden produzierten Waren in den Süden geschifft werden.
Auch das Sklavenproblem spart Gerstäcker nicht aus. Mit allen Zeichen der Zeit und dem Unbehagen des Europäers gegenüber dem Umgang der Amerikaner mit den Farbigen. Auch wenn zwei der Farbigen in diesem Buch unter die Ganoven gefallen sind – und letztlich auch um ihre Haut kämpfen, wenn sie sich gegen die Weißen zur Wehr setzen. Manchmal staunt man schon, wie heutig einen diese Haltungen anmuten, diese Arroganz der Weißhäutigen, anderen Menschen gegenüber.
Mancher Kritiker bemängelte ja gern die Trivialität der Handlungen in Gerstäckers Büchern. Sie stecken voller Handlung – deftig, dicht gepackt, dramatisch. Die Bücher lassen sich genauso gut verfilmen wie die Lederstrumpf-Erzählungen von James Fenimoore Cooper. Sie wurden bislang nur noch nicht gleichwertig verfilmt. Vielleicht auch, weil keiner diesem deutschen Autor und Reisenden zutraut, dass er schon 1846/1848 genauso spannend (und damit auch modern) schreiben konnte wie Cooper. Immerhin war das die Zeit, da der deutsche Büchermarkt noch dominiert war von spätromantischer und biedermeierlicher Literatur. Das Gemütvolle war Trumpf. Die beliebtesten Autoren schwelgten in Abschweifen, philosophischen Ausflügen, sentimentalen Briefen und Dialogen.
Das Publikum aber sehnte sich nach Welt. Und Gerstäcker mit seinen aus eigener Erfahrung schöpfenden Romanen traf den Nerv der Zeit. Unterschwellig natürlich auch mit den Botschaften seiner Geschichten. Denn Bösewichte sind nicht einfach Bösewichte bei ihm, und es geht auch nicht um den späten Glanz verschollener Adelstugenden wie bei Walter Scott. Amerika stand damals auch als Sehnsuchtsland für viele Deutsche, als das Land, in dem man darauf hoffen konnte, mit eigener Hände Kraft eine eigene Existenz aufzubauen ohne eine feudale Obrigkeit. Ein neuer Ort der Freiheit. Mehrfach wird in Sätzen und Dialogen auf die Verfassung Bezug genommen. Die Leute aus Helena, aber auch die Leute von den Farmen ringsum wissen, dass es die Freiheiten der Verfassung sind, die ihre Freiheit zu leben erst ermöglichen.
Deswegen ist die Geschichte um die Piraten auf Mississippi-Insel Nr. 61 wesentlich verzwickter, denn die dort unter der Führung des cleveren Mr. Kelly agierenden Diebe und Mörder nehmen für sich natürlich auch jegliche Freiheit in Anspruch – auch wenn es die Freiheit der Räuber ist, denen ein Menschenleben nichts wert ist. Was nicht heißt, dass Gerstäcker nun das freie Piratenleben preist. Dazu hat es die Bande längst zu toll getrieben. Die dunklen Wolken brauen sich zusammen. Es gab ein paar Morde zu viel. Und es mehren sich auch unter den Farmern die Gerüchte, dass es da ein regelrechtes Räubernest geben muss – nur ahnt noch niemand, dass die Bande auch noble Helfershelfer hat, die dafür sorgen, dass sie aufs Beste informiert ist über die Ladungen, die den Mississippi herunter kommen, aber auch über die möglichen Gefahren durch tapfere Männer (von denen es bei Gerstäcker gleich eine ganze Handvoll) gibt, denen man begegnen muss. Und da wird es erstaunlich heutig, wenn sich herausstellt, dass selbst der Ortspolizist und der Friedensrichter zur Bande gehören.
Ein clever aufgezogenes Unternehmen also, bei dem auch gleich noch die staatlichen Institutionen unterwandert sind. Und gerade der Hauptbösewicht erklärt es gleich am Anfang der Geschichte so, als würde er heute mit aller Kühnheit den amerikanischen Präsidentenwahlkampf aufrollen wollen: „Die Menge lässt sich gern von einem entschlossenen Manne leiten, und wenn man den richtigen Zeitpunkt auch richtig trifft, so vermag ein einzelnes ernstes Wort oft Gewaltiges.“
Da ist er, der moderne Glaube an den starken Mann, der alles besser kann. Da steckt der ganze Trumpismus, den die Amerikaner seit Gerstäckers Zeiten bestens kennen. Dass das ganze 19. Jahrhundert voll davon war, von diesem nimmersatten Selfmade-Man, das kann, wer will, in Mark Twains postum veröffentlichten Autobiografien nachlesen. Er hat solche Typen kennengelernt. In Washington noch viel mehr als am Mississippi.
Nur dass es bei Gerstäcker genug kampfbereite Leute gibt, die sich die Ausplünderung durch die Piratenbande nicht länger gefallen lassen wollen. Auch gleich noch ein ganzes Dampfboot mit Soldaten an Bord, die das Piratennest ausnehmen. Das mutet manchmal schon wie ein bisschen viel des Zufalls an. Da merkt man, dass es vor Gerstäcker noch nicht wirklich viel realistische Abenteuerliteratur gegeben hat. Dafür viele Romane, die eigentlich verkleidete Dramen waren, die mit Verwechslungs- und Maskengeschichten spielten und mit der scheinbaren Naivität der Betrogenen.
Dass Gerstäcker aber eigentlich eine Botschaft vermitteln will, macht er recht früh deutlich, als er einen seiner Trapper-Helden sagen lässt: „Der Mensch ist, wenn nicht das größte, doch sicherlich das gefährlichste Raubtier – er mordet zum Vergnügen.“
Das heißt schon was, wenn einer, der nun wirklich sechs Jahre lang drüben war, so eine Botschaft mitbringt aus der Neuen Welt. Die eigentlich auch besagt: So neu und jungfräulich ist „God’s own country“ gar nicht. Im Gegenteil: Hier toben sich Dinge aus, die man aus der dunklen europäischen Geschichte nur zu gut kennt.
Und so eine Ahnung muss er schon gehabt haben, wie sehr auch diese niegelnagelneue amerikanische Gesellschaft zu einem Dschungel werden würde, in dem die Raubtiere auf Beute ziehen würden. Und ganz am Ende, als die ganze Sache in einer wilden Schießerei endet, schweift der Erzähler selbst noch einmal ab und versucht, seinen wichtigsten Bösewicht, den Richter, zu erklären. Und erklärt ihn als eine sehr moderne Gestalt, wie man sie in der global entfesselten Wirtschaftswelt nur zu oft vermutet, nur selten trifft, weil diese Typen auch gelernt haben, sich die Gesetze zuschneidern zu lassen, Politiker zu kaufen und andere die juristische Drecksarbeit machen zu lassen, wenn sie bei ihren Raubzügen vielleicht mal ertappt werden.
Denn natürlich tun sie ja alles nur aus edlen Gefühlen heraus. Ehrgeiz zum Beispiel.
„Aber der Ehrgeiz hatte die scharfen, giftigen Krallen in seine von wilden Leidenschaften durchwühlte Brust gehauen, kalte Berechnung allein leitete seine Handlungen, und das Heiligste opferte er rücksichtslos dem eigenen Ich.“
Da wird die moderne Ego-Gesellschaft sichtbar, die heute so fett und bräsig die Welt regiert und auch noch von Werten redet, wo sie schlicht Geld meint.
Und dabei belässt es Gerstäcker nicht. Denn er hat – vielleicht gerade durch seinen langen Aufenthalt in Amerika – auch mitbekommen, dass diese Art Ehrgeiz nicht nur die echten Macht-Männer ergreift, sondern eine ganze Gesellschaft zerfrisst: „Wohl gibt es Tausende, wie er war – Menschen mit eisernen Herzen, die ebenso kalt und entsetzlich in das Leben hineingreifen und alles andere rücksichtslos unter die Füße treten, wenn sie nur für sich jede Lust, jede Befriedigung ihrer Wünsche erlangen können; aber der kecke, tollkühne Mut fehlt ihnen, den der Piratenhäuptling in so entsetzlichem Maße besaß; sie strecken die spitzigen, behandschuhten Finger vorsichtig aus, dass sie nirgends anstoßen, und nur dann, wenn sie sich vollkommen unbeachtet wissen, zeigen sie sich in ihrer wahren Gestalt.“
So eine Gestalt kommt im ganzen Buch nicht vor. Hier wird Gerstäcker – wenn nicht politisch – dann doch sehr nachdenklich, was die neue, die amerikanische Vorstellung von Freiheit eigentlich bedeutet. Und was folgt, klingt doch erstaunlich gegenwärtig: „Und die Welt ehrt sie, das Gesetz schützt sie, denn ‚es ist ihm gegen sie ja nichts bekannt geworden‘, aber dennoch fluchen ihnen zahllose Unglückliche, die sie elend gemacht, die Verwünschungen der Witwen und Waisen heften sich an ihre Sohlen, und Schätze und Reichtümer, in verzweiflungsvoller Stunde an fromme Stiftungen herausgeschleudert, können nicht die feige Angst der letzten Augenblicke betäuben.“
Da ging mit ihm am Ende noch einmal der Moralist durch. Denn ganz so fromm waren die Stiftungen auch damals nicht. Und wirklich von Angstgespenstern gejagt sind die großen Räuber auch damals wohl nicht gewesen.
Die Zeit für Romane, in denen solche Verwicklungen ein tragisches Ende nehmen, war noch nicht gekommen. Auch Gerstäcker war noch ein großer Träumer und Romantiker und traf damit auch den Geschmack seiner Leser. Auch wenn er hier das eisige Gefühl aufkommen ließ, dass die richtigen Piraten der Neuen Welt unantastbare Herren in feinem Zwirn sein würden, die alle Gesetze der Welt auf ihrer Seite haben würden, weil alle Gesetze von ihren eigenen Angestellten extra für sie geschrieben wurden.
Der Rest ist natürlich eine flotte Mississippi-Geschichte mit herrlich dramatischen Szenen auf, im und am Wasser – und großenteils auch in einem richtig fetten Mississippi-Nebel, so dass keiner mehr weiß, wer nun Freund und wer Feind ist.
Friedrich Gerstäcker „Die Flußpiraten des Mississippi“, Leipzig 1848
In eigener Sache
Jetzt bis 13. Mai (23:59 Uhr) für 49,50 Euro im Jahr die L-IZ.de & die LEIPZIGER ZEITUNG zusammen abonnieren, Prämien, wie zB. T-Shirts von den „Hooligans Gegen Satzbau“, Schwarwels neues Karikaturenbuch & den Film „Leipzig von oben“ oder den Krimi „Trauma“ aus dem fhl Verlag abstauben. Einige Argumente, um Unterstützer von lokalem Journalismus zu werden, gibt es hier.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
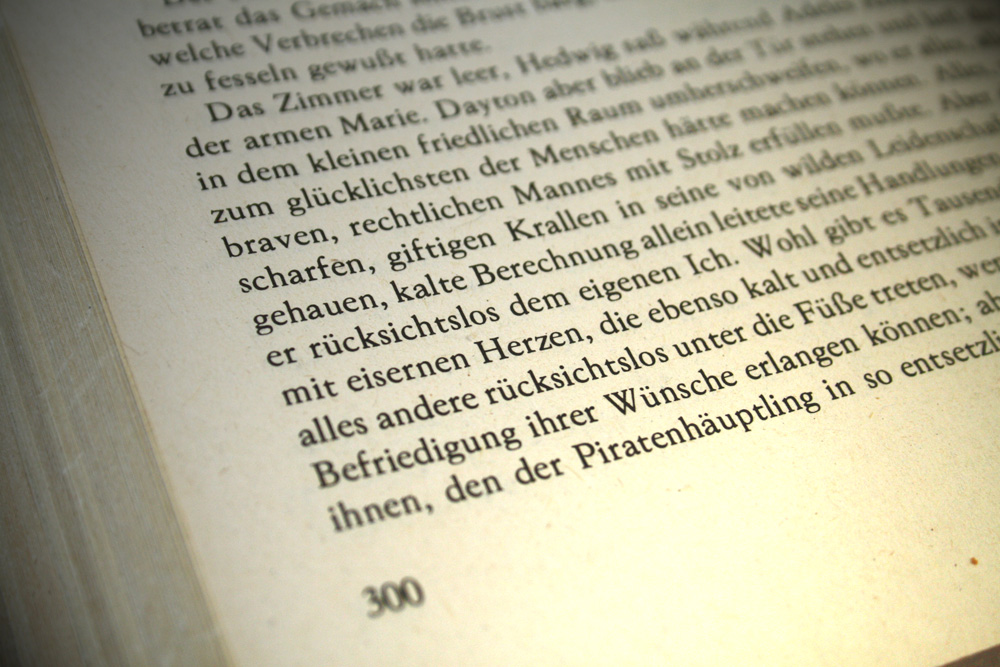








Keine Kommentare bisher