Noch ein Buch über den Kaisersturz von 1918? Könnte man denken. Aber der Theologe und Historiker Benjamin Hasselhorn hat einen anderen Grund dieses Buch zu schreiben, das eigentlich ein Essay ist, ein Versuch, die Frage zu klären, ob die Abschaffung der Monarchie 1918 vielleicht ein nicht ganz unwichtiger Grund für alle Extreme der Folgezeit war. Man muss sozusagen zwei Schritte zur Seite gehen, um mit ihm über dieses Stück Geschichte nachzudenken.
Oder drei. Denn zu schlecht ist die Figur, die Kaiser Wilhelm II. in den Geschichtsbüchern abgibt. Oft wird er zum Hauptschuldigen für den desaströsen 1. Weltkrieg gemacht, oft wird sein Dünkel benannt, mit dem er Politik machte und letztlich den Einflüsterern in seiner Umgebung erlag. Aber natürlich streiten sich die Historiker. In letzter Zeit vermehrt, weil vielen sehr wohl bewusst ist, dass man Geschichte nicht einfach von ihren Ergebnissen her interpretieren darf. Dann erscheinen die Sieger als die einzig Richtigen und Guten, scheint das Ergebnis geradezu zum Sinn der Geschichte zu gerinnen. In der häufigsten Lesart zum 1.Weltkrieg also: ein Sieg der Demokratie über die Monarchie.
Ein Sinn, der natürlich Risse bekommt, wenn man heute sieht, wie die stabilsten Demokratien weltweit scheinbar in die Krise geraten und selbst demokratisch gewählte Politiker bereit sind, die Errungenschaften der Demokratie preiszugeben, nur um an der Macht zu bleiben.
Am Ende des Buches betont Hasselhorn, dass er damit ganz und gar nicht für die Wiedereinführung der Monarchie plädiere. Aber natürlich lädt er vorher zu einer Denkfigur ein, der es schwerfällt zu folgen, so elegant sie auch auf den ersten Blick wirkt. Denn er setzt die heutigen parlamentarischen Monarchien als Gegenbild zu den kriselnden Demokratien, wo es keine Königshäuser mehr gibt.
Fakt ist: 1917 und 1918 purzelten einige Kronen – und zwar vor allem in den Ländern, die den Weltkrieg verloren hatten. Die deutsche Monarchie hatte sich komplett desavouiert, die Deutschen waren des Krieges müde. Und schon Wilhelm II. und einige seiner Berater dachten darüber nach, ob mit einem Opfertod des Kaisers wenigstens die Monarchie zu retten wäre. Was Wilhelm II. für sich verneinte. Da ging er lieber ins Exil.
Und hätten wir nicht gerade Lothar Machtans „Kaisersturz“ gelesen und „Lob der Revolution“ von Keil und Kellerhoff, wären wir vielleicht geneigt gewesen, auf diese Denkfigur einzugehen, die nun einmal eine monarchistische ist. Waren die Deutschen 1918 noch so überzeugte Monarchisten, dass sie den Opfertod ihres Kaisers als klassischen Opfertod eines Königs, als Symbol angenommen und eine Fortführung der Monarchie akzeptiert hätten?
Recht hat Hasselhorn, wenn er betont, dass der 1. Weltkrieg kein Krieg der (modernen) Demokratien gegen die (überlebte) Monarchie war. Deutschland war im August 1914 ein hochmodernes Land mit einer Wirtschaftskraft, die nur noch von den USA übertroffen wurde. Es hatte auch einige Sozialstandards, die sich durchaus mit denen der Weltkriegsgegner Frankreich und England messen konnten.
Und Hasselhorn kritisiert natürlich zu Recht die lange geltende Fixierung auf die Schuldfrage, die ja schon 1919 ganz Deutschland zulasten gelegt wurde. Wenn man sich jahrzehntelang nur über Schuldfragen streitet, übersieht man die tatsächlichen Kräfte hinter den Kulissen. Mittlerweile sieht das auch die Geschichtswissenschaft anders und fragt – zu Recht – nach den verheerenden Folgen der Versailler Verträge, die eben leider keinen wirklichen Frieden brachten, dafür viele nationale Geschichten der Frustration.
Die Autoren des Versailler Vertrages dachten in absolut moralischen Kategorien, fast biblischen könnte man meinen. Es ging um Schuld und Sühne und Bestrafung. Nicht um die Herstellung einer neuen, verlässlichen Friedensordnung. Was bis heute fortwirkt.
Und was auch damit zu tun hat, dass die bürgerliche Geschichtsschreibung gern ausblendet, dass die Weltkriege des 21. Jahrhunderts nun einmal keine Kriege zur Herstellung einer europäischen Friedensordnung waren, sondern imperiale Kriege. Es ging um militärische und wirtschaftliche Einflusssphären, Vorherrschaft und den militärisch ausgetragenen Konflikt kolonialer Konkurrenten. In der Regierungsform waren sie sich alle sehr ähnlich, mit einigen Unterschieden zwischen konstitutioneller und parlamentarischer Monarchie.
Aber im Wesenskern waren sie sich gleich, dachten die Eliten in allen diesen Ländern, die Hasselhorn glaubt sortieren zu können, imperial. „Gewonnen“ hat am Ende nicht der moralisch Überlegene oder der mit der besseren Regierungsform, sondern der mit den größten technischen Ressourcen. Der 1. Weltkrieg war nicht nur der erste moderne Massenkrieg, er war auch ein durch und durch technisierter Krieg. Und verloren hat Deutschland am Ende nicht, weil es irgendeine Schlacht verloren hätte, sondern weil es wirtschaftlich ausgebrannt war, die riesige Kriegsmaschinerie nicht mehr füttern konnte.
Hier prallten keine Monarchien aufeinander, sondern hochgerüstete moderne Armeen. Die wirtschaftliche Sicht auf Geschichte fehlt bei Hasselhorn. Was nicht überrascht: Sie spielt in einem Großteil der heutigen Geschichtsschreibung kaum eine Rolle. Deshalb wird ja meist nur darüber debattiert, welche Regierungsform die modernere ist. Oder die stabilere, wie bei Hasselhorn.
Und ob es da qualitative Unterschiede gibt, die die eine als besser erscheinen lassen als die andere.
Dem muss man nicht folgen. Dazu ist die Unterscheidung ein bisschen zu willkürlich.
Aber ganz am Ende macht Hasselhorn deutlich, dass es ihm eigentlich um etwas anderes geht, etwas, was er in der Monarchie verkörpert sieht: Die Verbindung der Demokratie mit der Tradition, mit etwas, das dem Staatswesen eine in die Geschichte hineingreifende Legitimität verschafft: „It’s tradition, stupid“ zitiert er indirekt den US-Präsidenten Bill Clinton, der mal gesagt haben soll: „It’s business, stupid!“ Oder so ähnlich.
Wie gibt man einer Ordnung Legitimität, fragt er. Und merkt zu Recht an, dass die einfache Behauptung demokratischer Spielregeln das noch nicht schaffe. Denn worauf gründen sie sich, wenn man nicht wieder die so gründlich missbrauchte „Nation“ aus der Kiste holt und anfängt, von Religion und Leitkultur und Ähnlichem zu reden? Was ja derzeit wieder gerade von Konservativen in allen möglichen Ansätzen gemacht wird. Und diese konservativen Denkwelten sind Hasselhorn vertraut.
„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“, zitiert er den Katholiken und Staatsrechtler Ernst-Wolfgang von Böckenförde. Was übrigens auch auf den religiös fundierten Staat zutrifft. Hasselhorn bringt es ja selbst auf den Punkt, wenn er ein Kapitel mit „Die Wiederverzauberung der Welt“ überschreibt. Die Monarchie legitimiert sich über ihre sakrale Fundierung: Könige werden gesalbt und in großartigen Inszenierung ins Amt gebracht. Und gerade Hasselhorns Ausflug in die Welten der modernen Monarchie-Inszenierungen in den Medien zeigt, dass augenscheinlich viele Menschen eine Sehnsucht nach so einer „Verzauberung“ haben, nach Poesie, wie es Gneisenau nannte, nach etwas, das mehr bedeutet, als es ist. So eine Art Verklammerung der Gegenwart mit der Geschichte.
Also vor allem: Rituale.
Haben wir zu wenige Rituale, die uns mit unserem Gemeinwesen verbinden? Brauchen die meisten Menschen wieder Rituale und suchen sie dann anderswo, wenn ihnen die bürokratische Geschäftigkeit des Parlaments und der Regierung keine Ansatzpunkte bietet?
Die Fragen bleiben stehen. Vor allem, weil sie eine Frage aufwerfen, die wieder über Hasselhorns Essay hinausgeht: Was ist die gesellschaftliche Klammer, wenn die aktuelle Gesellschaft überall den Individualisten und Egoisten propagiert? Welche Traditionen sollten Menschen da wieder binden und beruhigen?
Und wie sehr wirken heutige Monarchien noch als Klammer, wenn man nur an die Niederlande, Schweden oder Spanien denkt?
Verständlich ist Hasselhorns Plädoyer dafür, „mit der Verteufelung der letzten deutschen Monarchie Schluss zu machen“. Wer sie genauer betrachtet, sieht tatsächlich einen für die Zeit hochmodernen Stadt, der auch schon gewisse Freiheiten kannte. Aber im September 1918 war die deutsche Monarchie verbrannt. Deswegen waren auch die Gedankenspiele um den „Königstod“ eher theoretischer Art. In der Praxis war Deutschland reif für die Demokratie – wovon auch die Wahlergebnisse der MSPD erzählen.
Und natürlich kann man fragen, was uns heute eine Klammer gibt, eine Verwurzelung in unserer eigenen Geschichte. Aber ich bezweifle, dass das etwas mit Monarchie oder Religion zu tun hat. Die Beispiele, die Hasselhorn aus der jüngeren Politik aufzählt, wirken eher hilflos.
An einer Stelle erwähnt er tatsächlich die Aufklärung als einen durchaus noch immer aktuellen Bezugsrahmen. Auch wenn er dann wieder den Schnellsprung zur (blutigen) Französischen Revolution vollzieht. Aber das erscheint mir dann selbst wieder wie so ein historischer Kurzschluss, vor dem Hasselhorn eigentlich in Bezug auf 1918 warnt.
Benjamin Hasselhorn Königstod, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2018, 22 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
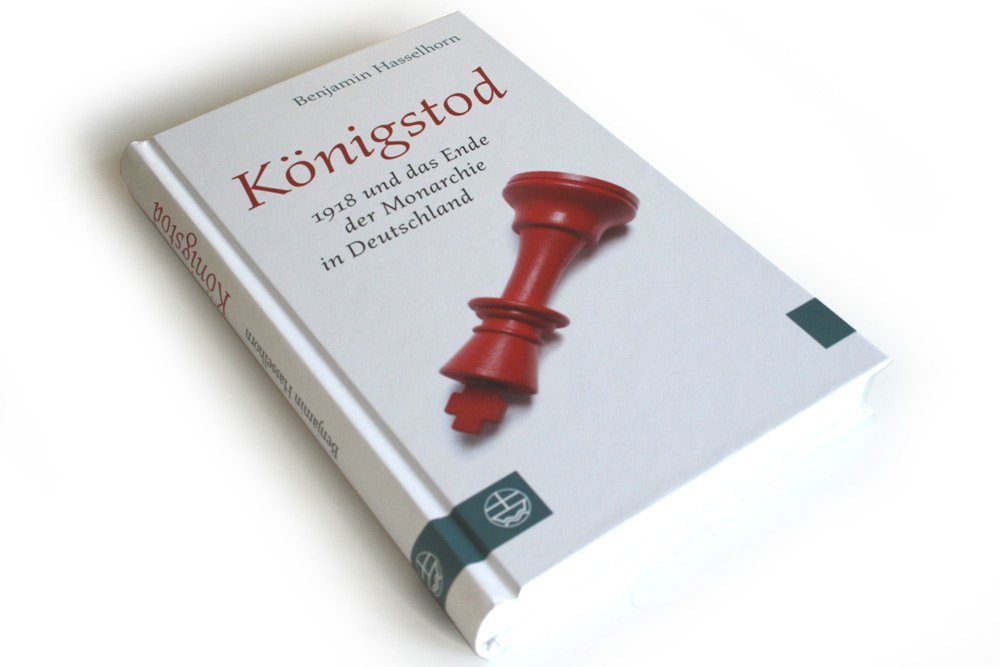











Keine Kommentare bisher