2020 war nicht nur Corona-Jahr, auch wenn für einige Leute scheinbar gar nichts anderes passiert ist. Es war auch Beethoven-Jahr. Der berühmte Komponist aus Bonn wurde 250 Jahre alt. Was man nicht einmal im Konjunktiv schreiben muss, denn er ist in seiner Musik so lebendig wie zu Lebzeiten. Nur dass wir uns oft genug das Falsche denken, wenn wir uns dieser unbändigen Musik vom Beginn unseres Zeitalters aussetzen.
Denn Beethoven steht für diesen Beginn exemplarisch wie kein anderer. Und niemand hat das so akribisch beschrieben wie der Schriftsteller und Philosoph Friedrich Dieckmann. Bislang freilich noch nicht in einem Buch, anders etwa als bei Wagner und Schubert. Die Liste seiner Veröffentlichungen erzählt davon, wie intensiv er sich mit der Geschichte der deutschen Musik, der Bühne und der Literatur gerade des 19. Jahrhunderts beschäftigt hat. Auch in DDR-Zeiten schon.Essays, die sich einreihen in eine damals zumindest unter Schriftsteller/-innen sehr intensive Diskussion über eine Kulturgeschichte, die so überhaupt nichts mit der normierten „Geschichte der Arbeiterklasse“ zu tun hatte. Und gerade weil die Autor/-innen sich Stoffe und Persönlichkeiten abseits der offiziellen Geschichtslinie wählten, wurde dieser Zugriff auf deutsche Geschichte fruchtbar. Oder könnte es sein, wenn das gesamtdeutsche Feuilleton nicht ganz so verklemmt und voreingenommen wäre.
Denn der Zugriff war von Anfang an fruchtbar und eine Absage genauso an die übliche Heldengeschichte der konservativen Geschichtsschreibung wie an die „Gesetzmäßigkeit“, die die (pseudo-)marxistische Geschichtsschreibung immer behauptet hat. Die schönsten Debatten über die Neuinterpretation von historischen Persönlichkeiten fanden genau in diesen erfrischenden geistigen Befreiungsbewegungen statt.
Denn wer die gängigen Interpretationen nicht (mehr) akzeptiert, weil sie partout nicht passen wollen zu dem, was man hört – etwa in Beethovens Musik – und was man herausfinden kann über sein Leben und die Umstände, unter denen seine Werke entstanden, der sieht etwas Neues. Was für schöpferische Menschen nicht neu ist. Aber dazu muss man wohl selbst schöpferisch sein, um es zu bemerken. Denn wer wirklich mitreißende Kunst erschaffen will, der schöpft aus sich selbst, der verwandelt sein Leben, Denken und Fühlen in Kunst.
Und der positioniert sich auch, selbst dann, wenn die Kunstkritiker so tun, als hätten sie es mit einer nur allein aus sich schöpfenden Künstlerpersönlichkeit zu tun, was wohl die größte Portion Nebel in der deutschen Kunstwissenschaft immer war. Auf dem Feld des Gesellschaftswesens Mensch/Künstler stellte sie sich ganze Generationen lang blind und doof.
Anfangs natürlich aus gutem Grund. Davon erzählt ja gerade Beethovens Musik, deren Hauptteil in Wien entstand, in einer Umbruchzeit, in der das Erbe des viel zu früh verstorbenen Kaisers Leopold II., des aufklärten Herrschers auf dem Habsburgischen Thron, durch dessen Nachfolger Franz II. nicht nur schleunigst abgeräumt wurde. Mit Franz II. (später Franz I. von Österreich-Ungarn) begann schon 1806 die Restauration in Österreich, wurden tausende Bücher, die in Leopolds Zeit veröffentlicht wurden, verboten, und installierte bald auch Metternich jenes Polizeiregime, das der Rest Deutschlands nach den Karlsbader Beschlüssen erst so richtig kennenlernen sollten.
Die ganze Dramatik der Zeit und seiner Wahlheimat kann man in Beethovens Kompositionen hören. Eigentlich ist einem das erstaunlich vertraut, auch weil heute schon wieder allerlei hochbezahlte Leute mit Verachtung auf die Aufklärung und ihre Rolle für die Emanzipation der Europäer herabschauen. Oft sind es dieselben Leute, die genauso voller Verachtung auf „die 68er“ herabschauen. Sie hassen jede Veränderung.
Ihr Leitspruch ist bis heute: „Ordnung ist die erste Bürgerpflicht!“. Sie lieben strengere Polizeigesetze, harte Gangarten und strikte Überwachung. Mit Dieckmann erleben wir, wie vertraut uns dieser früh ertaubende Komponist bis heute ist. Und wie aus seiner anfänglichen Begeisterung für die Französische Revolution und den zum Konsul erhobenen Napoleon Bonaparte schon bald das blanke Entsetzen wurde über diesen Mann, der in moderner Selbstermächtigung meinte, seinen Willen und seine Macht dem ganzen Kontinent aufzwingen zu können.
Natürlich diskutiert er jene ausradierte Widmung für Napoleon Bonaparte auf dem Titelblatt der „Eroica“ genauso wie die Entstehung des „Fidelio“ in drei Phasen. Und er korrigiert dabei Dutzende Interpretationen, die bis heute in lexikalischen Standardwerken zu finden sind, weil die Verursacher diese Interpretationen nicht hören wollten – oder nicht durften.
Denn mit Beethoven hat man nun einmal den ersten europäischen Komponisten vor sich, der sich nicht mehr scheute, seine Musik ganz persönlich sprechen zu lassen, all seine Emotionen hineinzukomponieren und all die Zerrissenheit, die zumindest Literaturwissenschaftler, die sich mit der europäischen Romantik ernsthaft beschäftigt haben, registriert haben. Denn die Romantik war eben nicht eine simple Rückbesinnung auf mittelalterliche Geborgenheit. Sie war auch nicht nur eine Fluchtreaktion auf die ersten Erscheinungen der als dämonisch begriffenen Industrialisierung.
Sie war zuallererst eine Flucht vor staatlicher Zensur, Bevormundung und Polizeiwillkür. Eine Zeit, in der ein Heinrich Heine später zu Recht den Spruch formulieren würde, dass, wer Bücher verbrennt, später auch Menschen verbrennen wird. Man versteht Beethoven noch viel besser, wenn man ihn derart verzweifelt in Wien sieht, hoffend und mitfiebernd, als der ängstliche und deshalb stockreaktionäre Kaiser dann doch das Heer reformieren muss und das Bündnis mit dem Volk und den Freigeistern suchen muss, als es darum geht, Napoleon zu besiegen. Sein Versprechen, eine Verfassung einzuführen, hielt er dann genauso wenig wie seine feudalen Genossen in Dresden oder Berlin.
Und wäre Beethoven nicht schon so berühmt gewesen, sie hätten ihn ganz gewiss auch verhaftet und in Staatsarrest genommen. Denn wer seine großen Kompositionen mit so offenen Ohren hörte wie es Dieckmann heute noch tut, der kann die republikanischen Töne nicht überhören und auch nicht die in Trauerklänge gekleidete Kritik am Triumph der Konservativen. Und auch nicht die Tatsache, dass Beethovens Helden nicht die Helden der offiziellen Geschichtsschreibung waren, sondern – wie in der „Eroica“ – der als aufgeklärt geltende preußische Prinz Louis Ferdinand.
Dieckmanns Essays, die zuerst in „Sinn und Form“ erschienen und in einer Zürcher Vortragreihe bzw. im Rundfunk, führen ihre Leser/-innen geradezu hinein in dieses Wien im frühen 19. Jahrhundert, die Welt, die Beethoven tatsächlich erlebte und in der er seine Zerrissenheit unverblümt in Noten setzte. So präzise, dass sie auch den Zuhörern im Konzertsaal die volle Ladung an Emotionen hörbar machte, das Mitfiebern, Hoffen, das Jubeln im Tanz, wenn ein Sieg scheinbar zum Greifen nahe ist, die forcierten Marschklänge, die genauso leicht in Triumphpassagen münden können wie in Trauer und Erschütterung.
Darin zumindest hatten viele Musikkritiker in späteren Jahren recht. Keiner hat vor Beethoven die Wucht der geschichtlichen Ereignisse so eindeutig und mitreißend in Musik gesetzt. Und mancher meint gar, das habe nach ihm erst recht keiner geschafft. Was wohl auch wieder ein Versuch ist, den Musiker zu kanonisieren und damit unschädlich zu machen.
Denn wenn man sein Leben unter einem mit eisiger Kälte neu installierten alten Regime als Hintergrund seiner großen Kompositionen nimmt, dann hört diese Musik auf, nur eine kleine historische Epoche zu orchestrieren, die man gemeiniglich mit Napoleon und „Befreiungskriegen“ verbindet, deren „Sänger“ ja die heutigen Rückwärtsgewandten wieder verteidigen, als ginge es um einen Heiligen Gral. Und nicht um die opportunen Mitläufer einer Geisteshaltung, die heute wieder genauso versucht, sich als frischgeboren zu verkaufen.
Nur die feudale Maskerade ist weg, die Beethovens Liebesleben derart tragisch gemacht hat, weil er – als Nicht-Adeliger – seine „ferne Geliebte“ nicht heiraten durfte und ihrem Schicksal letztlich hilflos zusehen musste. Eine Lebenstragik, die sich in zahlreichen seiner Kompositionen niedergeschlagen hat und die Dieckmann natürlich genauso feinsinnig erkundet mit all ihren Höhen und Tiefen, die sich nicht nur in Briefen, sondern auch in Kompositionen niedergeschlagen haben, die oft erst begreifbar werden, wenn man die biografischen Ereignisse in Beethovens Leben danebenlegt.
Denn eines ist für Dieckmann selbstverständlich: So eine Musik schafft einer nicht aus der Phantasie, auch wenn so manches Stück sich als „Fantasiestück“ darbietet. So etwas komponiert einer nur, wenn ihn das Leben mitreißt und er keinen Grund darin sieht, Gefühle herabzudimmen oder zu „verfeinern“, den Herrschenden also irgendwie schmackhaft zu machen. Wer Ohren hat, kann hören. Und es lohnt sich, die von Dieckmann untersuchten Kompositionen einfach wieder anzuhören – mit Dieckmanns sehr persönlichen Entschlüsselungen dazu.
Vielleicht sind es tatsächlich nur seine eigenen. Denn wie die Stücke zu interpretieren sind, hat ja auch Beethoven nur als knappe Anweisungen darüber geschrieben. Was jeder dann selbst heraushört, ist natürlich einerseits immer eine ganz persönliche Sache. Andererseits aber auch nicht, wenn man – wie Dieckmann – auch die bewusst eingesetzten Zitate erkennt und um deren Herkunft weiß.
Man kann auch mit Musik sehr deutlich werden. So deutlich, dass sich Musikkritiker dann geradezu verbissen in den Erklär-Topos „absolute Musik“ flüchten, die schillernde Schwester der „l’art pour l’art“. Da muss man sich dann weder mit dem Schicksal des Künstlers noch mit seiner Zeit und deren finsterer Personage beschäftigen. Und wenn man genug brave Kunstmacher findet, füllen sich die Museen und Sammlungen natürlich mit lauter banaler Nicht-Kunst, die nichts mehr erzählt und niemanden mehr aufregt.
Beethoven: 3. Sinfonie („Eroica2) ∙ hr-Sinfonieorchester ∙ Andrés Orozco-Estrada
Mitreißend wird Kunst erst, wenn sie zutiefst persönlich wird und spürbar macht, dass der Künstler eben nicht seiner Zeit entrückt über allem schwebt, sondern mittendrin steckt und mitfühlt und mitleidet. Wobei es nicht nur um die Entfesselung der Gefühle geht. Denn die können durchaus irritieren, wenn die Künstler versuchen, einem ästhetischen Original zu genügen, wie es die Romantik mit dem Geniekult zelebrierte. Als würden jetzt lauter aufgedrehte junge Leute nur noch von Herzeleid und Liebesschmerz singen.
Kunst, die den historischen und gesellschaftlichen Hintergrund ignoriert oder gar versucht, durch nette Salontapeten zu ersetzen, mag rühren. Aber sie reißt nicht mit. Auch wenn Dieckmann bilanziert: „Es ist ein wesentlich Neues, das mit Beethoven in die Musik kommt: In absoluten musikalischen Formen erzählt das kompositorische Subjekt von sich selbst.“
Das bezieht sich hier zwar direkt auf die Lieder „An die ferne Geliebte“. Aber es gilt – in einem viel größeren Rahmen – auch für seine Sinfonien. Hier setzt sich einer selbst zum Subjekt (und Spielball) der Zeitgeschichte und zeigt, für alle hörbar, dass man auch als Mensch betroffen sein darf, hin- und hergerissen, hoffend und verzweifelnd auf historischem Grund.
Und einer wie Beethoven weiß auch noch, dass er sich trotzdem zähmen muss, dass eine zur Biederkeit befohlene Zeit auch bedeutet, dass ein Künstler dennoch nicht alles zu Papier bringt. In London, so ist er sich sicher, könnte er viel produktiver sein. Seit Wellington und dem Sieg in der Schlacht bei Vitoria liegt seine große Hoffnung auf London, so wie sie zu Zeiten der Kreutzer-Sonate auf Paris ruhte.
Aber genauso gut weiß er, dass er in der Fremde eigentlich keinen Platz hat. Dass ihn mit diesem Wien mehr verbindet als die Gönner, die ihn schützen und unterstützen. Was Dieckman zwar nicht herausliest aus seinen Liedern. Aber natürlich steckt es darin. So, wie seine gebeutelte Liebe zu Josephine. Auch Künstler können oft nicht anders, sonst hören sie auf, lebendig zu sein. Der historische Ort ist tragischer Untergrund und Ursache aller Kreativität in einem. Gerade weil dieser Grund so zerrissen ist, gibt er diesem Komponisten die Wucht, in Noten zu bringen, was ihn innerlich aufwühlt.
Beethoven: Missa solemnis ∙ hr-Sinfonieorchester ∙ Wiener Singverein ∙ Andrés Orozco-Estrada
Was kein Trost ist. Davon berichten ja genügend Biografen. Irgendwann braucht auch der größte Titan so etwas wie Trost oder – wie in der „Misa solemnis“ – eine Vergewisserung, dass es so etwas wie Frieden geben kann. Hier bestens platziert in einer Messe zur Amtseinführung seines Gönners und Mäzens.
Für Dieckman natürlich eine herrliche Gelegenheit, über das Ringen Beethovens um seinen Glauben zu schreiben und seinen „naturreligiösen Gottesbegriff“, der sich deutlich unterscheidet von Goethes feierlich zelebriertem Pantheismus. Denn dieser Beethoven ist nicht mehr heil. Und er weiß, dass er in einer un-heilen Welt lebt und leben muss. „Betroffen hört man in dem kurzen Präludium des Benedictus eine neue Welt musikalischer Daseinsergründung aufgehen“, schreibt Dieckmann.
Und selbst hier donnert die verkrüppelte Zeitgeschichte hinein in die Musik. „Denn die österreichische Monarchie, deren Kaiser 1820 das zuvor gegebene Verfassungsversprechen gebrochen hatte, führt in diesem Jahr 1821 Krieg nicht gegen einen äußeren Feind, sondern gegen die progressiven Kräfte, die in dem Königreich Neapel politisch zum Zug gekommen waren … (…) das abrupte, geradezu schicksalhafte Eindringen von Kriegsmusik in das Dona nobis pacem der Missa und in den Anfang des vierten Satzes der Neunten Sinfonie steht vor dem Hintergrund dieser blutigen Offensive gegen die Kräfte der Freiheit und des Fortschritts.“
Diese großen Kompositionen sind ohne den historischen Untergrund nicht denkbar. Verständlich schon. Denn die kriegerischen Noten empfindet jeder, wenn die Stücke von begnadeten Dirigenten und gut geführten Orchestern dargeboten werden. Es sind eben nicht die reinen Jubelstücke, als die sie zuweilen präsentiert werden, als gelte es nur stimmgewaltig Europa, den Frieden und die Freude zu feiern. Denn diese Jubelchöre machen keinen Sinn, wenn man die lärmenden Kriegsgerätschaften im Hintergrund ausblendet.
Und auch deshalb wirken diese Kompositionen so modern, als wäre gar keine Zeit vergangen. Dabei hatte die Menschheit seitdem genug Irrwege, Irrtümer und Kriege. Aber die alte Hydra erhebt immer wieder ihren Kopf, rüstet Armeen auf und versucht die unruhigen Geister der Freiheit zu bändigen und niederzuwalzen. Haben wir wirklich nichts gelernt?
Vielleicht sollten wir einfach zuhören lernen. Dieckmann erklärt es sehr bildhaft und kenntnisreich und zeigt, wie nah uns dieser Komponist ist. Und wie anders das Geschichte begreifen lässt, wenn man sie mit diesem Musiker erlebt.
Das ist, so Dieckmann, „absolute Musik“ in dem Sinn, da es sprechende Musik ist „im tiefsten wie im höchsten Sinn, einen Seelenton ausbildend, so voller Kunst und voller Schicksal, dass er sich dem Hörer als etwas anträgt, das er längst in sich zu tragen glaubt, wenn er ihn zum ersten Mal vernimmt.“
Was vielleicht sogar zu vorsichtig formuliert ist. Denn was da anklingt, trägt der Zuhörer tatsächlich schon in sich. Es muss nur zum Klingen gebracht werden. Auch wenn so mancher nach dem Konzert nicht mehr weiß, wo ihm Kopf und Herz stehen. Denn draußen an der kühlen Luft geht’s ja meistens weiter wie gehabt, regieren unsere kleinen und großen Metterniche und Napoleons.
Da ähnelt das, was Beethoven macht, erstaunlich diesem „Hier stehe ich“ Luthers, wie Dieckmann im Epilog formuliert. „Beethovens leidensgespeiste und freudenfähige Emphase steht fremd in unserem Zeitalter blind entfesselter Utilitäten, die im Begriff sind, sich gegen uns zu kehren. Umso dringender brauchen wir ihn.“
Denn genauso fremd stand er in seiner Zeit mit ihren Utilitäten, die sich als nettes Biedermeier verkleidete. Eine scheinbar heile Zeit, die längst genauso zerrissen war wie alle Jahrzehnte danach. Das konnten die Wohlversorgten immer negieren. Nur solche Typen wie dieser Beethoven nicht, dem nichts ferner lag, als sich anzudienen und gefällig zu sein. Das zählt bis heute. Und wer sich auf Dieckmanns Essays eingelassen hat, hat auch den Schlüssel dazu.
Friedrich Dieckmann Beethoven und das Glück, Edition Ornament im auartus Verlag, Jena 2020, 18 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
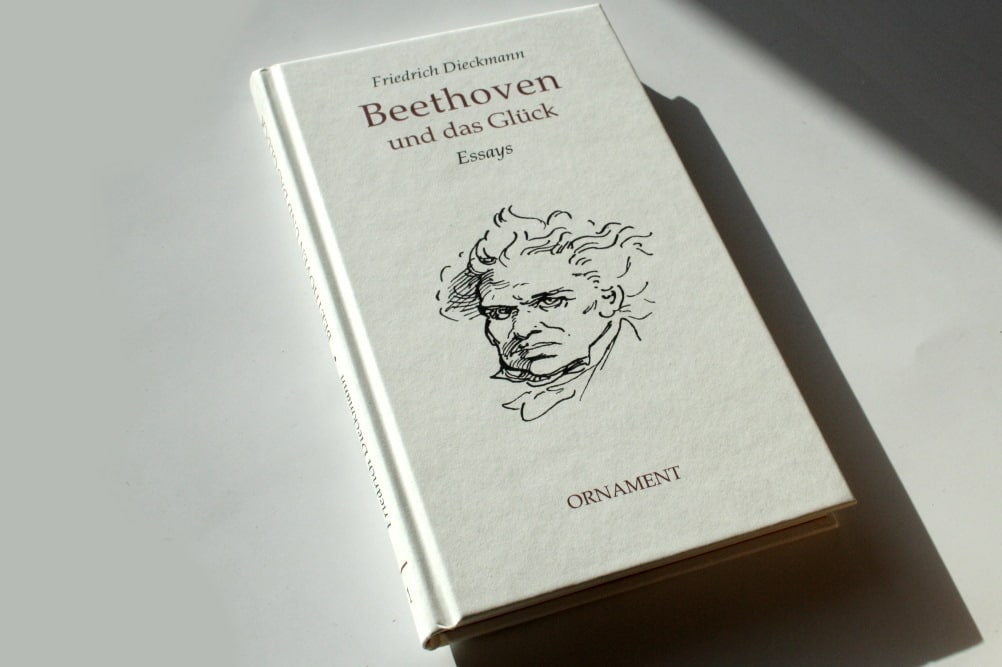














Keine Kommentare bisher