Die Buchmesse naht. Und überall liegen Bücher: auf dem Küchentisch. Auf dem Plattenspieler. Auf dem Sessel. Auf dem Nachttisch, um einfach mal Kurt Tucholsky an dieser Stelle zu parodieren, der ja auch Bücher liebte und rezensierte. Und sich darüber wunderte, was Verlage alles so verlegen. Denn natürlich weiß kein Mensch wirklich, was die noch lesenden Menschen dann tatsächlich lesen. Zum Glück gibt es sie noch, die Leserinnen und Leser. Die sich vom Etikett „Portraits“ nicht irritieren lassen sollten.
Denn es sind keine Portaits. Auch keine Porträts. Walter Thümler ist kein Maler, kein Fotograf und auch kein Journalist. Er ist Dichter und Übersetzer. Er lebt in Wartenberg bei Wittenberg an der Elbe. Und seine Bücher erscheinen recht konsequent im Leipziger Literaturverlag. Zuletzt besprachen wir hier einen Band Sentenzen von ihm, Poetologische Notizen und den Gedichtband „Was draus wird“.
Der Mann macht sich seine Gedanken. Ein bisschen so wie die meisten von uns, wenn sie täglich ihre Zeitung lesen. Ein bisschen als Dichter, der sich die Schicksale vorstellen kann hinter den manchmal befremdlichen Nachrichten. Und wenn man das kann, dann kann man auch in die Rollen dieser Menschen schlüpfen – die der Täter, der Opfer, der Ratlosen, der Suchenden. Manche erkennt man wieder.
Sie waren wirklich große Aufregerthemen in den Zeitungen, auch wenn die meisten Zeitungen über das „Gottogott, wie schlimm!“ nicht hinausgekommen sind.
Rollen-Spieler
Das schaffen sie tatsächlich meistens nicht. Nicht mehr. Denn das war auch mal anders. Aber unsere Zeiten sind zum Gottogott-Moment zusammengeschrumpft. (Oder auf diesen amerikanischen OMG-Quatsch, dieses Rumgewundere von Leuten, die das für eine Gefühlsäußerung halten.) Die Nachrichten sind voller Helden und Monster, Bösewichte und Clowns. Abziehbilder, die nur noch die Oberfläche zeigen. Aber nicht mehr den Menschen, der in seiner Rolle steckt.
Manchmal hilflos, manchmal ist er auch nicht mehr als die Rolle (was noch viel schlimmer ist). Manchmal in Gewohnheiten und Erwartungen gefangen. Und am Ende völlig ratlos, wie er aus einer als sinnlos empfundenen Situation wieder herauskommt.
Logisch, dass Walter Thümler diese Menschen nicht porträtiert. Aber er schlüpft in ihre Rollen, verwendet andere Namen, verfremdet die oft beklemmenden Handlungen, aber er zeigt auch, dass man als Erzähler sehr wohl in die Innensicht von Menschen schlüpfen kann, die einem da täglich als Helden und Monster serviert werden. In die des Richters zum Beispiel, der seine eigene Rolle als richtende Instanz infrage stellt, oder in die der Mutter, die ihr Kind verhungern lässt, weil ihr neuer Lover sie nur ohne Kind haben will, in die der jungen Frau, die die Nase voll hat, sich von Leiharbeitsfirmen und Jobcentern verarschen zu lassen …
Ja, sorry für den harten Ausdruck. Aber wenn man das Menschliche in all diesen Gestalten sucht, wie es Thümler macht, indem er sie einfach selbst zum Sprechen bringt, dann merkt man auch, was sture Institutionen und selbstgerechte Ausbeuter mit Menschen anstellen. Wie sie deren Persönlichkeit und ihre Talente ignorieren, missbrauchen, regelrecht verachten.
Es ist eine von den Geschichten, die zeigen, dass es im Leben nicht darum geht, zu funktionieren und es den Herren mit der Verachtung für Underdogs immerzu recht zu machen. Denn dann verpasst man sein Leben und entdeckt nie, was einen wirklich begeistert, anspornt und mutig macht.
Gepaarte Leben
Manche Geschichten in diesem Buch sind auch ganz uralte Geschichten, wie die von der jungen Schönen, die sich mit dem Zimmermann, den sie liebt, nicht körperlich einlassen möchte und trotzdem schwanger wird. So kommt die Jungfrau zum Kinde.
Viele der kleinen Berichte, die Thümler in diesem Band gesammelt hat, sind Paar-Geschichten. Auch verstörende Paar-Geschichten. So verstörend, wie sie im Leben ja wirklich sind. Man findet sich, liebt sich – aber wehe, eine von beiden beginnt neue Interessen zu entwickeln und über die Beziehung hinauszuwachsen. Oder Wünsche an intensives Geliebtwerden zu entwickeln, aber nicht darüber reden zu können, weil sie den Zufriedenen an ihrer Seite nicht verschrecken will.
Oder einer findet die Wärme nicht mehr und geht aus Verzweiflung in den Puff, nur um dort zu erleben, dass er das eigentlich nicht kann. Womit er gleich noch eine Geschichte anstößt. Denn das ist ja eigentlich das, was Thümler hier durchexerziert: Zu zeigen, dass Geschichten immer weiter gehen. Dass das, was die Zeitung erzählt, nicht alles ist und schon gar nicht die ganze zu erzählende Geschichte.
So wie die Geschichte der Frau, die den Männern zuliebe immer ihre Kinder hat abtreiben lassen, nur um am Ende zu merken, dass das Leben für sie den ganzen Sinn verloren hat. Oder die Geschichte von dem Mann in der U-Bahn, der eine Frau zusieht dabei, wie sie die ganzen Mahnungen und Zahlungsaufforderungen liest, die ihr als Stapel ins Haus geflattert sind.
Auch so ein ganz normales Ereignis im Leben so vieler Menschen, bei denen ein einziges Unglück genügt, um sie in die Mühle der Schulden zu treiben. In diesem Fall hilft einer, ganz still und selbstverständlich. Und man merkt: Ja, so sollte es eigentlich in so einer Gesellschaft immer sein.
Das Recht der Reichen
Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft sollten das Allerselbstverständlichste sein.
Sind sie aber nicht. Womit man wieder bei dem Richter wäre, der genau weiß, dass er zwar Recht spricht – aber gerade den armen Seelen gegenüber meist ungerecht. Denn wenn einer schuldig wird, sind oft auch andere, Hartherzige, Ursache seiner Not. Aber wie zieht man Leute zur Verantwortung, die eigentlich erst dafür gesorgt haben, dass Menschen in Schuld geraten?
Sie sind doch die „feinen Leute“, die mit weißem Kragen jede Boulevard-Zeitung zieren. Verdienstvolle Leute, wie das meistens zu lesen steht, auch wenn sie hunderte kleiner Schicksale auf dem Gewissen haben.
Thümler schaut auf unsere Gesellschaft ganz offensichtlich mit dem mitfühlenden Blick eines Charles Dickens. Es sieht, dass die scheinbar so billigen Schicksale mit den dicken Überschriften eigentlich Romane sind, von denen wir nur einen Zipfel zu sehen bekommen. Meistens mit viel Entsetzen und Blut wie bei dem Terroranschlag auf eine russische Schule, den Thümler aus der Perspektive eines betroffenen Jungen schildert.
Und damit etwas macht, was eigentlich journalistische Tugend sein müsste: Die blutigen Ereignisse aus der Perspektive der Betroffenen zu zeigen, die, die darunter leiden, wenn die Mächtigen zur Gewalt greifen.
Aber wo sind die Grenzen des Einfühlens? Da, wo der Leser nicht weiß, wie Zeitungen wirklich ticken. So wie in der Svenja-Geschichte. Denn Zeitungsredaktionen empfinden sich in der Regel (auch nicht in Pandemie-Zeiten) als Sprachrohr der Regierenden. Sollten sie zumindest nicht. Auch wenn sie ihnen oft nach dem Munde reden und nicht hinterfragen, was ihnen vorgesetzt wird.
Macht und Ohnmacht
Was manche Redakteure dann meistens dadurch auszugleichen versuchen, dass sie hinterher besonders bissig schreiben und auf die Jagd gehen. Was es nicht besser macht. Aber in dieser Geschichte steckt auch ein bisschen Überschätzung.
Da sieht der kleine Leser in den großen Zeitungen eine Macht, die sie schon lange nicht mehr haben. Von der aber Chefredakteure nur zu gern glauben, sie hätten sie noch. Selbst wenn die Auflagen schwinden und die Leser sich in Nicht-Leser verwandeln, weil sie an anderen – wesentlich dubioseren – Quellen hängen. Und nicht ahnen, wie eng es längst zugeht in den Redaktionen, personell und materiell. Und damit letztlich auch thematisch.
Dem Druck eines enthemmten Marktes geschuldet, der viel unbarmherziger wirkt, als es die leichtgläubigen Leser ihrer gescholtenen Regierung zutrauen.
Ein Markt, der nicht nur Frauen und Männer verschlingt und ausbeutet, was nicht ausgebeutet werden darf. Sondern auch die Seele einer Gesellschaft auffrisst, indem er ihren inwendigen und notwendigen Dialog zerstört. Dann werden Ungetüme wie Wachstum, Wettbewerb und Effizienz zu heimlichen (und unheimlichen) Göttern. Und verschlingen das, worum es Thümler eigentlich in seinen 24 Geschichten geht: das Recht der Menschen, ein selbstgewähltes Leben leben zu dürfen – mit Anstand, Stolz und Zuversicht.
Es sind nicht die Medien, die die Lethargie erzeugen, sondern das bewirkt der gefühllose Mammon, der nur die eigene Vermehrung kennt. Aber keine Liebe, keine Achtung, keine Rücksicht für die Menschen, die sich seinen Regeln fügen müssen, sonst werden sie zermahlen.
Das ist es doch, was die Seele unserer Gesellschaft zerfrisst. Oder irre ich mich da? Mit Blick auf die Menschen, in deren Perspektive Thümler schlüpft, ganz bestimmt nicht. Und es ist diese Sicht aufs Lebendigseinwollen, die zählt. Nichts anderes. Was zu erzählen wäre, immer und immer wieder. Denn sonst ändert sich nichts, wenn Menschen nicht anfangen, ihre zugewiesenen Rollen aufzugeben und nach dem zu suchen, was ihnen im Lebe wirklich Wärme und Geborgenheit gibt.
Walter Thümler „24 Portraits“, Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2024, 19,95 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
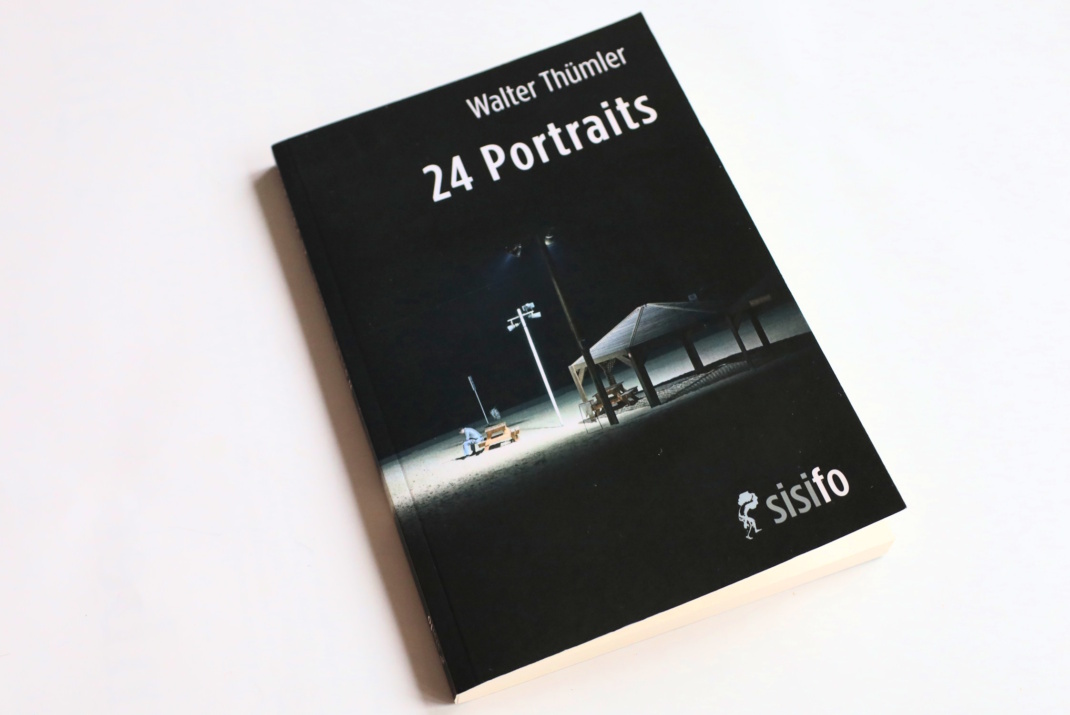


















Keine Kommentare bisher