Vor 20 Jahren gab es die letzte große Ausstellung zum Werk des Leipziger Malers Bernhard Heisig (1925–2011) in Leipzig, einem der großen Drei, die in Leipzig die Leipziger Schule begründeten. Seit dem 20. März zeigt das Museum der bildenden Künste wieder eine große Geburtstagsausstellung für Heisig. Aus gegebenem Anlass. Denn in diesem Jahr wäre Bernhard Heisig 100 Jahre alt geworden. Ein dickes Geburtstagsbuch gibt es noch obendrauf.
Eines, das sich deutlich von üblichen Katalogen unterscheidet. Denn federführend dabei war Heiner Köster, der mit seiner Frau Marianne einer der begeistertsten Sammler von Bildern aus Heisigs Werkstatt ist. Es auch schon zu Zeiten war, als Rechthaber in Ost und West meinten, um den Maler aus Leipzig ihre Deutungsschlachten schlagen zu müssen. Schlachten, die sich so regelmäßig wiederholen, wie wieder einmal ein beleidigter Kollege oder ein forscher Kolumnist meinen, einen neuen „Bilderstreit“ anzetteln zu müssen.
Von Galeristen und Großkritikern ganz zu schweigen. Denn das merkt man ziemlich bald in den Beiträgen in diesem Buch und in den ausführlichen autobiografischen Notizen am Ende, dass die Arbeit ostdeutscher Künstler genauso regelmäßig in die deutsch-deutsche Deutungsschlacht gerät wie die Arbeiten ostdeutscher Autor/-innen.
Und man merkt dahinter oft genug das befremdliche Beharren, alles, was ostwärts der einstigen Zonengrenze geschaffen wurde, abzuwerten und auszugenzen. Und eine westdeutsche Deutungsmacht zu behaupten, die sich seit nunmehr 35 Jahren sperrt dagegen, den ostdeutschen Teil der Kunst auch nur als gleichwertig zu betrachten. Von eigenständig und hochkarätig ganz zu schweigen.
Und auch von den behandelten Themen her. Denn während sich die maßgebliche westdeutsche Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg nur zu willig in ungegenständliche und abstrakte Malweisen verabschiedete und eigentlich 40 Jahre lang nichts Wesentliches zur deutschen Vergangenheit und zur rumorenden Gegenwart zu sagen wusste, zeichnet sich gerade das, was die Leipziger Schule hervorbrachte, als eine sehr intensive, oft genug schmerzliche Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Gegenwart aus.
In großen Maltraditionen
Und natürlich – was aus ostdeutscher Perspektive sowieso immer klar war – als eine Herausforderung an die platte und puristische Sicht der SED-Granden auf das, was aus ihrer Sicht „sozialistischer Realismus“ zu sein hatte. Statt pompöser Bejahungen für das „falsche” Bild des ostdeutschen Arbeiter- und Bauernstaates zu liefern, knüpften sie an die großen gegenständlichen Maler der deutschen Kunstgeschichte an. Heisig insbesondere an Mathas Grünewald, Max Beckmann, Otto Dix und Lovis Corinth. Maler, die ihm jene Möglichkeiten aufzeigten, mit denen er seine eigenen Traumata bewältigen und bearbeiten konnte.
Was nie ein Geheimnis war, auch wenn das westdeutsche Feuilleton aus allen Wolken zu fallen schien, als bekannt wurde, dass sich der 17-jährige Heisig zur Waffen-SS gemeldet hatte und die letzten Kriegsjahre als Panzerfahrer erlebte. Spätestens mit dem 1989 bei Reclam erschienenen Heft „Der faschistische Alptraum“ hätten sie es alle wissen können. Ein Buch, das auch Heisigs Lithografien beinhaltet, mit denen er dem Grauen seiner Kriegserlebnisse Ausdruck gegeben hat.
Und diese Lithografien gehen bis in die 1950er Jahre zurück und waren auch in der DDR immer randständig, denn eine wirkliche Beschäftigung mit den Verstrickungen der Menschen in die Grausamkeiten des Nazi-Reiches wollte man nicht. Gefragt waren „sozialistische Helden“, unbeleckt von all dem, was die nationalsozialistische Herrschaft mit den Menschen angerichtet hatte.
Und Heisig beließ es nie bei Zeichnungen. Mit seinem ganz persönlichen „faschistischen Albtraum“ beschäftigte er sich auch in unzähligen Bildern. Bilder, die ihre Betrachter regelrecht miterleben lassen, wie Krieg und Herrschaft das Menschliche zertrampelt und Menschen zu willigen Mitläufern machen, die in Uniform nur zu bereit sind, den schmetternden Fanfaren hinterherzulaufen.
Immer wieder tauchen die noch im Tod in großer Geste erstarrten Soldaten auf, die in strammer Haltung noch immer den Behauptungen der dröhnenden Lautsprecher glauben. „Heroenwechswel“ heißt eines dieser typischen Heisigschen Gemnälde, in denen er den Sturz einer alten Kriegerstatue gemalt hat. Welcher neue Held wird dann an gleicher Stelle aufgestellt? Braucht es schon wieder neue Helden?
Die Verführbarkeit des Menschen
Wenn Heisig eines wusste, dann, wie leicht man als junger Mensch verführbar ist, wenn eine einzige Ideologie das Land durchdröhnt und den Menschen einhämmert, das Land würde sich gegen eine „Welt von Feinden“ verteidigen müssen. Verführung passiert über Emotionen, Propaganda, Ikonen und Tschingderassabumm.
Und so durften die Parteigewaltigen durchaus annehmen, dass die Maler aus der HGB Leipzig, die auf den großen Kunstausstellungen in Dresden ihre Bilder zeigten, die regierende Kunstdoktrin tatsächlich infrage stellten. Nicht dem Kanon genügten, den die kulturunwillige Nomenklatura in den 1960er Jahren definiert hatte. Doch in mehreren Essays und den Texten im autobiografischen Teil wird deutlicher, dass diese Deutungshoheit der Funktionäre schon in den frühen 1970er Jahren obsolet war.
Die im Verband bildender Künstler versammelten Künstlerinnen und Künstler ließen sich die Vormundschaft der parteitreuen Hardliner viel früher nicht mehr gefallen als die Schriftsteller in ihrem Verband. Sie wählten die Hardliner ab und wählten lieber eine Willi Sitte zum Präsidenten, auch wenn sie lieber Heisig gehabt hätten, dessen Bilder das eindimensionale Geschichtsverständnis der SED immer wieder mit Lust und Farbenwucht unterminierten.
Auch mit Heisigs Lieblingsmotiv: der Pariser Kommune, das Heisig ebenso ein Leben lang beschäftige wie seine quälenden Kriegserlebnisse oder später auch noch die neue Begeisterung für den preußischen Kriegskönig Friedrich II. Doch wie sein großes Vorbild Otto Dix malte er keine Schlachten und schmetternden Siege, sondern das Leid und Grauen des Schützengrabes. Womit er Bilder schuf, die die Betrachter immer wieder mit sich selbst konfrontierten. Wie verführbar sind sie? Wie leicht lassen sie sich von schallenden Reden dazu bringen, zum Morden auszuziehen und im Schlamm der Schützengräben zu verrecken?
Der fehlbare Mensch
Manch ein Kritiker bescheinigte Heisig ein zutiefst depressives Weltbild. Aber vielleicht trifft genau das Gegenteil zu, dass hier einer immer mit menschlichsten Anspruch malte – keine Heiligenbilder, sondern den Menschen in seinem Leid und seiner Fehlbarkeit. Und seinen Träumen, die oft genug unerfüllbar sind. Oder an Übermut scheitern wie der Flug des Ikarus, den Heisig ebenso immer wieder in seinen Bildern platzierte. Vor Heisigs Bildern kann man nicht stehen und nicht betroffen sein.
Auch wenn die vielen bildlichen Zitate, die immer wieder auftauchen, manchen Betrachter überfordern. Auch wenn eins nie zu übersehen ist, wie Heisigs Lebensgefährtin Gudrun Brüne in ihrem Text deutlich macht: die Leidenschaft, mit der Heisig immer gemalt hat und oft auch Bilder immer wieder übermalt hat.
Die Entstehung des Buches hat Gudrun Brüne noch miterlebt, das Buch selbst nicht mehr.
Aber ihr Beitrag reiht sich ein in mehrere sehr persönliche Erinnerungen an Bernhard Heisig – von Eduard Beaucamp, dem „Entdecker“ der Leipziger Schule, bis zu Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der sein Porträt für die Galerie im Bundeskanzleramt unbedingt von Heisig gemalt haben wollte. Mit dem Werk und den Vorbildern Heisigs beschäftigen sich dann mehrere hochkarätige Kunstwissenschaftler.
Sie zeigen das auf, was die meisten Betrachter im Schulunterricht meist nie gelernt und gehört haben – nämlich den reichen Kanon deutscher Malerei, aus dem Heisig seine Anregungen bezog. Auch da war er unverwechselbar, stritt gar nicht ab, dass Maler von anderen Malern lernen, sondern hielt das für den natürlichsten Vorgang der Welt. Und alle Schüler, die bei ihm als Dozenten an der HGB gelernt haben, werden es bestätigen.
Wobei die biografischen Exkurse eben auch deutlich machen, dass es der erstmals zum Rektor berufene Bernhard Heisig war, der die HGB überhaupt erst zur Ausbildungsstätte hochkarätiger Malerei machte. Die dann als Leipziger Schule Furore machte. Nicht nur, weil sie mit ihrer Gegenständlichkeit klassische Kunsttraditionen fortführte, sondern weil diese Gegenständlichkeit die Auseinandersetzung mit dem Bild geradezu erzwang. Und bis heute erzwingt.
Schlüssel zu Heisigs Bilderwelten
Mariane und Heiner Köstef ließen es sich natürlich nicht nehmen, auch die Gemälde besonders vorzustellen, die sie in ihrer eigenen Sammlung haben. Jedes Bild mit ganz persönlichen Bezügen angereichert, so dass man hier auch nachlesen kann, warum sich ein sammelfreudiges Paar so für die Bildwelt Bernhard Heisigs begeistern konnte. Was auch ein Zugang für jeden Anderen ist, der erst einmal nur wie erschlagen vor diesen Bildern steht und noch nicht weiß, wie er sie für sich erschließen könnte.
Es ist eine kleine Schule des Sehens. Und auch des Verstehens, da die Kösters Bernhard Heisig immer wieder auch im Atelier besuchten und selbst Porträt saßen. Und auch bei ihnen sind es Themen, die ihnen einen besonderen Zugang zu Heisigs Werk eröffneten – von „Der alte gejagte Jude“ bis zu den Weißclowns, den Puppenspielern und dem Faust-Motiv, das in Heisigs Werk ebenso eine unübersehbare Rolle spielt. Davon, dass er für Reclam den ganzen Faust illustriert hat, ganz abgesehen.
Aber es wird auch deutlich, dass man zum Entziffern Heisigscher Bilderwelten wenigstens den klassischen Literaturkanon kennen sollte. Auch so ein Thema von Geschichte: Wer diese Literatur nicht kennt, hat wichtige Selbst-Auseinandersetzungen der Deutschen mit ihren Welt-Konflikten schlicht nicht verstanden und nicht wahrgenommen.
Vielleicht war es auch das, was westdeutsche Kritiker dann so verärgerte: dass die Leipziger Bilderwelten sie zum Hinschauen und zur Auseinandersetzung zwangen. Dass man da nicht einfach mit ein paar kunstwissenschaftlichen Phrasen drüberwischen konnte, sondern Motive lesen und verstehen musste. Eine echte intellektuelle Herausforderung. Aber die mussten auch schon die Genossen im ZK der SED akzeptieren. Wohl wissend, dass auch die Dresdner Kunstausstellungen nur deshalb so viele Besucher anzogen, weil da auch diese frappierenden Bilder von Heisig und Kollegen hingen.
Heiner Köster (Hrsg.) „Erinnern und verantworten. Bernhard Heisig zum 100. Geburtstag“, E. A. Seemann Verlag, Leipzig 2025, 42 Euro.
Informationen zur Ausstellung „Bernhard Heisig. Geburtstagsstilleben mit Ikarus” im MdbK findet man hier.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
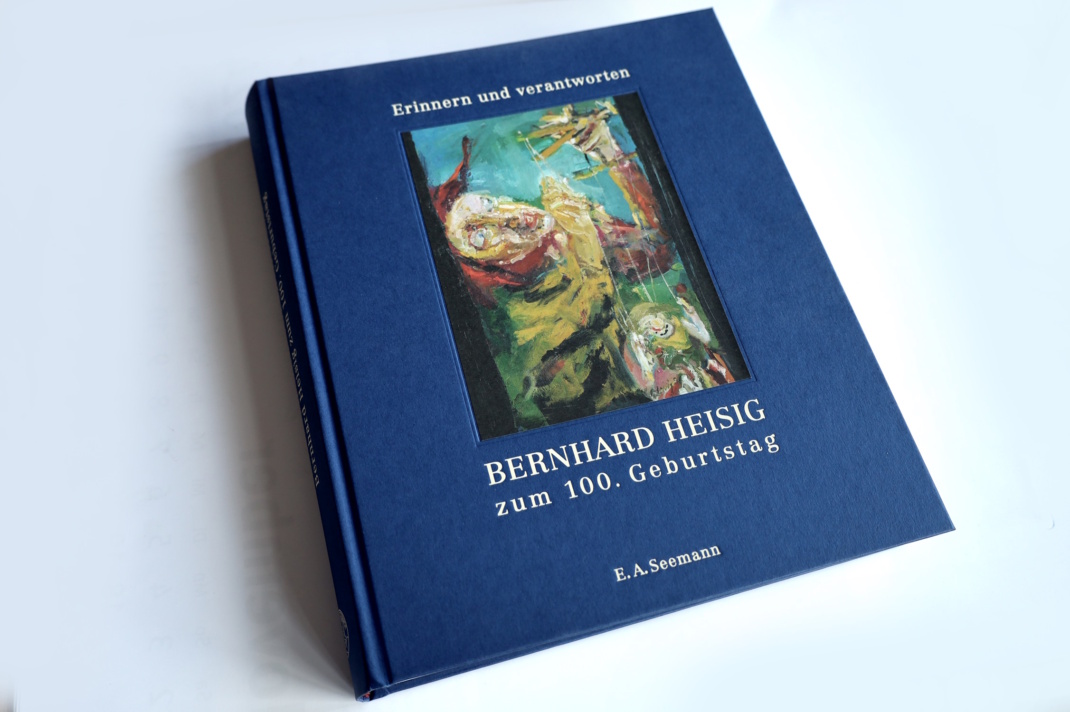

















Keine Kommentare bisher