Auch Dichter sind Philosophen. Erst recht, wenn ihnen eine philosophische Aufgabe gestellt wird, wie es die Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik für dieses „Poesiealbum neu“ getan hat. Denn wer nach „Guten Nachrichten“ fragt, der stellt in Grunde die Frage aller Fragen: Was ist eigentlich gut? Das klingt – auf Nachrichten bezogen – nur scheinbar technisch. Denn auch Journalisten sollten eigentlich nachdenken, bevor sie Nachrichten in die Welt senden, ob sie gut oder schlecht sind. Tun sie aber meistens nicht. Horror verkauft sich besser.
Der Mensch ist so. Er kann nicht anders. Bei Gefahren, die er wahrnimmt, steigt sein Adrenalinspiegel. Da wird er aufgeregt und alarmiert. Denn in der freien Wildbahn, in der wir geworden sind, was wir sind, bedeuteten schlechte Nachrichten, dass man schleunigst die Beine in die Hand nahm. Dafür wird das Adrenalin im Blut gebraucht. Da bleibt keine Zeit fürs Abwägen und Nachdenken. Wer nicht rennt, kann schon im nächsten Moment zur Beute werden.
Aber was passiert, wenn diese menschliche Veranlagung auf eine Medienwelt trifft, in der Alarmismus, Panik, Horror und Schreckensbilder dominieren? Und das nicht grundlos, denn sie ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich. Was aber Aufmerksamkeit auf sich zieht, das bringt Klickzahlen und Reichweite. Sodass wir bekommen, was am besten klickt: lauter schlechte Nachrichten.
Das, was wir nicht (mehr) sehen
Da hilft auch nicht, wenn man das Ganze – wie Jan Kuhlbrodt, der das Vorwort für diesen Band schrieb – schon von vornherein philosophisch sieht. Denn das Gute ist, wie es aussieht, ohne das Schlechte nicht zu haben. Und umgekehrt. Das zielt dann auf unser ganz gewöhnliches Leben und unsere oft fehlende Aufmerksamkeit für das, was gelingt, funktioniert, uns glücklich macht. Wir nehmen es so hin. Es ist eigentlich das Normale.
Aber das Normale hat keinen Nachrichtenwert. Auch wenn es Robin Bergauf gleich im ersten Gedicht einmal kräftig gegen den Strich bürstet: „Heute hat mal jemand anders die Nachrichen ausgewählt“. Da hatten in Halle mal alle gute Luft und trinkbares Wasser, „keiner hat heute vergessen / lebensfroh dankbar zu sein“.
So weit zu den Nachrichten.
Die uns immer wieder von uns selbst abbringen. Von Dingen erzählen, die uns gar nicht berühren. Uns aber runterziehen. Und abbringen davon, die eigentliche Schönheit unseres Lebens noch wahrzunehmen. Denn die ist leiser, nicht so schrill. „Aber eigentlich des Feierns und Glockenläutens erst so richtig wert“, wie Jochen Berendes in seinem Gedicht zeigt. Das dann schon hinüberleitet in die tatsächliche Welt der Dichterinnen und Dichter.
Die auch deshalb so wenig gelesen werden, weil sie mit offenen Augen und Sinnen immerfort das Gute, Schöne und Überraschende in unserem Leben suchen. Das, von dem alle wissen, dass sie es sowieso schon kennen. Obwohl sie es – festgetackert an ihren tragbaren Bildschirmen – schon gar nicht mehr sehen. Regelrecht vorbeilaufen an ihrem eigenen Leben, da und eben doch dich nicht da.
Leben in Nachrichten
Ganz kurz taucht diese digitale Welt der Nicht-Verbundenheiten in Franziska Beyer-Lallaurets Gedicht „What’s up“ auf, das davon erzählt, wie unser unendliches Warten auf Rückmeldungen aus den asozialen Netzen irgendwann endlich mit einem blauen Häkchen, einem Smiley, ein paar guten Worten belohnt wird. Gute Frage: „Ein Grund zum Hüpfen?“
Vielleicht auch nicht. Vielleicht eher Anregung, auf die vielen Botschaften zu achten, die uns außerhalb dieser kleinen Apparate erreichen. Was dann im Grunde fast alle Einsender für diesen Band getan haben. Nach Dichters Art. Man muss ein bisschen blättern. Die Gedichte sind – auch wenn das nirgendwo so markiert ist – nach der Nähe zu dem sortiert, was man so „Nachrichten“ nennt. Und dem, was aufmerksame Autor/-innen so alles empfangen, wenn sie ihre Sinne öffnen.
Da geht es bei Wolfgang Stock los mit den guten Nachrichten, die ein Spatz vom Dach zwitschert, der in Leipzig lebende katholische Priester Andreas Knapp denkt gleich mal an das Buch, das schon traditionell „Gute Nachrichtren“ heißt, Ralf Burnicke zeigt, wie sich aus dem kleinen Wort „blau“ gleich eine Bilderflut entfaltet und Holger Brülls bringt kurz auf den Punkt, wie sich das nächtliche Leuchten von Leuna ganz selbstverständlich zu einer Nachricht für den Vorüberfahrenden entfaltet.
Wir sind umgeben von diesen Botschaften einer reichen, lebendigen Welt. Die wir kaum noch wahrnehmen, weil wir uns auf digitale Signale versteifen, auf fremde Imitationen starren. Als wären wir gar nicht da. Und so verpassen wir unser eigenes Leben, stecken in fremder Leute (falschen) Geschichten fest und übersehen die Eselsdiestel (von der Carmen Winter schreibt), das herrliche Gelb der Liebe (von dem Irena Habalik frei nach Karl Krolow berichtet) oder das schöne „Irrlichtern“ der Gedanken, wenn man rücklings im Gras in den knallblauen Himmel schaut (wie es Sibylle Hoffmann tut).
Das ungesehene Gute
So liegt eigentlich die Empfehlung in der Luft, die Eline Menke gibt: „Besser man lässt sich drauf ein“. Auf Wind, Garten und Wolken zum Beispiel. Oder eben die jahreszeitlichen Botschaften der Natur, wie es Karl Rodenberg in „Zuversicht“ tut. Natürlich ist der Tempowechsel abrupt. Denn das „Nachrichten“-Geschnatter lebt von Hektik, Gedränge und Eile. Alle ist immer gleich wichtig. Bevor es vom nächsten Wichtig überholt wird. Ein atemloses Strömen, Heulen und Tremolieren.
Während die meisten Gedichte in diesem Band eben von einem anderen Tempo erzählen. Dem Tempo von Menschen, die sich auf die Welt um sie herum noch einlassen. Unruhig, neugierig, erwartungsvoll. Denn da kommt immer was. Nur halt meistens ganz einfach Gutes. All das Kleine, Selbstverständliche, das unser Dasein trägt. So wie es Gert Schmidt im kürzesten Gedicht in diesem Band auf den Punkt bringt: „es ist gut.“
Ist das nun enttäuschend, dass sich die Mehrzahl der Beisteuernden dem angedeuteten Aufruf verweigert hat, sich den „Nachrichten“ des Tages zu widmen? Eigentlich nicht. Eher ist es erhellend, aufmunternd, dass die meisten gar keinen Stoff sehen in den ganzen aufs Schlechte fokussierten Meldungen der Nachrichtenkanäle. Da steckt keine Poesie. Nur Dummheit, falsche Wichtigkeit.
Und was uns selbst geschieht, sehen wir nicht. Übersehen es, weil wir den schrillen Müll im Kopf haben. Dabei passiert das Aufregende gleich neben uns. „Das Glück ist noch nicht geboren“, schreibt Erika Dietrich-Kämpf. Und dabei ist es schon da, freut sich die Großmutter mit allen Sinnen über das noch ungeborene Enkelkind.
In der Stille der Sanduhr
Überhaupt: die Kinder. Sie tauchen hier auf einmal auf, in lauter Gedichten, in denen sie geboren werden, die Alten wieder das Singen lehren oder fragen, was der Tod ist. Da fällt es nicht nur Peter Feler schwer, dafür Worte zu finden. Denn wenn es wirklich ums Leben geht, helfen die „Nachrichten“ nicht. Da kommen auch Väter ins Grübeln, weil die Frage sie daran erinnert, dass es eine Menge zu verlieren gibt in diesem Leben.
Denn genau das ist uns geschenkt. Samt Erinnerung an die seltsamen Wege des Erwachsenwerdens (wie in Ralph Grünebergers Gedicht „BMI“). Zeit, manchmal auch nur eine Millisekunde. Manchmal genug, um „in der Stille der Sanduhr“ (Jutta von Ochsenstein) alles Mögliche klingen zu hören. Im Grunde ein Schwung von lauter Gedichten, die uns daran erinnern, dass das Wichtige nicht aus kleinen Apparaten kommt.
Sondern vor unseren Augen stattfindet, wahrnehmbar, wenn wir unsere Sinne wieder aufspannen und bereit sind, das Nächstliegende zu erspüren. Und zu würdigen. In manchen Gedichten spürt man die Einsamkeit. In anderen werden die kleinen Berührungen zur Begegnung mit dem, was unser Leben tatsächlich aufregend gemacht hat. Berichtenswert.
Auch wenn am Ende die Hand zittert und nur die Erinnerung bleibt. Aber was sind Erinnerungen anderes als Nachrichten, die ihren Empfänger tatsächlich erreicht haben? Erzählungen davon, dass wir wirklich da waren. Mit allen Sinnen. Und vielleicht ist es am Ende das Beste, was man sagen kann: „Das war ein Leben / Wie ein Sommerabend auf dem Land“, wie es Andreas-Wolfgang Rohr formuliert.
Aber wer liest noch Gedichte, wenn er sich jeden Tag das Gehirn mit „Nachrichten“ wegballern kann? Süchtig nach immer mehr von aufgequirltem Ärger und Lärm. Als wäre das alles Zeug, das uns sättigen könnte. Was es aber nicht kann. Das weiß jeder, der sich – so wie es viele der Einsender/-innen für diesen Gedichtband getan haben – einlässt auf die Überraschungen und Schönheiten des eigenen Tages.
Der manchmal Alltag ist, aber das Besondere meist sichtbar werden lässt, wenn wir die Augen öffnen und bereit sind, das eigene Leben als gute Nachricht zu verstehen.
Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik (Hrsg.) „Poesiealbum neu. Gute Nachrichten“, Edition kunst & dichtung, Leipzig 2025, 8,70 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
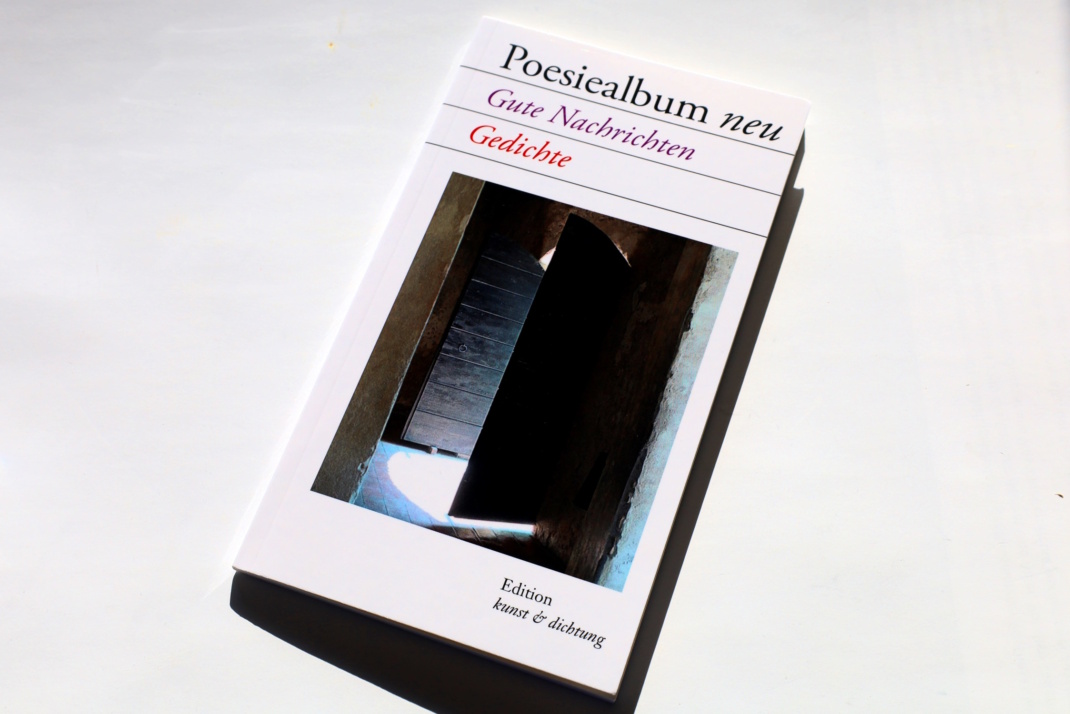

























Keine Kommentare bisher