Wie ist das eigentlich mit der Liebe im 21. Jahrhundert? Geht das eigentlich noch? Berge von Romanen beschäftigen sich mit diesem Thema. Und machen – je mehr man liest – eigentlich nur eins immer deutlicher: Je mehr man darüber grübelt, umso unmöglicher wird es. Erst recht in einer Gesellschaft, die alles klären, analysieren, bewerten will. Und nicht nur junge Leute in tiefe Krisen stürzt, weil sie die „perfekte Partnerschaft“ einfach nicht finden. Da hilft es auch nicht, sich auf die Couch zu legen.
Oder ständig zu grübeln. Oder sich Vorwürfe zu machen, dass der andere nie so war, wie man das erwartet hat. Und so gelingt es auch Karin Nohr nicht, die Barriere zu überschreiten, die ihr Buchheld Pierre in seinem Leben mit der anspruchsvollen Colette erlebt. Pierre ist Psychoanalytiker – so wie die Autorin selbst.
Und Mona Lisa taucht nicht wirklich auf, erscheint nur als Imagination in seinem Sprechzimmer. Traumbild, Sehnsuchtsbild. Die Frau, die den Betrachter immer geheimnisvoll anlächelt. Und einfach durch ihr Da-Sein das Gefühl vermittelt, er wäre gemeint.
Denn dieses Gefühl hat Pierre im Zusammenleben mit Colette in einer Eigentumswohnung in einem Pariser Wohnturm schon lange nicht mehr. Womit es ihm wohl so geht wie Millionen Männern, die durch ihre Partnerschaft tappen wie durch einen Nebel, völlig verunsichert von den Signalen, die sie bekommen. Zu Gesprächen über ihre Gefühlslagen herausgefordert, die in der Regel so gründlich scheitern wie Therapien auf der Couch. Fordern Frauen zu viel? Sind sie zu drängend in ihrem Wunsch, ihre Männer zum Reden zu bringen?
Verwirrung mit Madeleine
Die Gesprächsversuche zwischen Pierre und Colette enden in der Regel in Schweigen, Abbrechen, Verwirrung. Und Misstrauen natürlich. Denn das sind zwei Seiten einer Medaille: das Scheitern der Gespräche und der Verdacht, der andere könne längst eine andere haben. Diese Mona Lisa zum Beispiel.
Die auch Colette nicht antrifft, als sie Pierre in seiner Praxis überrascht. Ein bisschen Schwung kommt in die Beziehung, weil Colette auch noch eine Freundin hat – die selbstbewusste (?) Madeleine. Mit der sie ein Kind haben möchte. Und da bietet sich ja an, dass Pierre zum Samenspender wird.
Ein Spiel, das er nach einiger Überredung mitspielt. Es sieht wie eine moderne, offene Beziehung aus, was die drei da miteinander praktizieren. Aber schon bald stellt sich heraus, dass das Ganze eher eine Kopfgeburt ist. Mit dem Ergebnis, dass erst Pierre sich ausgebootet und aus der Wohnung komplimentiert sieht und am Ende selbst Colette verlassen in der Provinz sitzt.
Denn irgendwie hat diese Madeleine sich das alles ganz anders organisiert. Und Pierre muss erfahren, dass er nicht mal der Vater des Kindes ist. Was ihn zutiefst trifft. Denn auch Männer entwickeln nun einmal Vatergefühle, wenn ein kleines Kind in ihre Welt kommt.
Dagegen gibt es kein Kraut. Aber was tun? Denn über dem ganzen Hin und Her hat sich Pierre auch noch von Colette scheiden lassen, ist Colette in eine tiefe psychische Krise gestürzt, während Pierre in Deutschland neu startet. Denn Psychoanalytiker werden ja in unserer kaputten Gesellschaft allerorten benötigt. Wohin sollten wir mit unseren Kopfproblemen und den ganzen Vermutungen, in unserer Kindheit sei gewaltig etwas schiefgelaufen, sonst gehen?
In Pierres Kopf
Was ja auch nach Pierres Perspektive zu stimmen scheint. Wirklich erklärfreudig sind seine Eltern nicht. Und die Geschichten um seine Großeltern scheinen auch irgendwie nicht zu stimmen. Wer kennt das nicht? Die Alten reden immer um den heißen Brei herum. Und die Kinder leiden dann unter Beziehungsproblemen. Oder so ähnlich. So betrachtet, ist das ein analytischer Roman, in dem man quasi immerfort dabei ist, Pierre zuzuhören, wie er sein Handeln und seine Beziehungen analysiert.
Ein in der heutigen Belletristik nur zu gern benutztes Mittel. Nur: Es erzählt nichts. Das ist das Problem. Die zu große Nähe zum beobachteten Objekt verhindert die tatsächliche Nähe. Es fehlt diese kleine, aber notwendige Distanz, die den Lesern den Kamerablick erlaubt.
Denn es geschieht nie das, was in unseren Köpfen als Durcheinander vor sich hin grummelt. Deshalb funktionieren auch all die Gespräche nicht, die Frauen mit ihren ach so wortfaulen Partnern versuchen. Das Leben entzieht sich der Psychoanalyse. So traurig das klingt. So funktioniert unser Denken und Fühlen nicht.
Und das Ergebnis: Man begreift einfach nicht, was diesen immerfort in seinen Grübeleien verfangenen Pierre eigentlich an Colette fasziniert und bindet. Was Colette will, bleibt ebenso ungreifbar. Und so farblos wie die Eigentumswohnung hoch über Paris. Die sich der landläufige Bewohner dieser Welt ohnehin nicht vorstellen kann. Längst haben sich die Lebenswelten der Gutverdiener von denen der armen Leute hienieden radikal entkoppelt.
Sorgen ums tägliche Brot haben Pierre und Colette nicht mal während der Corona-Zeit, in der sich ihre Geschichte zuspitzt und der Kinderwunsch alles umkrempelt. Da verwandelt sich natürlich der Blick auf das Leben und das, was manche Leute für Liebe halten. Wenn man es nur dafür hält, muss man es natürlich analysieren.
Perfekt scheitern
Und so führt diese analytische Geschichte, in der letztlich nur Madeleine „ihr Ding durchzieht“, am Ende zu der oben genannten ganz elementaren Frage: Wissen wir überhaupt noch, was Liebe ist? Oder laufen wir Schimären hinterher, weil wir Bilder von Perfektion und Alles-Aussprechen im Kopf haben? Ansprüche an die Menschen stellen, mit denen wir uns liieren, die selbst das Allermenschlichste noch zu einem Ort des Wetteiferns und Perfektmachens werden lassen?
Genau das schwingt in dieser Geschichte mit. Finden wir also unsere Wegbegleiter/-innen nicht mehr, weil wir gar kein Gefühl mehr dafür haben, wann uns Menschen wirklich nah und wichtig sind? Ganz offensichtlich beantworten das in diesem Buch sowohl Pierre als auch Colette falsch. Setzen viel zu hohe Erwartungen aneinander – und scheitern. Scheitern selbst da, wo sie sich – wie Pierre – bereitwillig auf wagemutige Beziehungsexperimente einlassen.
Wenn man aber die ganze Zeit diese Ansprüche und Erwartungen im Kopf hat, bleibt natürlich kein Raum für den Blick aufs Leben, wie es ist. Und die Menschen, die ganz selbstverständlich da sind. Raum für Gelassenheit, in dem überhaupt erst einmal wieder Platz ist für Gefühle wie Liebe, Geborgenheit und Nähe. Oder gar dem Vertrauen darauf, dass einen andere Menschen einfach so lieben könnten, wie man ist. So unfertig und unperfekt, ratlos, verwirrt und verunsichert, wie einen das Leben nun mal herumstößt.
So ein wenig scheinen das Pierre und Colette am Ende begriffen zu haben. Da nimmt Colette ihm auch seine Mona Lisa auf der Couch ab, weil das bestens zu diesem Grübler und Alles-Analysierer passt. Und man diesen Burschen vielleicht einfach so nehmen sollte, wie er ist. Falls man ihn so mag.
Karin Nohr „Mona Lisa auf der Couch“, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2025, 15,40 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
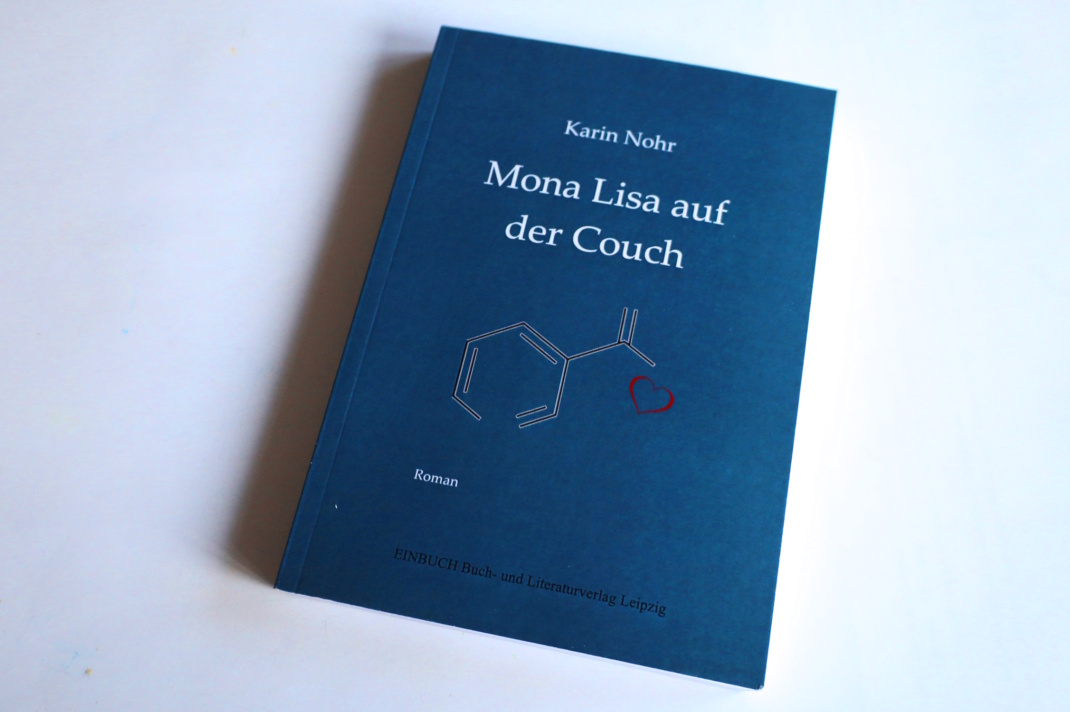
















Keine Kommentare bisher