Wir leben an einer Zeitenwende. Alles ist ausgetummelt. Wir wissen alles Wichtige über unsere Welt. Und wir können uns nicht mehr doof stellen. Können wir machen. Stimmt. Aber das wäre dann der endgültige Beweis, dass die Entstehung des Homo sapiens ein evolutionärer Irrweg war. Denn überleben werden nur Spezies, die sich anpassen können. Die, die sich doof stellen, werden einfach aussterben wie der Dodo. Und ein Anthroponomikum wird es nicht geben.
Das Wort ist eine Schöpfung von Roland Fischer selbst, der anders als so viele Autoren im Oekom Verlag keinen Hintergrund als Philosoph, Soziologe oder Naturforscher hat. Er ist Maschinenbauingenieur. Möglicherweise eine echte Ausnahme unter den deutschen Maschinenbauingenieuren.
Denn neben seiner Familie ist seine größte Freude augenscheinlich das regelmäßige Gespräch mit einem Freund, mit dem er sich über den Menschen und die Welt streitet, das richtige Leben, die Probleme, mit denen wir uns herumschlagen, die Grenzen der Erkenntnis, die Lernfähigkeit des Menschen und das, was für die meisten Wohlstandsbürger der Gegenwart kaum noch vorstellbar ist: die Zukunft.
Die wir möglicherweise nicht erleben, weil die Dodos unter uns gerade dabei sind, alles zu verbrauchen, zu vermüllen, zu vergiften und zu zerstören. Die kostbarste aller Welten – nämlich den einzigen Planeten, den wir haben und der uns Glück und Wohlstand gibt in ausreichendem Maß.
Irgendwann hatten die beiden sich gegenseitig so auf Touren gebracht, dass Roland Fischer sich hinsetzte und all seine Gedanken in diesem Buch zu fassen und ein bisschen zu systematisieren versuchte.
Das Anthroponomikum ist ein Versuch, ein neues Zeitalter einmal anders zu definieren, als es etwa die Geologen derzeit mit dem Anthropozän versuchen.
Denn dass die Geologen über ein Anthropozän diskutieren, hat ja auch damit zu tun, dass der Mensch mit seinen technischen Möglichkeiten mittlerweile auch nachweisliche Spuren in geologischen Schichten hinterlässt. Er wird zur geologischen Kraft. Oder ist es schon lange geworden. Die Wissenschaftler streiten eher darüber, seit wann er das ist, ob dazu schon das frühzeitige Abholzen der Urwälder gehört oder ob der atomare Fallout der frühen Atombombenabwürfe die Grenze markiert.
Roland Fischer setzt seine Grenze ganz ähnlich, irgendwo ins 20. Jahrhundert, das uns aus Sicht der Historiker meist als „Zeitalter der Extreme“ angeboten wird, das aber auch ein Jahrhundert war, in dem der Mensch fast alle Gebiete erschlossen hat, die es zu erschließen gab. Die letzten weißen Flecken auf dem Globus wurden erforscht, die höchsten Berge erstiegen, die Tiefen der Meere erkundet, die chemischen Elemente systematisiert. Der erdnahe Kosmos wurde erobert und in der Biologie, der Physik, der Chemie wurde fast alles erforscht, was uns eine logische und sinnvolle Erkenntnis der Welt ermöglicht.
Und da wir alle wichtigen Naturgesetze erkannt haben, konnten wir sie auch in allen Lebensbereichen anwenden und uns eine technische Welt bauen, die alle unsere Bedürfnisse erfüllt – außer die geistigen und seelischen. Etwas, was so deutlich noch niemand in einem so dicken Essay betont hat. Denn zu Recht stellt Fischer fest, dass auch die meisten Forscher noch immer so tun, als lägen vor uns noch unendliche Welten der Erkenntnis und wir hätten das meiste noch gar nicht erkannt.
Der Dodo stellt sich quasi doof.
Der Dodo ist von mir. Auch weil Fischers Buch einmal mehr das Gefühl verstärkt, in einer Welt zu leben, in der sich erschreckend viele Menschen doof stellen. Oder es auch sind aus unerfindlichen Gründen, obwohl mittlerweile das Internet eine riesige Menge von Wissen bereitstellt – nur scheint das die Dodos unter uns nicht im mindesten zu interessieren.
Sie suchen dort eher lauter Dodo-Bestätigungen für die dümmsten Vorstellungen über die Welt. Als wäre die lautstarke Bestätigung von Dodo-Blödheit schon so eine Art elitäre Auszeichnung für eine auserwählte Spezies. Stimmt ja auch: der Dodo war auserwählt – zum schnellen Aussterben.
Aus Sicht eines Naturwissenschaftlers, als der auch Fischer schaut, einfach unbegreiflich. Denn hinter uns liegen 500 Jahre Getummel. Davon erzählt im Grunde der erste Teil des Buches, in dem Fischer zu begründen versucht, warum wir auf den meisten Feldern unserer Existenz mittlerweile ausgetummelt haben, also alles wissen, was wir über das, „was diese Welt zusammenhält“, wirklich wissen können.
Wir sind nicht mehr in der (un-)glücklichen Lage eines Faust, dass wir von dem Gefühl geplagt werden, mit dem studierten Wissen nicht zufrieden zu sein. Einige Spitzenforscher werden das Gefühl noch kennen. Die meisten Normalgebildeten können die riesige Fülle an erforschtem Wissen gar nicht mehr erfassen. Die Zeit der sogenannten Universalgenies (so wie Wilhelm Gottfried Leibniz) ist vorbei. Jedenfalls in dem Sinn, dass ein studierter Mensch noch in mehreren Wissenschaften mit der Spitze der Forschergemeinde mithalten könnte.
Etwas tiefer geht es schon. Jedem Bewohner unseres Informationszeitalters ist es möglich, ähnlich umfassend gebildet zu sein wie Leibniz und Goethe. Und sogar noch deutlich gebildeter, weil die Erkenntnisse in Physik, Astronomie, Chemie, Mathematik usw. mittlerweile so weit getrieben sind, dass wir die wichtigsten Gesetzmäßigkeiten unserer Welt erkannt haben. Das meint Fischer vor allem, wenn er vom Tummeln und von Ausgetummelthaben spricht.
Es liegt im Wesen der neugierigen, nimmer ruhenden Menschen, jedes Gebiet, auf dem sie tätig werden, bis an die Grenzen des Möglichen zu erkunden, auszuformen, auszureizen. Eine Grundeigenschaft, die Fischer auch im Sport entdeckt und in der Kunst. In beiden Fächern sieht er Grenzen sogar überschritten, gerade in der Kunst, die mit der Moderne den Kanon der klassischen Malerei und Bildhauerei völlig verließ und die Betrachter schon lange nicht mehr mit bildnerischer Perfektion zu beeindrucken sucht, sondern mit Konfrontation, Widerspruch, Auflösung der Form.
Der faustische Mensch hält es nicht aus, dass etwas im Unbekannten bleibt. Er will alles wissen. Und tummelt sich. Er will alles ausprobieren. Und tummelt sich. Er will immer mehr leisten, bauen, entwerfen, immer genialere Technik entwickeln. Und tummelt sich.
Doch dabei hat er gerade im 20. Jahrhundert eines vergessen: Dass jedes Getummel Grenzen hat. Nicht nur haben kann, sondern hat. Und spätestens seit 1972, seit dem ersten Bericht „Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome, wissen wir, dass diese Grenzen nicht nur existieren, sondern dass wir gerade dabei sind, sie zu überschreiten.
Die Ressourcen eines endlichen Planeten sind endlich. Aber nicht nur die: Auch die Naturgesetze setzen uns Grenzen. Sie sind nicht verhandelbar. Wer sie als Ingenieur missachtet, richtet Katastrophen an. Oder entwickelt Technologien, die wir nicht mehr beherrschen können.
Nur eins wird der genialste Ingenieur nicht hinbekommen: Die Gesetze der Physik auszuhebeln mit irgendeinem genialen Trick. Das lässt Roland Fischer auch durchblicken, der nur noch den Kopf schütteln kann über den modernen Wunderglauben der Menschen (oder wohl besser: der Dodos unter den Menschen), die meinen, sie könnten mit noch wundersamerer Technik in naher Zukunft alles wieder in Ordnung bringen, was mit der rücksichtslosen Ausplünderung unserer Erde bislang schon angerichtet wurde.
Die dümmste dieser Vorstellungen ist ja, die Menschheit könnte dann einfach mal auf den Mars umziehen, ihn terraformen, wie das im Zaubervokabular der Phantasten heißt. Dass das allein schon vom technischen und finanziellen Aufwand her alles übersteigt, was die Menschheit zur Verfügung hat, kann sich jeder ausrechnen, der in Physik und Mathematik auch nur fünf Minuten aufgepasst hat.
Logisch, dass Fischer irgendwann zum Gnothi seauton, dem „Erkenne dich selbst!“ am Apollotempel zu Delfi kommt. Was nicht nur für das Individuum gilt, sondern für die ganze Spezies Mensch, die augenscheinlich noch immer im Wahn des biblischen Adam gefangen ist, sich die Welt immer mehr und immer weiter untertan machen zu müssen. Obwohl wir sie längst untertan gemacht haben, alles erreicht haben, was wir bei der Zähmung der Welt erreichen konnten.
Übrigens mehr als das: Wir leben im Überfluss. Wir leben in einem Wohlstand, den im Mittelalter nicht mal die Könige und Kaiser kannten. Es ginge uns gut – wären wir nicht so maßlos und nimmersatt. Würden wir überhaupt erkennen, dass wir einen Zustand erreicht haben, in dem wir allen Menschen ein gutes Leben ermöglichen könnten.
Dass dem nicht so ist, sieht auch Roland Fischer. Aber er ist ja nicht umsonst Erbauer von Windkraftanlagen geworden. Er ist – wie wahrscheinlich viele von uns – schon mit dem Wissen aufgewachsen, dass wir die Aufheizung der Atmosphäre beenden müssen – und dass wir längst die Technik dafür haben.
Aber was einige von uns daran hindert, es auch zu tun, hat mit dem falschen Wunderglauben des 20. Jahrhunderts zu tun, dem irren Glauben an ewiges Wachstum und unendliche Weiten. Solange die irren Prediger noch unterwegs sind, die den Leichtgläubigen einreden, sie würden nur glücklich, wenn sie immer mehr konsumieren, verdienen und arbeiten und optimieren, solange findet die Erkenntnis kaum Platz, dass es sich ausgetummelt hat, dass die Menschheit einen Stand erreicht hat, in dem sie das Wichtigste weiß über die Welt und in dem sie allen Menschen ein gutes und auskömmliches Leben ermöglichen kann. Immer mehr von allem macht keinen Menschen glücklicher, nicht einmal die, die sich rücksichtslos immer mehr nehmen.
Es geht beim heutigen Gnothi seauton nicht nur darum, dass die Menschheit insgesamt erkennt, dass sie alle nötigen Erkenntnisse und Technologien hat, die der gesamten Menschheit heute ein gutes und glückliches Leben ermöglichen könnten. Denn so recht wird auch Fischer seine Zweifel nicht los, ob diese Erkenntnis in naher Zukunft zu Regierungshandeln wird, auch wenn die Zahl der Menschen, die es begriffen haben, wächst.
Es bringt also nichts, darauf zu warten, bis die Staatsoberhäupter beschließen, dass es genug ist und sie den Dodos, Gierigen und Unersättlichen Grenzen setzen.
Es bringt aber viel, wenn jeder bei sich anfängt. Das ist der zweite Teil des Buches, in dem Fischer davon erzählt, was er selbst in seinem Leben geändert hat: Arbeitszeit verkürzt, mehr Zeit für die Kinder, mehr Zeit für Muße … ein Wort, das heutige Optimierer gar nicht mehr kennen, obwohl sich damit alles verbindet, was das menschliche Leben aufregend, intensiv und glücklich macht.
Ein paar Begriffe erläutert Fischer am Ende noch einmal extra – eigentlich sogar eine ganze Menge Begriffe. Denn wer sich die Muße gönnt, über all das nachzudenken, was sein Leben wirklich schön und reich macht, der landet nicht beim Auto vorm Haus oder der ganzen Smart-Technologie, mit der sich die Dodos immer mehr zu den lustlosen Blagen aus „Schöne neue Welt“ verwandeln.
Der landet im Zentrum all dessen, was uns Menschen wirklich anregt und aufregt: Liebe und Aufmerksamkeit für die Welt und die Mitmenschen, Dankbarkeit, Achtsamkeit, Gelassenheit …
Fischer nimmt auch Nietzsches falsche dualistische Sicht auf den Menschen auseinander, schimpft berechtigterweise über den Miserabelismus des alles mies machenden Wohlstands-Dodos, wird an einer Stelle sogar richtig rebellisch, wo er dem zum techniktransportierten Wohlstandsklops gewordenen Dodo in geharnischter Rede entgegenbrüllt: Beweg dich endlich!
Denn ein Großteil der heutigen Miesmacherei hat ja genau damit zu tun: Die maulenden Bürger sind zu passiven Konsumenten geworden, die kaum noch einen Schritt zu Fuß zurücklegen und sich nicht mal darüber wundern, dass sie unter lauter deprimierenden Wohlstandskrankheiten leiden und permanent das Gefühl haben, ihr eigenes Leben nicht zu beherrschen. Und natürlich plädiert Fischer für die „nüchterne Leidenschaft zur praktischen Vernunft“.
Wir haben alle Mittel in der Hand, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Dazu gehört auch unsere Fähigkeit, auf etwas zu verzichten, was wir nicht brauchen. Auch das gehört zum „Erkenne dich selbst“. Denn wer sich selbst nicht kennt und nicht weiß, was er sich wirklich als Erfüllung im Leben wünscht, der fällt auf die ganzen falschen Versprechungen der Werbung herein, die einen Wachstumswahnsinn am Laufen hält, der unseren einzigartigen Planeten gründlich zerstört.
Wir sind an einer Grenze angekommen. Und die Aufgabe, die jetzt tatsächlich vor uns steht, ist: die Weltzerstörung zu beenden und tatsächlich zu lernen, mit dem auszukommen, was uns unsere Erde zur Verfügung stellt. Denn nur so sichern wir das, was gerade erst begonnen hat und was das ganze nächste Zeitalter der Menschheit sein könnte: das Anthroponomikum. Ein Zeitalter, in dem die Menschheit erkennt, was sie wirklich auf diesem Planeten will und wie sie eigentlich die nächsten Jahrhunderte leben und überleben will. Und was sie tatsächlich dazu braucht – und was nicht. „Wir sind zur Freiheit verurteilt“, schreibt Fischer. Wir entscheiden selbst, wie wir leben wollen. Jeder für sich. Ohne Ausrede.
Wir haben die Wahl: Wir können uns wie die dümmsten Dodos benehmen oder wie ein Lebewesen, das zur Erkenntnis befähigt ist und dafür auch die Verantwortung übernimmt.
Roland Fischer Das Anthroponomikum, Oekom Verlag, München 2020, 26 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
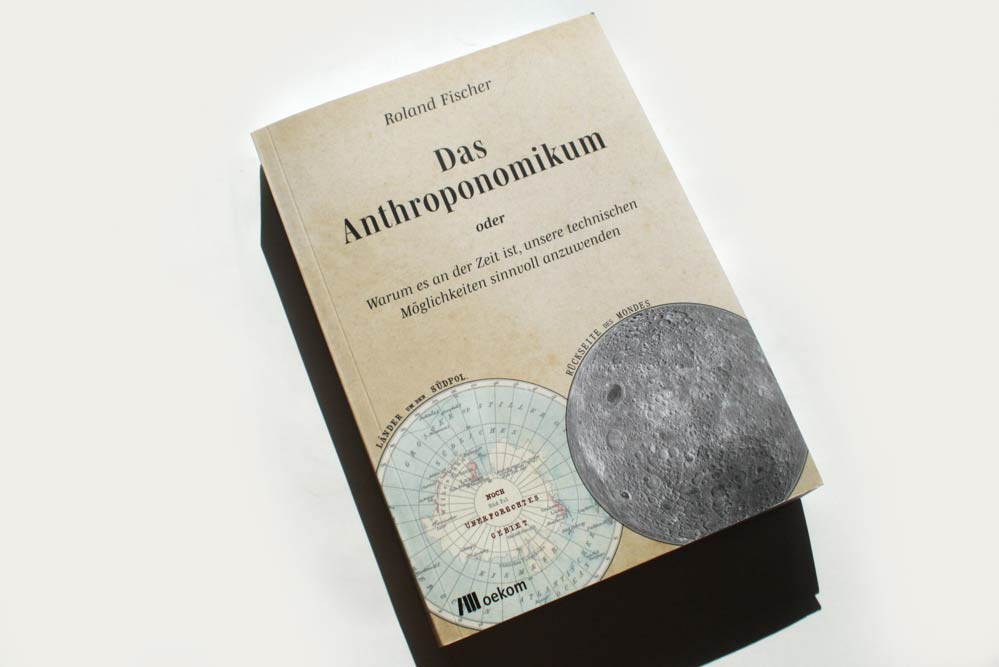














Keine Kommentare bisher