Vielleicht sollten all die Menschen, die sich heutzutage von den schrillen Meldungen in den „social media“ irremachen lassen, einfach mal all die technischen Spielzeuge ausschalten, sich einen Tee zur Beruhigung holen und dann ein Buch lesen. Denn wie es in der Welt aussieht, wissen oft die Dichter/-innen deutlich besser als all die überdrehten Kommentatoren. Sie können sich nämlich noch einfühlen in die Menschen, über die sie schreiben. Auch in die Fliehenden, Vertriebenen, Zufluchtsuchenden.
Die portugiesische Dichterin Hélia Correia hat 2018 so einen Text veröffentlicht, schwebend zwischen Roman, Erzählung, Gedicht. Angeregt durch die großen Fluchtbewegungen des Jahres 2015, als Millionen Menschen vor den Kriegen und Bürgerkriegen in Afrika und Nahost fliehen mussten und Europa auf einmal nicht mehr wegschauen konnte, weil die Flüchtenden auch auf dieser Insel der Glücklichen im Norden versuchten, eine Zuflucht zu finden.Aber wir wissen ja, wie das ausging. Die Feiglinge und Hardliner taten sich zusammen und verammelten den Kontinent. Und als Zugabe vereinbarten sie dann auch noch mit einigen Regierungen Nordafrikas, dass diese Sammellager einrichteten und die flüchtenden Menschen schon vor dem Mittelmeer abfingen und möglichst zurückschickten, wohin auch immer.
So geht man nicht mit Menschen um. Eigentlich weiß das jeder.
Aber ein abendliches Nachrichtengetrommel, in dem dann der Menschenhass rechter Parteien nach und nach immer mehr die Tonlage bestimmt, macht Menschen irre, blind und gefühllos. Am Ende glauben sie all die Gespenstergeschichten und vergessen ihr Mitgefühl, das eigentlich jeder in sich trägt, das aber viele von uns gelernt haben als beschämend und „verweichlichend“ zu unterdrücken.
Was aber kommt dabei heraus, wenn sich eine begnadete Dichterin hineinversetzt in eine Gruppe Menschen, die in einem unerklärten und um so gesichtsloseren Bürgerkrieg irgendwo in den Tiefen Afrikas ihre Heimat verloren haben, viele ihre Angehörigen, und weil es sonst keinen Ort der Zuflucht mehr gibt, sich auf den langen Weg machen durch die Wüste.
Anfangs noch von Leuten geführt, die ihnen eingeredet haben, sie wüssten, wie man heil bis ans Meer kommt. Aber schon bald zerstiebt diese Hoffnung, verschwinden die geschäftstüchtigen Führer und die Menschen sind auf sich allein gestellt.
Was dabei entsteht, ist etwas, das für Leser von Andrej Platonow erstaunlich vertraut wirkt. Denn es braucht gar nicht viel und diese Gruppe der Wüstenwanderer ähnelt in ihrer Suche nach etwas, das es möglicherweise gar nicht gibt, dem Volk der Dshan. Auf einmal wird eine 100 Jahre alte Geschichte aus dem wüsten Süden der einstigen Sowjetunion wieder aktuell, erkennt man in den Ausgestoßenen Platonows auch die Menschen wieder, die Hélia Correia einfühlsam durch die Wüste begleitet.
Und es sind ganz ähnliche Fragen, die mit existenzieller Gewalt wieder an die Oberfläche drängen, denn auf einmal funktionieren die alten Gesetze nicht mehr, erweisen sich die alten Machtgefüge als wirkungslos, denn was in der erstarrten dörflichen Gemeinschaft noch dafür sorgte, den Menschen ihren Platz zuzuweisen in einer Gesellschaft, die Veränderungen seit Jahrhunderten als gefährlich betrachtete, braucht es in der Wüste völlig andere Stärken und auch eine andere Solidarität.
Was zuerst Tariq begreift, der – selbst versehrt – den blinden Nuru unter seine Fittiche nimmt und ihn quasi zu seinem Vater macht in einer Gesellschaft, in der sich die alten Familien noch immer abkapseln und Wert darauf legen, dass die Außenseiter auch draußen bleiben.
Doch auf diesem langen Weg durch die Wüste mit seinen Enttäuschungen, dem Hunger, dem Durst und der aufkommenden Hoffnungslosigkeit sind es die Außenseiter und die Frauen, die aufbegehren und sich nicht mehr alles gefallen lassen wollen, die auch die ihnen zugewiesenen Rollen nicht mehr akzeptieren und sich zusehends emanzipieren.
Je ratloser die Männer werden, die aus der zurückgelassenen Welt noch den Anspruch mitgenommen hatten, Frauen hätten den Mund zu halten und sich zu verhüllen, umso mehr artikulieren die scheinbar Schwächeren ihren Protest.
Denn die alten Regeln funktionieren nicht mehr. Auch die Männer kennen den Weg nicht, scheinen heillos verloren in der Wüste, bevor der Blinde, die Frauen und die Kinder beginnen, das Heft des Handelns in die Hände zu nehmen. Ganz unvermutet kippen die alten Muster, wird die Wanderung zu einem letztlich unerreichbaren Ziel auch zu einer Befreiung aus alten Zwängen.
Und das schildert Correia eher beiläufig, wechselt immer wieder die Hauptperson. Doch da sind immer häufiger die Frauen, die – wie die junge Witwe Awa – nicht mehr akzeptieren, sich über ihre – toten – Männer definieren lassen zu müssen. Sie wird, wie sie selbst sagt, zum Raubtier, lässt den Schleier fallen und bietet den maulenden Männern die Stirn.
Die aber ihrem Willen, einen Ausweg zu finden, nichts entgegenzusetzen haben. Und spätestens bei der Ankunft vor der Stadt am Meer wird klar, dass diese Flüchtenden mehr zusammenhält als nur der Wille, irgendwie übers Meer nach Europa zu kommen.
Denn der Weg nach Europa ist versperrt. Wer die Stadt betritt, landet im Lager. Europa zeigt hier, was es von den Flüchtenden hält: Es will sie nicht haben. Und der Ausweg ist nur noch, zurückzukehren in die Wüste. Auch wenn die Frauen jetzt – im Vertrauen auf die Kinder – einen anderen Weg wählen, der nicht unbedingt größere Hoffnung verspricht.
Doch anders als bei Platonow laufen diese heimatlos Gewordenen nicht im Kreis. Gerade die Frauen sorgen dafür, dass sie sich nicht aufgeben und nicht einfach nur zum Sterben in den Wüstensand legen.
So gesehen: Ein Poem voller Zuversicht, auch wenn die eindringlichere Botschaft eine andere ist. Denn indem Hélia Correia sich tief hineinversetzt in diese vom Krieg Vertriebenen, schildert sie genau das, was die in ihrem Wohlstand zitternden Europäer nicht mehr sehen. Als hätten sie selbst so ein Leid nie erlebt und die Nöte einer Flucht, die zuallererst einmal eine Flucht aus einer zerstörten Welt ist.
Europa ist nur eine große Verheißung jenseits des Meeres. Die Flüchtenden wissen, dass sie vorher in der Wüste oder später auf dem Meer sterben können und dass es ringsum eigentlich kein anderes Ziel gibt, auf das sie zulaufen können. Aus Sicht dieser durch die Wüste irrenden Menschen sieht das große Flüchtlingsdrama völlig anders aus als aus dem bequemen europäischen Sessel.
Und als Motto hat Correia ausgerechnet ein Nietzsche-Zitat gewählt: „Die Wüste wächst: weh dem, der Wüste birgt!“ Das aber genau über das nachzudenken zwingt, was Correia in ihren durch die Wüste Wandernden angelegt hat: Ihre Hauptfiguren wehren sich gerade dagegen, das Wachstum der Wüste in ihrer Seele zuzulassen. Sie wehren sich, verlassen sogar ganz bewusst die alten, passiven Rollen, die eben genau das befördern: dass man selbst zum Opfer der Wüste wird.
Aber es klingt auch noch eine andere Wüste an, spätestens, wenn die Wandernden dem Wächter vor der Stadt begegnen, der sie nicht nur warnt davor, die Stadt zu betreten, sondern ihnen eigentlich auch deutlich macht, dass es auch noch die riesige Wüste der Gefühllosigkeit gibt, die sich ausgebreitet hat. Das Lager, das die Europäer haben einrichten lassen, erzählt ja genau von dieser Wüste der Hartherzigkeit, der verwalteten Kälte, die diejenigen erwartet, die es dennoch über das Meer schaffen.
Was bleibt da für Hoffnung?
Eine Frage, die Correia eigentlich nicht nur für die kleine Schar der durch die Wüste Irrenden stellt, sondern auch für ihre Landsleute, und damit auch für uns. Wenn auch dieses Europa nur eine seelische Wüste ist, wo finden dann all die Vertriebenen und heimatlos Gewordenen überhaupt noch eine Zuflucht, einen Ort, an dem auf Rettung zu hoffen ist? Welche Hoffnung ist dann noch in der Welt und welche Geschichte überhaupt noch erzählbar, wenn nur noch seelische Wüste bleibt? Dann bleiben ja auch keine Geschichten mehr und auch keine Knochen mehr im Wüstensand.
Das Buch hat jedenfalls die portugiesischen Leser/-innen beeindruckt. Hélia Correia bekam dafür einen der großen portugiesischen Literaturpreise. Schwerer wird es, dass ihre Geschichte in Deutschland Resonanzen auslöst, auch wenn sie Dania Schüürmann jetzt auf poetische Weise ins Deutsche übersetzt hat. Denn damit, wie es den Flüchtenden ergeht, bevor sie es überhaupt auf die gefährliche Route übers Mittelmeer schaffen, hat sich die deutsche Öffentlichkeit bislang so gut wie gar nicht beschäftigt.
Sie glaubt lieber den ganzen Schreckensbildern aus der menschenfeindlichen Mottenkiste, aus der dann deutsche Abwehr- und Abschiebepolitik gemacht wird. Natürlich ist die Wüste längst unter uns. Sie steckt in den Köpfen all derer, die längst vergessen haben, dass es um hilfesuchende Menschen geht, für die es keinen heilen Ort gibt, an den sie mit amtlicher Attitüde einfach zurückgeschickt werden können.
Verständnis beginnt erst da, wo man beginnt, sich in die Gefühle der anderen versetzen zu können, was auch den Männern in dieser Gruppe schwerfällt, weil sie sich in ihren uralten Regeln bisher selbst nie infrage gestellt haben. Aber die Wüste stellt uns alle infrage. Und das spüren zuallererst die Außenseiter, die als erste begreifen, dass die so auf ihre Gesetze fixierten Männer gar nicht mehr wissen, wo der Weg ist und die mögliche Rettung.
Da ähneln sich die so in die alten Regeln verkrampften Männer überall auf der Welt. Sie beanspruchen das letzte Wort, wissen aber keinen Ausweg. Und sie laufen dann trotzdem hinterher, wenn die Frauen losgehen, weil die nicht bereit sind, sich von toten Gesetzen in der Wüste zurückhalten zu lassen.
Hélia Correia Tänzer im Taumel, Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2021, 16,95 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
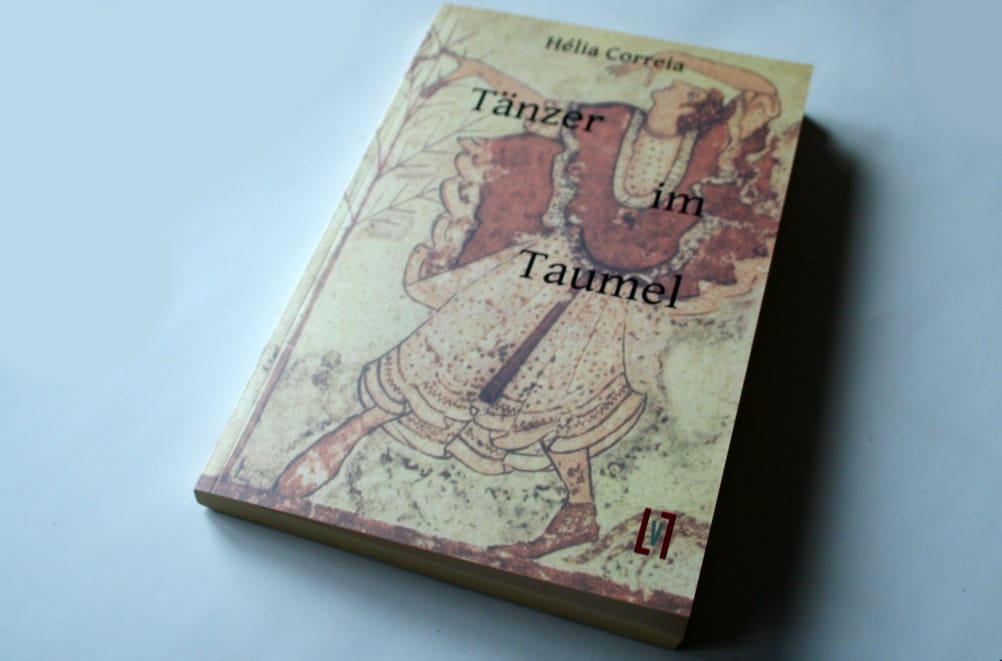















Keine Kommentare bisher