Wenn man die Namen liest, kommt es einem beinah vor wie die „gute alte Zeit“. Da hatten sogar Diktatoren noch Format… Was natürlich nicht stimmt. Sie bekamen nur viel mehr Aufmerksamkeit als heute, standen ganz anders im Fokus der Medien. Wenn sie dann endlich weg waren, krähte auch kein Hahn mehr nach ihnen. Nur Journalisten wie Witold Szabłowski interessierten sich noch – und zwar für die Menschen, die es mit diesen eiskalten Typen aushalten müssen. Ihre Köch/-innen zum Beispiel.
In den 1990er Jahren, nachdem der Ostblock zusammengebrochen war, feierten ja jede Menge westliche Vor- und Nachdenker das Ende der Diktaturen und die herrliche Zukunft der siegreichen Demokratie. Wahrscheinlich waren sie alle strunzbesoffen oder überbezahlt. Als „The Economist“ im Februar seinen neun Index zum Stand der Demokratie veröffentlichte, titelte er ziemlich enttäuscht: „Global democracy has a very bad year“.Denn nicht nur putschen in einigen von diesen Ländern, die die arroganten Nordländer sonst nur mit Fingerspitzen anfassen, mal wieder ein paar Militärs, die demokratisch gewählte Präsidenten aus dem Amt jagten.
Auch in westlichen Demokratien trampelten ein paar selbstsüchtige Populisten dem eigenen Volk und den Nachbarn auf den Nerven herum. Und da stand der überstürzte Abzug aus Afghanistan noch bevor. Als autoritäres Regime wertete „The Economist“ Afghanistan auch damals schon. Aber mit Rang 139 und Score 2,85 ließen es die Redakteure noch deutlich vor seinen Nachbarn und auch vor China mit Rang 151 und Score 2,27 rangieren.
Kuba ließen sie mit Rang 140 und Score 2,84 sogar einen Platz hinter Afghanistan rangieren. Immerhin ein Kuba, das nach der langen Ära der Castros und mit dem Besuch Obamas 2016 auf dem Weg der Öffnung auch zu den USA war. Nur dass bekanntlich ein eitler Mann namens Trump diese Annäherung sofort wieder unterbunden hat.
Eine andere Sicht auf die Welt
Witold Szabłowski hat Kuba genau zur Zeit des Obama-Besuchs aufgesucht und die Chance genutzt, dass im Schatten von Obamas Besuch der Weg frei sein könnte, ohne die staatlichen Überwacher Kontakt zum einstigen Koch Fidel Castros aufzunehmen. Vier Jahre hat Witold Szabłowski insgesamt in dieses Buch investiert. 2019 erschien das Ergebnis seiner Arbeit erstmals auf Polnisch und hat über Penguin Random House auch sofort weltweit Verbreitung gefunden.
Etwas, so betont Szabłowski, was polnischen Autoren sehr selten passiert. Für den Katapult Verlag hat es jetzt Paulina Schulz-Gruner übersetzt und damit auch die erste Übersetzung im Verlagsprogramm untergebracht. Denn Katapult verlegt ja auch erst seit einem Jahr eigene Bücher. Die meisten werden Katapult über das Katapult Magazin kennen
Und natürlich passt das Buch genau zum Verlagsprogramm und der Liebe der Katapult-Macher zu Karten, die die Welt so zeigen, wie sie wirklich ist. Und nicht, wie sie sich PR-Berater vorstellen.
Und eigentlich ist auch Witold Szabłowski so an die Sache herangegangen. Wie es ist, dass man ohne vorherige Kenntnisse und Ausbildung zum Koch werden kann, das hat er selbst in Kopenhagen erlebt, bevor er nach Polen zurückging und als Journalist zu arbeiten begann.
Aber wie wurden andere Leute zu den Leibköchen der berühmten Diktatoren des 20. Jahrhunderts – oder genauer: der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts? Denn er wollte sie ja selbst interviewen und besuchen. Was verraten die Köche über ihre einstigen Herren? Lebten sie in Angst oder dienten sie den blutigen Herrschern gern und mit Liebe?
Die Welt aus Sicht der Underdogs
Das sind alles durchaus berechtigte Fragen. Die auf diese Weise wohl auch nur Witold Szabłowski stellen konnte, der weiß, wie das ist, wenn man um des Überlebens willen auch Jobs annehmen muss, die man nicht gelernt hat und die einem erst einmal völlig fremde Landschaften sind. Es ist dieser Blick auf Augenhöhe, den westliche Redakteure nur selten haben, weil sie nie erlebt haben, wie man sich als Underdog fühlt und sich auf den unübersichtlichen Arbeitsmärkten in dieser Welt umtun muss nach einem Lebensunterhalt.
Man ahnt nur, wie viele dieser Menschen dann auch ohne viel Nachdenken bereit sind, Arbeiten zu verrichten, die sie nie zuvor gelernt haben. Dagegen wirken all die Orientierungs- und Selbstfindungs-Artikel in den großen deutschen Zeitungen wie Jammern und Geplärre auf höchstem Niveau. Das Gejammer von Leuten, die zwar nicht mehr wissen, wie sie ihr Geld investieren sollen, sich in ihrem überbezahlten Job aber nicht ausgelastet fühlen …
Da mache ich lieber drei Pünktchen. Mit Witold Szabłowski erlebt man, wie es wirklich ist, wenn man eigentlich keine Entscheidungshoheit darüber hat, was aus dem eigenen Leben wird. Denn die Diktaturen, die in seinen fünf Geschichten aufblitzen, waren eben auch Gesellschaften, die alle alten Strukturen über den Haufen warfen, neue Eliten einsetzten und dabei auch Menschen eine Chance gaben, die ohne das niemals auch nur in die Nähe der Macht gekommen wären.
Es sind die Bewohner dieser Länder, die mehr über die Funktionsweise von Macht wissen, als die altklugen Weißen im Norden, die sich über Macht selten bis nie den Kopf zerbrechen. Obwohl sie es sollten. Auch mit Blick auf die Außenpolitik ihrer eigenen Mächtigen.
Denn ohne das massive Flächenbombardement der US-Amerikaner in Kambodscha hätte es die Machtübernahme der Roten Khmer und Pol Pots in dieser Weise nicht gegeben. Die US-Amerikaner sind bis heute wahre Meister in der Kunst, andere Länder zu destabilisieren. Das ging in Vietnam schief, in Kambodscha, in Afghanistan, im Irak, im südamerikanischen Hinterhof mit all seinen Militärjuntas von Amerikas Gnaden ebenso.
Einfach mal zuhören
Aber das ist ein anderes Thema, auch wenn es gerade in der Geschichte von Yong Moeun, der Köchin Pol Pots, aufscheint, die nicht die Einzige ist, die ihren einstigen Dienstherrn verklärt. Aber Witold Szabłowski reiste auch nicht nach Kambodscha, um zu richten.
Er wollte wirklich wissen, wie man überhaupt in solche Dienste kommt, wie sich die persönlichen Beziehungen zum Diktator gestalteten, wie die Köch/-innen lebten und auch überlebten. Denn eines wird schon auf der ersten Reise in den Irak klar, wo er Saddam Husseins Koch Abu Ali trifft: Sicher lebte es sich ganz und gar nicht in der Nähe der Diktatoren.
Sie umgeben sich alle mit einem straffen Sicherheitsdienst, lassen jeden überprüfen, der auch nur in ihre Nähe kommt. Sie misstrauen aus gutem Grund und aus Professionalität, auch wenn selten einer so weit geht wie Pol Pot, bei dem die geringste Verdächtigung reichte, um gleich ganze Familien und Kontaktkreise auszulöschen – und seien es auch die ältesten und diensteifrigsten Mitkämpfer.
Was übrigens kein neues Phänomen ist. Für Stalin wurde es schon sehr akribisch beschrieben. Diktatoren herrschen nicht wirklich deshalb, weil sie vom Volk geliebt werden. Sie herrschen, weil sie gefürchtet werden und unberechenbar und rücksichtslos sind. Was besonders am Aufstieg Idi Amins in Uganda und Enver Hoxhas in Albanien deutlich wird.
Und Köche lebten in ihrer Umgebung immer gefährlich. Die geringste Übelkeit ihres „Wohltäters“ genügte, und sie sahen sich eines Giftanschlags verdächtigt, was in solchen Diktaturen nie eine polizeiliche Untersuchung nach sich zieht, sondern in der Regel die baldige Ermordung.
Lieblingsspeisen und Wohlergehen
Und so haben auch Otonde Odera, der einst Idi Amin bekochte, und Herr K., der Koch Enver Hoxhas, so einiges zu erzählen über die Angst in der Nähe der Macht. Angst, die sich durchaus auch mit persönlicher Nähe und Vertrauen paaren konnte. Denn wenn ein Koch nicht nur gelernt hat, den Mächtigen ihre Lieblingsspeisen zu kochen, sondern sich auch um ihr leibliches Wohlergehen zu sorgen, entsteht natürlich ein sehr enges Verhältnis, fast familiär.
Erst recht, wenn Koch und Diktator fast von Anfang an eine gemeinsame Geschichte teilen wie Erasmo Hernández und Fidel Castro in Kuba. Vom Leibwächter zum Leibkoch – es ist nicht die einzige Geschichte dieser Art im Buch.
Und natürlich erzählen eher nicht die Köche über die Schattenseiten ihrer einstigen Dienstherren. Manchmal aus Angst, manchmal natürlich auch aus Hochachtung. Aber das konfrontiert Witold Szabłowski immer wieder, indem er auch andere Landsleute befragt, auf einschlägige Biografien und Presseveröffentlichungen zurückgreift. Was ihn trotzdem nicht daran hindert, die Geschichten der von ihm Befragten zu akzeptieren als ihre ganz persönliche Sicht auf die Dinge.
Menschen interpretieren ihre Lebensgeschichten auch immer selbst, versuchen für sich ins Reine zu kommen und das Geschehene in einen Rahmen zu setzen, den man vor sich selbst aushalten kann. Aber wann kommt schon mal ein Journalist vorbei und will wissen, wie einer zu so einem Job kam? Und wie er ihn ausfüllte und so gut war, dass ihn die Mächtigen so lange in ihrer Nähe duldeten?
Die Sicht der Köche auf die Mächtigen
Aus seiner eigenen Lebensgeschichte weiß Szabłowski, dass Köche ihre besondere Sicht auf die Menschen haben, die ihre Speisen vorgesetzt bekommen. Bei ihnen ist – wenn sie wirklich Koch mit Herz und Seele sind – der Gast immer König. Der Diktator sowieso. Und weniges ist so persönlich wie das Lieblingsgericht des Mächtigen oder sein Speiseplan. Man merkt, wie stolz die Befragten sind, dass sie diese Aufgabe gemeistert haben.
Es ist dieses Stück menschlicher Stolz, den die meisten kennen, die sich versuchen in einer Welt zu behaupten, in der immer andere die Macht und das Geld haben. In der man also nie wirklich weiß, ob man für seine Arbeit gelobt oder angepflaumt wird, ob man den Job behalten darf oder der ungnädige Herr einem den Laufpass gibt.
Dass es in Deutschland kaum Journalisten gibt, die so wie Witold Szabłowski über die ganz und gar nicht Berühmten berichten, hat damit zu tun, dass die meisten Journalist/-innen hierzulande aus einem wohlhabenden Bürgertum kommen und selten bis nie mal um des lieben Lebens willen in all den Jobs gearbeitet haben, die – von so weit oben betrachtet – völlig unzumutbar sind.
Aber wer macht sie eigentlich? Wer kennt die Chauffeure, Reinigungskräfte, Hausmeister und Köche, all die Leute, die jeden Tag dafür sorgen, dass der Laden läuft und der Boss gute Laune hat, weil ihm das Essen schmeckt?
Das ist ein zutiefst humanistischer Blick, mit dem Witold Szabłowski die von ihm Besuchten betrachtet. Er lässt sie gelten in ihren Geschichten, ihrem Stolz und auch ihrer Verleugnung. Wem steht es zu, ihnen diese Interpretation des Erlebten zu nehmen? Eine Frage, die für alle Menschen steht, die aus Diktaturen kommen, die Diktaturen überlebt haben. Sie sind immer Überlebende. Auch Pol Pots Köchin, die den reisenden Journalisten mit einem herzhaften Lachen empfängt.
Eine kleine Diktatorenkunde
Witold Szabłowski zeichnet ja auch ein sehr genaues Bild des ganz privaten Lebens der Diktatoren, die sich ja auch ihren Köchen gegenüber so benahmen, wie sie es anderen gegenüber taten. Vielleicht ein bisschen freundlicher. Aber nicht nur bei Enver Hoxha oder Saddam Hussein wird deutlich, wie sehr sich diese Machthaber auch berechtigt dazu fühlten, ein auserwähltes Leben zu führen, eines, in dem sie sich ganz verständlich Privilegien zumaßen und auch dann noch in Üppigkeit lebten und aßen, wenn ihr Volk hungerte.
Es ist auch ein wenig Diktatorenkunde, die Szabłowski auf diese Weise zu Papier gebracht hat, gespickt mit vielen kleinen Geschichten und Anekdoten. Aber auch der Erkenntnis, dass auch das Leben der Köch/-innen davon abhängt, ob es ihnen gelingt, den Herrscher satt und vor allem zufrieden und glücklich zu machen. Da überlegt so mancher Befragte, ob er mit seiner Kochkunst am Ende nicht auch viele Menschenleben gerettet hat. Denn hungrige Diktatoren reagieren ja noch irrationaler und rücksichtsloser als satte und zufriedene.
Ein paar der Lieblingsrezepte der einst Bekochten ließ sich Szabłowski auch zeigen. Wobei es durchaus erstaunlich ist, dass die meisten Diktatoren die jeweiligen Landesspeisen oder die aus ihrer eigenen Heimatregion bevorzugten, also auch von den Boykotts der Amerikaner weniger betroffen waren. Diktatoren empfinden sich ja oft auch als direkte Vertreter des Volkes, erst recht, weil sie meist nicht aus der alten Oberschicht stammen, sondern sich entweder in den Armeen des Landes hochgedient haben oder wie die Aufrührer Fidel Castro und Pol Pot an die Macht gekommen sind.
Wofür sich Historiker nie interessieren
Dass es trotzdem nicht leicht war, den Kontakt zu den Köch/-innen herzustellen, macht der Autor dann auch in der Danksagung noch einmal deutlich. Denn ohne Brückenbauer vor Ort wäre es ihm fast unmöglich gewesen, seine Gesprächspartner zu finden und das nötige Vertrauen aufzubauen, das man als Journalist braucht, damit Menschen auch Persönliches erzählen. Oder Dinge, die ihnen auch nach dem Tod des Diktators noch Angst machen oder auf der Seele lasten.
Aber wer sonst soll nach diesen Dingen fragen? Die Historiker interessieren sich fast nie dafür, wie es den dienstbaren Geistern im Umfeld von Herrschern geht. Ihnen fehlt der Blick auf die oft genug harte und einsame Rolle der Angestellten im Reich der Macht, die oft nur froh sind, wenn ihre Arbeit ohne Beanstandungen und Strafen akzeptiert wird und niemand sie verprügelt, einsperrt oder gar umbringt. Meist ja nur aus einer Laune heraus.
Und man kann wohl sicher sein, dass auch heute wieder und noch hunderte Köche und Köchinnen so versuchen, die Wut und den Zorn der neueren Putschisten und Diktatoren irgendwie zu besänftigen. Auch wenn sie wohl eher namenlos bleiben werden, noch namenloser als die heutigen Diktatoren aller Schattierungen, die allesamt in der Einbildung leben, sie wären Auserwählte und zum Herrschen Begnadete.
Beim Essen aber sind sie in Wirklichkeit Menschen wie unsereins. Nur mit der Macht, sich ihre eigenen Köche halten zu können oder gar aussuchen zu können. Und von ihnen verwöhnt zu werden.
Bevor Otonde Odera zum Chefkoch Idi Amins wurde, avancierte er unter dessen Vorgänger Milton Obote zum Koch des Regierungschefs. „Es war Gottes Wille, dass ich nach dem Putsch zum Koch des Präsidenten wurde“, zitiert ihn Szabłowski. „Ich machte mir keine Gedanken darüber, ob das, was er tat, legal sei. Milton Obote war mein Chef, er war einer von uns, er war für mich wie ein Bruder. Ich konnte mich nur für ihn freuen: denn wenn es ihm gut ging, ging es auch mir gut.“
Die dienstbaren Geister sieht man nicht
Wie sehen die Machtlosen eigentlich auf die Welt? Eine Frage, die sich Historiker fast nie stellen. Wie schlagen sie sich durch? Wie reagieren sie auf die Spiele der Mächtigen? Und wie arrangieren sie sich mit Diktaturen? Wenn man das mit diesem überheblichen Wort Arrangement überhaupt bezeichnen kann.
Und nicht viel elementarer werden müsste. Aber dazu muss man mit diesen Menschen reden und bereit sein, die Perspektive zu wechseln und zuzuhören. Die Weltsicht der anderen auch zu akzeptieren. Wie die der Köche auf die Menschen, die sie einst bekochten.
Und man ahnt nur – gerade durch die kurze Reflexion Szabłowskis auf seine eigene Zeit als Koch – wie viele Menschen gar nichts anderes wollen, als anderen Menschen nach bestem Können dienstbar zu sein. Nicht nur Köche. Aber eben auch Köche und Köchinnen, die man meist nicht beachtet und nicht sieht. Und dann gedankenlos das Aufgetischte verspeist, ohne auch nur zu bedenken, dass wir alle auf diese stillen Geister angewiesen sind, die uns den Aufenthalt auf Erden angenehm machen.
Zeigt das nun die menschliche Seite an Diktatoren? Natürlich. In vielem sind uns diese Typen viel ähnlicher, als wir gern wahrhaben möchten. Ich jedenfalls kenne so einige Leute, die nur zu gern Diktator wären, wenn sie nur könnten. Man denkt auch über das Diktatorsein ein bisschen anders nach, wenn man ihnen mit diesem Buch eigentlich beim Essen zuschaut.
Witold Szablowski Wie man einen Diktator satt bekommt, Katapult Verlag, Greifswalds 2021, 24 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
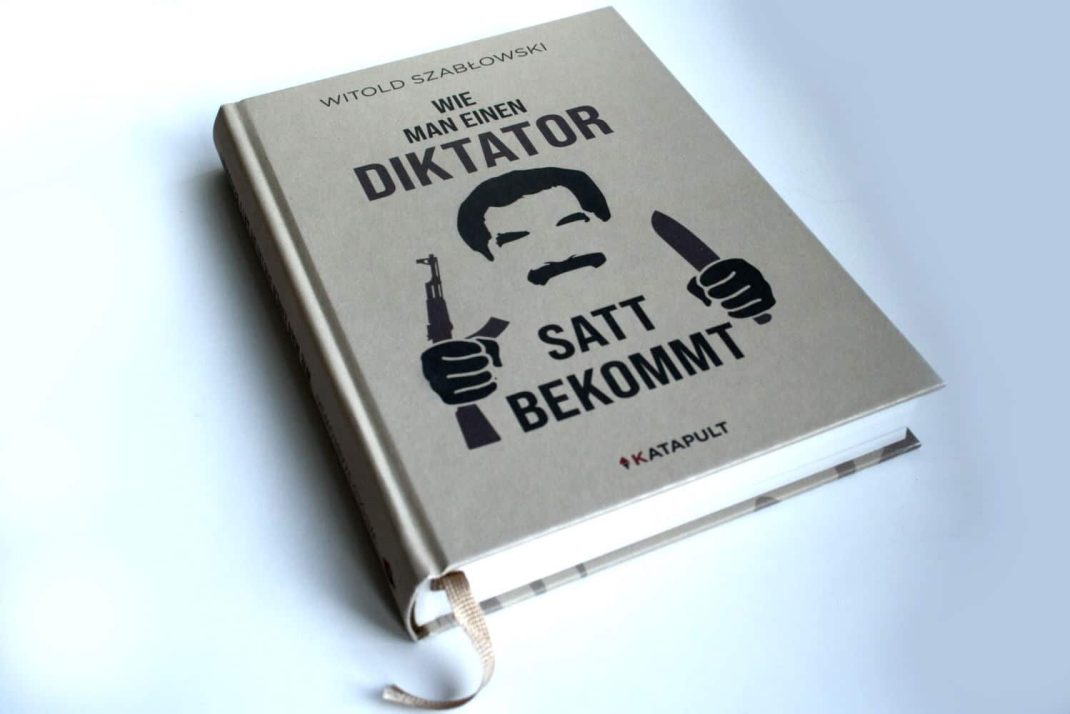
























Keine Kommentare bisher