2022 veröffentlichte Martin Gross bei Sol et Chant schon ein Buch, welches das irritierende Verhältnis des Westens zu Russland und Russlands zum Westen auf besondere Weise erzählte – als eine Geschichte der absehbaren Missverständnisse und falschen Erwartungen. Als Organisator internationaler wissenschaftlicher Projekte in Russland von 1998 bis 2016 wusste Gross, warum es nicht funktionierte. Und auch „Nadjas Geschichte“ widmet sich diesem schwierigen Dialog.
Es ist das bislang persönlichste Buch von Martin Gros, merkt der Verlag an. Und die Geschichte geht tatsächlich ans elementare Leben, dorthin, wo wir mit Erschütterungen nie rechnen, obwohl sie unser Leben jederzeit aus der Bahn werfen können. Eigentlich ist es eine Liebesgeschichte – die Geschichte einer späten Liebe, in welcher der Tagebuchschreiber der Russin Nadja begegnet, die auf dem Markt einer kleinen Stadt irgendwo hinter Berlin selbstgetöpferte Schüsseln verkauft. Farbenfroh, zum Anschauen verlockend. Und Nadja selbst ist schön und selbstbewusst. Und dass der Erzähler Russisch beherrscht seit seinen vielen Aufenthalten in russischen Universitäten, ist wie ein Türöffner.
Die beiden finden Vertrauen zueinander, fahren Boot, nähern sich an und überlegen schon, wie ein gemeinsames Leben funktionieren könnte.
Doch dann erleidet Nadja eine Hirnblutung. Ihr Leben hängt am seidenen Faden. Und statt nun gemeinsame Pläne zu schmieden, fährt der Erzähler Woche für Woche ins Krankenhaus, hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Auf einmal ist er zum Betreuer einer Frau geworden, von der er noch kaum weiß, wer sie wirklich ist. Und ob dieser kurze Herbst, den sie gemeinsam erlebten, tatsächlich die Basis für eine Zukunft sein kann, in der die fremde Geliebte auf einmal zum Pflegefall wird.
Der Weg zurück
Da Martin Gross die Geschichte – wie schon in „Ein Winter in Jakuschevsk“ – in Tagebuchform erzählt, ist man als Leser immerfort nur auf demselben Stand wie der Erzähler selbst. Der natürlich nicht weiß, was die Zukunft bringt, ob die Hoffnung trügt und am Ende nur noch ein Mensch steht, der im Pflegeheim untergebracht werden muss. Oder ob das Arrangement trägt, das er mit Nadjas Entlassung und Hilfe ihres Sohnes Andrej in seiner kleinen Wohnung schafft, um Nadja auf ihrem Weg zurück zum Bewegen, Sprechen, Erinnern zu begleiten.
Ein Weg voller Rückschläge, mit Nadjas Fluchtversuchen „nach Hause“, von dem sie selbst vielleicht nicht weiß, wo dieses Zuhause eigentlich ist. Ist es die einstige Heimat am Jenissei? Ist es das Haus, das sie sich gekauft hat und dafür einen Kredit aufgenommen hat, den sie als Deutschlehrerin durchaus hätte abbezahlen können, wäre nicht die Gehirnblutung dazwischen gekommen.
Selbst dieses Leben in Deutschland, in das Nadja vor Jahren der Liebe wegen kam, ist ja kompliziert und bürokratisch genug. Durchreglementiert und voller Formalien, die ja selbst Menschen in den Wahnsinn treiben können, die darin aufgewachsen sind. Wie erst Menschen wie Nadja, die ja in ihrer Heimat erlebt hat, wie das Leben auch unter widrigsten, aber eben auch elementarsten Bedingungen funktioniert, wenn ein Staat gar kein Interesse daran hat, seine Bürger zu behüten und zu beschützen.
Das Befremden
Vieles von dem, was die Sicht der Russen auf den Westen ausmacht, wird in diesen Tagebuchaufzeichnungen sichtbar, bringt auch den Erzähler immer wieder aus der Spur, obwohl er es doch mit seinen Reiseerfahrungen weiß, wie anders dieses Russland tickt.
Aber dieses Stutzen kennt Martin Gross ja zur Genüge, der schon 1990 aus dem Westen nach Dresden übersiedelte, um jenen Bruch zu studieren – und im Buch „Das letzte Jahr“ dann auch niederzuschreiben -, der das Leben der Ostdeutschen mit der Deutschen Einheit radikal veränderte. Aber eben nicht alles veränderte und die Ostdeutschen eben bis heute sehr befremdende Erfahrungen machen ließ. Dieses Befremden, wenn eingeübte Selbstverständlichkeiten nicht mehr gelten sollen und mit den Erwartungen der neuen Wortführer kollidieren, ist ja dem Befremden sehr ähnlich, das Martin Gross schon in „Winter in Jakuschevsk“ schilderte.
Mitsamt der Erkenntnis übrigens, dass er selbst überhaupt eine Antenne dafür hatte, während die europäischen Förderer oft völlig blind waren für das tatsächliche Leben und die Zwänge in der russischen Gesellschaft, die im Jakuschevsk-Buch gerade in ihrer größten Krise steckte. Denn die zehn Transformations-Jahre nach dem Ende der Sowjetunion und den neoliberalen Wirtschaftsreformen endete in einem einzigen Debakel, Chaos und Aussichtslosigkeit, während sich einige Wenige die Reichtümer und Unternehmen des Landes unter den Nagel gerissen hatten.
Auch diese Zukunftslosigkeit hatte Nadja dazu bewogen, lieber nach Deutschland zu gehen.
Ein Wladimir Putin hat bis heute in Russland eben auch den Ruf, dieses Chaos beendet, Russland wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt und mit russischem Erdgas einen gewissen Wohlstand geschaffen zu haben. Das vergisst man ja gern, wenn man ihn nur als kalten Sachwalter des russischen Imperialismus betrachtet – der er freilich auch ist.
Kollidierende Sichten
Aber mit Nadja bekommt der Tagebuchschreiber eben auch die wirkliche Sicht der Russen mit, mit Anrufen und E-Mail-Botschaften mit einstigen Kolleginnen und Kollegen in Russland ebenfalls. Und dass der Krieg gegen die Ukraine ausgerechnet während Nadjas Krankheit ausbricht, zwingt ihn natürlich dazu, immer wieder zu vergleichen und verstehen zu wollen, wie es die Menschen in Russland eigentlich sehen, was da passiert. Und warum sie die westeuropäische Sicht allesamt nicht teilen.
Zerstört das jetzt Freundschaften und Vertrauen? Kann man jetzt überhaupt nicht mehr miteinander reden, ohne vermintes Gelände zu betreten? Oder ist das Eigentliche, das Menschliche noch immer da, auf dem man aufbauen kann und das ja letztlich auch Freundschaften begründet?
Und wonach sehnt sich Nadja, die nach vielen schweren Krisen tatsächlich langsam und mit immer mehr Menschen um sich, denen ihre Genesung am Herzen liegt, den Weg zurückfindet ins Leben. Auch wenn sich der Tagebuchschreiber lange nicht sicher ist, ob es wirklich die Nadja noch ist, die er im Herbst zuvor kennengelernt hat. Oder lernt er jetzt eine andere Nadja kennen, eine, mit der er nicht umgehen kann? Die ihn auch nicht wiedererkennt oder nicht akzeptiert?
Allein das wäre ja schon eine Geschichte, die so richtig an die Substanz geht. Denn das Geld, sie jahrelang als Pflegefall zu betreuen, haben weder er noch ihr Sohn Andrej. Und wie kann man so ein Leben überhaupt gestalten, wenn die kurze Liebe darin nicht wieder auftaucht und trägt?
Wo ist Zuhause?
Eine Liebe, die ganz offensichtlich ohne die Liebe zu Russland nicht existieren kann. Ganz am Ende ist eine Video-Reise auf dem Jenissei fast wie eine Reise in Nadjas Heimat. Auch wie ein Versprechen, dass beide irgendwann, wenn der Krieg zu Ende ist, doch dorthin fahren und gemeinsam auf diesem riesigen Fluss fahren. Aber mit seinem Interesse für Nadjas Geschichte hilft der Erzähler auch, dass Nadja selbst wieder Faden um Faden zum eigenen Leben knüpft. Manchmal abweisend und zur Flucht bereit, dann wieder bereit, sich dem mühsamen Suchen nach der eigenen Persönlichkeit zu stellen.
Natürlich ist das am Ende eine Geschichte, die nur offen bleiben kann. Die aber auch zeigt, dass alle Medienberichte nicht genügen, wirklich die Seele eines Landes kennenzulernen und das Selbstverständnis seiner Bewohner für das, was richtig und gut ist. Und wo westliche Maßstäbe völlig versagen, weil sie auf ein Land treffen, das seine Orientierung noch immer in einer verklärten Vergangenheit sucht, deren gewaltvolle Schattenseiten meist verdrängt werden. Eine Fremdheit, die all die gutgemeinten europäischen Förderprogramme nicht aufheben konnten.
Ein tiefer pessimistischer Zug kommt ganz am Ende noch zum Vorschein, wenn der Erzähler in den sterbenden Dörfern am Jenissei die Zukunft der Menschheit zu sehen glaubt, ihre ganze Vergänglichkeit und die Rückkehr der Tundra in die verlassenen Ortschaften. „Zu besichtigen war, was zurückbleibt, wenn die Menschen gegangen sind …“
So fern ist dieses Russland nicht. Es steht vor denselben Fragen des Überlebens, auch wenn sie zugedeckt sind von einem neuen Nationalstolz und einem Krieg, der die Brücke schlagen soll in eine imperiale Vergangenheit, während abgelegene Regionen wieder veröden und nur die Umweltbelastungen bleiben, die noch in 100 Jahren davon erzählen, wie rücksichtslos der Mensch hier gewirtschaftet hat.
So gesehen auch ein Spiegel für den Westen, in dem Nadja ja doch ihr Zuhause gefunden hat und am Ende einsieht, dass es das Zuhause aus ihrer Erinnerung nicht mehr gibt.
Martin Gross „Nadjas Geschichte“, Sol et Chant, Letschin 2023, 26 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
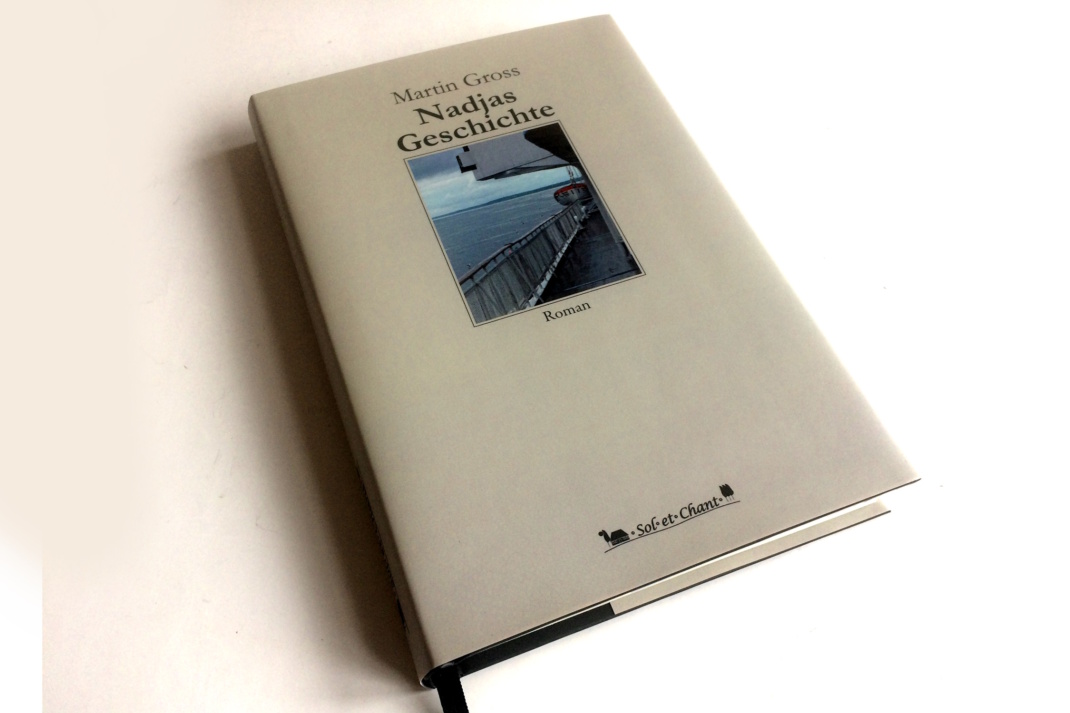














Keine Kommentare bisher